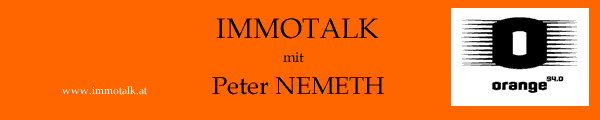ABGB
Allgemeines
bürgerliches Gesetzbuch vom 1. 6. 1811 JGS 946
Allgemeines
bürgerliches Gesetzbuch
JGS 946
idF:
BGBl I 2002/118
Inhaltsübersicht
Einleitung §§ 1 - 14
Erster Teil Von dem Personenrechte
Erstes Hauptstück Von den Rechten, welche sich auf persönliche
Eigenschaften und Verhältnisse beziehen §§ 15 - 43
Zweites Hauptstück Von dem Eherechte §§ 44 - 136
Drittes Hauptstück Von den Rechten zwischen Eltern und Kindern §§
137 - 186
Viertes Hauptstück Von der Obsorge einer anderen Person, der
Sachwalterschaft und der Kuratel §§ 187 - 284
Zweiter Teil Von dem Sachenrechte
Von
Sachen und ihrer rechtlichen Einteilung §§ 285 - 308
Erste Abteilung des Sachenrechtes Von den dinglichen Rechten
Erstes Hauptstück Von dem Besitzer §§ 309 - 352
Zweites Hauptstück Von dem Eigentumsrechte §§ 353 - 379
Drittes Hauptstück Von der Erwerbung des Eigentumes durch Zueignung
§§ 380 - 403
Viertes Hauptstück Von Erwerbung des Eigentumes durch Zuwachs §§ 404
- 422
Fünftes Hauptstück Von Erwerbung des Eigentumes durch Übergabe §§
423 - 446
Sechstes Hauptstück Von dem Pfandrechte §§ 447 - 471
Siebentes Hauptstück Von Dienstbarkeiten (Servituten) §§ 472 - 530
Achtes Hauptstück Von dem Erbrechte §§ 531 - 551
Neuntes Hauptstück Von der Erklärung des letzten Willens überhaupt und
den Testamenten insbesondere §§ 552 - 603
Zehntes Hauptstück Von Nacherben [und Fideikommissen] §§ 604 - 646
Elftes Hauptstück Von Vermächtnissen §§ 647 - 694
Zwölftes Hauptstück Von Einschränkung und Aufhebung des letzten Willens
§§ 695 - 726
Dreizehntes Hauptstück Von der gesetzlichen Erbfolge §§ 727 - 761
Vierzehntes Hauptstück Von dem Pflichtteile und der Anrechnung in den
Pflicht- oder Erbteil §§ 762 - 796
Fünfzehntes Hauptstück Von Besitznehmung der Erbschaft §§ 797 - 824
Sechzehntes Hauptstück Von der Gemeinschaft des Eigentums und anderer
dinglichen Rechte §§ 825 - 858
Zweite Abteilung Von den persönlichen Sachenrechten
Siebzehntes Hauptstück Von Verträgen und Rechtsgeschäften überhaupt
§§ 859 - 937
Achzehntes Hauptstück Von Schenkungen §§ 938 - 956
Neunzehntes Hauptstück Von dem Verwahrungsvertrage §§ 957 - 970
Zwanzigstes Hauptstück Von dem Leihvertrage §§ 971 - 982
Einundzwanzigstes Hauptstück Von dem Darlehensvertrage §§ 983 - 1001
Zweiundzwanzigstes Hauptstück Von der Bevollmächtigung und andern Arten
der Geschäftsführung §§ 1002 - 1044
Dreiundzwanzigstes Hauptstück Von dem Tauschvertrage §§ 1045 - 1052
Vierundzwanzigstes Hauptstück Von dem Kaufvertrage §§ 1053 - 1089
Fünfundzwanzigstes Hauptstück Von Bestand-, Erbpacht- und
Erbzinsverträgen §§ 1090 - 1150
Sechsundzwanzigstes Hauptstück Von Verträgen über Dienstleistungen
§§ 1151 - 1174
Siebenundzwanzigstes Hauptstück Von dem Vertrage über eine Gemeinschaft
der Güter §§ 1175 - 1216
Achtundzwanzigstes Hauptstück Von den Ehepakten §§ 1217 - 1266
Neunundzwanzigstes Hauptstück Von den Glücksverträgen §§ 1267 - 1292
Dreißigstes Hauptstück Von dem Rechte des Schadensersatzes und der
Genugtuung §§ 1293 - 1341
Dritter Teil Von den gemeinschaftlichen Bestimmungen der Personen- und
Sachenrechte
Erstes Hauptstück Von Befestigung der Rechte und Verbindlichkeiten §§
1342 - 1374
Zweites Hauptstück Von Umänderung der Rechte und Verbindlichkeiten §§
1375 - 1410
Drittes Hauptstück Von Aufhebung der Rechte und Verbindlichkeiten §§
1411 - 1450
Viertes Hauptstück Von der Verjährung und Ersitzung §§ 1451 - 1502
Kundmachung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
Kaiserliches Patent vom 1. 6. 1811 JGS 946
(1) Aus der
Betrachtung, daß die bürgerlichen Gesetze, um den Bürgern volle Beruhigung
über den gesicherten Genuß ihrer Privatrechte zu verschaffen, nicht nur
nach den allgemeinen Grundsätzen der Gerechtigkeit; sondern auch auch den
besonderen Verhältnissen der Einwohner bestimmt, in einer ihnen
verständlichen Sprache bekannt gemacht, und durch eine ordentliche
Sammlung in stetem Andenken erhalten werden sollen, haben Wir seit dem
Antritte Unserer Regierung unausgesetzt Sorge getragen, daß die schon von
Unseren Vorfahren beschlossene und unternommene Abfassung eines
vollständigen, einheimischen bürgerlichen Gesetzbuches ihrer Vollendung
zugeführt werde.
(2) Der während
Unserer Regierung von Unserer Hofkommission in Gesetzsachen zu stande
gebrachte Entwurf ward, sowie ehedem der Entwurf des Gesetzbuches über
Verbrechen und schwere Polizeiübertretungen, den in den verschiedenen
Provinzen eigens aufgestellten Kommissionen zur Beurteilung mitgeteilt, in
Galizien aber inzwischen schon in Anwendung gesetzt.
(3) Nachdem auf
solche Art die Meinungen der Sachverständigen, und die aus der Anwendung
eingeholten Erfahrungen zur Berichtigung dieses so wichtigen Zweiges der
Gesetzgebung benützt worden sind; haben Wir nun beschlossen, diese
allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für Unsere gesamten deutschen Erbländer
kund zu machen, und zu verordnen, daß dasselbe mit dem 1. Januar 1812 zur
Anwendung kommen solle.
(4) Dadurch wird
das bis jetzt angenommene gemeine Recht, der am 1. November 1786
kundgemachte erste Teil des bürgerlichen Gesetzbuches, das für Galizien
gegebene bürgerliche Gesetzbuch, samt allen auf die Gegenstände dieses
allgemeinen bürgerlichen Rechtes sich beziehenden Gesetzen und
Gewohnheiten, außer Wirksamkeit gesetzt.
(5) Wie Wir aber in
dem Gesetzbuche selbst zur allgemeinen Vorschrift aufgestellt haben, daß
die Gesetze nicht zurückwirken sollen; so soll auch dieses Gesetzbuch auf
Handlungen, die dem Tage, an welchem es verbindliche Kraft erhält,
vorhergegangen, und auf die nach den früheren Gesetzen bereits erworbenen
Rechte keinen Einfluß haben; diese Handlungen mögen in zweiseitig
verbindlichen Rechtsgeschäften, oder in solchen Willenserklärungen
bestehen, die von dem Erklärenden noch eigenmächtig abgeändert, und nach
den in dem gegenwärtigen Gesetzbuche enthaltenen Vorschriften eingerichtet
werden könnten.
(6) Daher ist auch
eine schon vor der Wirksamkeit dieses Gesetzbuches angefangene Ersitzung
oder Verjährung nach den älteren Gesetzen zu beurteilen. Wollte sich
jemand auf eine Ersitzung oder Verjährung berufen, die in dem neueren
Gesetze auf eine kürzere Zeit als in den früheren Gesetzen bestimmt ist;
so kann er auch diese kürzere Frist erst von dem Zeitpunkte, an welchem
das gegenwärtigen Gesetz verbindliche Kraft erhält, zu berechnen anfangen.
(7) Die
Vorschriften dieses Gesetzbuches sind zwar allgemein verbindlich; doch
bestehen für den Militärstand und für die zum Militärkörper gehörigen
Personen besondere, auf das Privatrecht sich beziehende Vorschriften,
welche bei den von, oder mit ihnen vorzunehmenden Rechtsgeschäften,
obschon in dem Gesetzbuche nicht ausdrücklich darauf hingewiesen worden
ist, zu beobachten sind. Handels- und Wechselgeschäfte werden nach den
besonderen Handels- und Wechselgesetzen, insofern sie von den Vorschriften
dieses Gesetzbuches abweichen, beurteilt.
(8) Auch bleiben
die über politische, Kameral- oder Finanzgegenstände kundgemachten, die
Privatrechte beschränkenden, oder näher bestimmenden Verordnungen, obschon
in diesem Gesetzbuche sich darauf nicht ausdrücklich bezogen würde, in
ihrer Kraft.
(9) Insbesondere
sind die auf Geldzahlungen sich beziehenden Rechte und Verbindlichkeiten
nach dem, über das zum Umlauf und zur gemeinen Landes-(Wiener)Währung
bestimmte Geld, bereits erlassenen Patente vom 20. Hornung 1811, oder nach
den noch zu erlassenden besonderen Gesetzen, und nur bei deren
Ermangelung, nach den allgemeinen Vorschriften des Gesetzbuches zu
beurteilen.
(10) Wir erklären
zugleich den gegenwärtigen deutschen Text des Gesetzbuches als den Urtext,
wonach die veranstalteten Übersetzungen in die verschiedenen
Landessprachen Unserer Provinzen zu beurteilen sind.
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
Einleitung
Von
den bürgerlichen Gesetzen überhaupt
Begriff des
bürgerlichen Rechtes
§
1. Der Inbegriff der Gesetze, wodurch die Privatrechte und
Pflichten der Einwohner des Staates unter sich bestimmt werden, macht das
bürgerliche Recht in demselben aus.
§
2. Sobald ein Gesetz gehörig kundgemacht worden ist, kann sich
niemand damit entschuldigen, daß ihm dasselbe nicht bekannt geworden sei.
Anfang der
Wirksamkeit der Gesetze
§
3. Die Wirksamkeit eines Gesetzes und die daraus entspringenden
rechtlichen Folgen nehmen [gleich] nach der Kundmachung ihren Anfang
[nunmehr: nach Ablauf des Tages der
Kundmachung]; es wäre denn, daß in dem kundgemachten Gesetze
selbst der Zeitpunkt seiner Wirksamkeit weiter hinaus bestimmt würde.
§
4. außer Kraft getreten
§
5. Gesetze wirken nicht zurück; sie haben daher auf
vorhergegangene Handlungen und auf vorher erworbene Rechte keinen Einfluß.
Auslegung
§
6. Einem Gesetze darf in der Anwendung kein anderer Verstand
beigelegt werden, als welcher aus der eigentümlichen Bedeutung der Worte
in ihrem Zusammenhange und aus der klaren Absicht des Gesetzgebers
hervorleuchtet.
§
7. Läßt sich ein Rechtsfall weder aus den Worten, noch aus dem
natürlichen Sinne eines Gesetzes entscheiden, so muß auf ähnliche, in den
Gesetzen bestimmt entschiedene Fälle, und auf die Gründe anderer damit
verwandten Gesetze Rücksicht genommen werden. Bleibt der Rechtsfall noch
zweifelhaft; so muß solcher mit Hinsicht auf die sorgfältig gesammelten
und reiflich erwogenen Umstände nach den natürlichen Rechtsgrundsätzen
entschieden werden.
§
8. Nur dem Gesetzgeber steht die Macht zu, ein Gesetz auf eine
allgemein verbindliche Art zu erklären. Eine solche Erklärung muß auf alle
noch zu entscheidende Rechtsfälle angewendet werden, dafern der
Gesetzgeber nicht hinzufügt, daß seine Erklärung bei Entscheidung solcher
Rechtsfälle, welche die vor der Erklärung unternommenen Handlungen und
angesprochenen Rechte zum Gegenstande haben, nicht bezogen werden solle.
Dauer des Gesetzes
§
9. Gesetze behalten so lange ihre Kraft, bis sie von dem
Gesetzgeber abgeändert oder ausdrücklich aufgehoben werden.
Andere Arten der Vorschriften, als:
a) Gewohnheiten
§
10. Auf Gewohnheiten kann nur in den Fällen, in welchen sich ein
Gesetz darauf beruft, Rücksicht genommen werden.
[b)
Provinzialstatuten
§
11. Nur jene Statuten einzelner Provinzen und Landesbezirke haben
Gesetzeskraft, welche nach der Kundmachung dieses Gesetzbuches von dem
Landesfürsten ausdrücklich bestätigt werden.]
c) Richterliche
Aussprüche
§
12. Die in einzelnen Fällen ergangenen Verfügungen und die von
Richter[stühle]n in besonderen Rechtsstreitigkeiten gefällten Urteile
haben nie die Kraft eines Gesetzes, sie können auf andere Fälle oder auf
andere Personen nicht ausgedehnt werden.
d) Privilegien
§
13. Die einzelnen Personen oder auch ganzen Körpern verliehenen
Privilegien und Befreiungen sind, insofern hierüber die politischen
Verordnungen keine besondere Bestimmung enthalten, gleich den übrigen
Rechten zu beurteilen.
Haupteinteilung des
bürgerlichen Rechtes
§
14. Die in dem bürgerlichen Gesetzbuche enthaltenen Vorschriften
haben das Personenrecht, das Sachenrecht und die denselben
gemeinschaftlich zukommenden Bestimmungen zum Gegenstande.
Erster Teil
Von dem Personenrechte
Erstes Hauptstück
Von den Rechten, welche sich auf persönliche Eigenschaften und
Verhältnisse beziehen
Personenrechte
§
15. Die Personenrechte beziehen sich teils auf persönliche
Eigenschaften und Verhältnisse; teils gründen sie sich in dem
Familienverhältnisse.
I.
Aus dem Charakter der Persönlichkeit.
Angeborne Rechte
§
16. Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft
einleuchtende Rechte, und ist daher als eine Person zu betrachten.
Sklaverei oder Leibeigenschaft, und die Ausübung einer darauf sich
beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet.
Rechtliche Vermutung
derselben
§
17. Was den angebornen natürlichen Rechten angemessen ist, dieses
wird so lange als bestehend angenommen, als die gesetzmäßige Beschränkung
dieser Rechte nicht bewiesen wird.
Erwerbliche Rechte
§
18. Jedermann ist unter den von den Gesetzen vorgeschriebenen
Bedingungen fähig, Rechte zu erwerben.
Verfolgung der Rechte
§
19. Jedem, der sich in seinem Rechte gekränkt zu sein erachtet,
steht es frei, seine Beschwerde vor der durch die Gesetze bestimmten
Behörde anzubringen. Wer sich aber mit Hintansetzung derselben der
eigenmächtigen Hilfe bedient, oder, wer die Grenzen der Notwehr
überschreitet, ist dafür verantwortlich.
§
20. [Auch solche Rechtsgeschäfte, die das Oberhaupt des Staates
betreffen, aber auf dessen Privateigentum, oder auf die in dem
bürgerlichen Rechte gegründeten Erwerbungsarten sich beziehen, sind von
den Gerichtsbehörden nach den Gesetzen zu beurteilen.]
II.
Personenrechte der Minderjährigen und der sonst in ihrer
Handlungsfähigkeit Beeinträchtigten
§
21.
(1) Minderjährige
und Personen, die aus einem anderen Grund als dem ihrer Minderjährigkeit
alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten selbst gehörig zu besorgen nicht
vermögen, stehen unter dem besonderen Schutz der Gesetze.
(2)
1) Minderjährige sind
Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; haben sie das
14. Lebensjahr noch nicht vollendet, so sind sie unmündig.
§
22. Selbst ungeborne Kinder haben von dem Zeitpunkte ihrer
Empfängnis an einen Anspruch auf den Schutz der Gesetze. Insoweit es um
ihre und nicht um die Rechte eines Dritten zu tun ist, werden sie als
Geborne angesehen; ein totgebornes Kind aber wird in Rücksicht auf die ihm
für den Lebensfall vorbehaltenen Rechte so betrachtet, als wäre es nie
empfangen worden.
§
23. In zweifelhaftem Falle, ob ein Kind lebendig oder tot geboren
worden sei, wird das erstere vermutet. Wer das Gegenteil behauptet, muß es
beweisen.
III.
Aus dem Verhältnisse der Abwesenheit
§
24. aufgehoben
§
25. aufgehoben
IV.
Aus dem Verhältnisse einer moralischen Person
§
26. Die Rechte der Mitglieder einer erlaubten Gesellschaft unter
sich werden durch den Vertrag oder Zweck und die besondern für dieselben
bestehenden Vorschriften bestimmt. Im Verhältnisse gegen andere genießen
erlaubte Gesellschaften in der Regel gleiche Rechte mit den einzelnen
Personen. Unerlaubte Gesellschaften haben als solche keine Rechte, weder
gegen die Mitglieder, noch gegen andere, und sie sind unfähig, Rechte zu
erwerben. Unerlaubte Gesellschaften sind aber diejenigen, welche durch die
politischen Gesetze insbesondere verboten werden, oder offenbar der
Sicherheit, öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten widerstreiten.
§
27. Inwiefern Gemeinden in Rücksicht ihrer Rechte unter einer
besonderen Vorsorge der öffentlichen Verwaltung stehen, ist in den
politischen Gesetzen enthalten.
V.
Aus dem Verhältnisse eines Staatsbürgers
§
28. Den vollen Genuß der bürgerlichen Rechte erwirbt man durch die
Staatsbürgerschaft. [Die Staatsbürgerschaft in diesen Erbstaaten ist
Kindern eines österreichischen Staatsbürgers durch die Geburt eigen.]
§
29. außer Kraft getreten
§
30. außer Kraft getreten
§
31. außer Kraft getreten
§
32. außer Kraft getreten
Rechte der Fremden
§
33. Den Fremden kommen überhaupt gleiche bürgerliche Rechte und
Verbindlichkeiten mit den Eingebornen zu, wenn nicht zu dem Genusse dieser
Rechte ausdrücklich die Eigenschaft eines Staatsbürgers erfordert wird.
Auch müssen die Fremden, um gleiches Recht mit den Eingebornen zu
genießen, in zweifelhaften Fällen beweisen, daß der Staat, dem sie
angehören, die hierländigen Staatsbürger in Rücksicht des Rechtes, wovon
die Frage ist, ebenfalls wie die seinigen behandle.
§
34. außer Kraft getreten
§
35. außer Kraft getreten
§
36. außer Kraft getreten
§
37. außer Kraft getreten
§
38. Die Gesandten, die öffentlichen Geschäftsträger und die in
ihren Diensten stehenden Personen genießen die in dem Völkerrechte und in
den öffentlichen Verträgen gegründeten Befreiungen.
VI.
Personenrechte aus dem Religionsverhältnisse
§
39. Die Verschiedenheit der Religion hat auf die Privatrechte
keinen Einfluß, außer insofern dieses bei einigen Gegenständen durch die
Gesetze insbesondere angeordnet wird.
VII.
Aus dem Familienverhältnisse.
Familie,
Verwandtschaft und Schwägerschaft
§
40. Unter Familie werden die Stammeltern mit allen ihren
Nachkommen verstanden. Die Verbindung zwischen diesen Personen wird
Verwandtschaft; die Verbindung aber, welche zwischen einem Ehegatten und
den Verwandten des andern Ehegatten entsteht, Schwägerschaft genannt.
§
41. Die Grade der Verwandtschaft zwischen zwei Personen sind nach
der Zahl der Zeugungen, mittels welcher in der geraden Linie eine
derselben von der andern, und in der Seitenlinie beide von ihrem nächsten
gemeinschaftlichen Stamme abhängen, zu bestimmen. In welcher Linie und in
welchem Grade jemand mit dem einen Ehegatten verwandt ist, in eben der
Linie und in eben dem Grade ist er mit dem andern Ehegatten verschwägert.
§
42. Unter dem Namen Eltern werden in der Regel ohne Unterschied
des Grades alle Verwandte in der aufsteigenden; und unter dem Namen Kinder
alle Verwandte in der absteigenden Linie begriffen.
VIII. Schutz des Namens
§
43. Wird jemandem das Recht zur Führung seines Namens bestritten
oder wird er durch unbefugten Gebrauch seines Namens (Decknamens)
beeinträchtigt, so kann er auf Unterlassung und bei Verschulden auf
Schadenersatz klagen.
Zweites Hauptstück
Von dem Eherechte
Begriff der Ehe,
§
44. Die Familienverhältnisse werden durch den Ehevertrag
gegründet. In dem Ehevertrage erklären zwei Personen verschiedenen
Geschlechtes gesetzmäßig ihren Willen, in unzertrennlicher Gemeinschaft zu
leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, und sich gegenseitigen Beistand
zu leisten.
und des
Eheverlöbnisses
§
45. Ein Eheverlöbnis oder ein vorläufiges Versprechen, sich zu
ehelichen, unter was für Umständen oder Bedingungen es gegeben oder
erhalten worden, zieht keine rechtliche Verbindlichkeit nach sich, weder
zur Schließung der Ehe selbst, noch zur Leistung desjenigen, was auf den
Fall des Rücktrittes bedungen worden ist.
Rechtliche Wirkung
des Rücktrittes vom Eheverlöbnisse
§
46. Nur bleibt dem Teile, von dessen Seite keine gegründete
Ursache zu dem Rücktritte entstanden ist, der Anspruch auf den Ersatz des
wirklichen Schadens vorbehalten, welchen er aus diesem Rücktritte zu
leiden beweisen kann.
§
47. außer Kraft getreten
§
48. außer Kraft getreten
§
49. außer Kraft getreten
§
50. außer Kraft getreten
§
51. außer Kraft getreten
§
52. außer Kraft getreten
§
53. außer Kraft getreten
§
54. außer Kraft getreten
§
55. außer Kraft getreten
§
56. außer Kraft getreten
§
57. außer Kraft getreten
§
58. außer Kraft getreten
§
59. außer Kraft getreten
§
60. außer Kraft getreten
§
61. außer Kraft getreten
§
62. außer Kraft getreten
§
63. außer Kraft getreten
§
64. außer Kraft getreten
§
65. außer Kraft getreten
§
66. außer Kraft getreten
§
67. außer Kraft getreten
§
68. außer Kraft getreten
§
69. außer Kraft getreten
§
70. außer Kraft getreten
§
71. außer Kraft getreten
§
72. außer Kraft getreten
§
73. außer Kraft getreten
§
74. außer Kraft getreten
§
75. außer Kraft getreten
§
76. außer Kraft getreten
§
77. außer Kraft getreten
§
78. außer Kraft getreten
§
79. außer Kraft getreten
§
80. außer Kraft getreten
§
81. außer Kraft getreten
§
82. außer Kraft getreten
§
83. außer Kraft getreten
§
84. außer Kraft getreten
§
85. außer Kraft getreten
§
86. außer Kraft getreten
§
87. außer Kraft getreten
§
88. außer Kraft getreten
Persönliche
Rechtswirkungen der Ehe
§
89. Die persönlichen Rechte und Pflichten der Ehegatten im
Verhältnis zueinander sind, soweit in diesem Hauptstück nicht anderes
bestimmt ist, gleich.
§
90.
(1) Die Ehegatten
sind einander zur umfassenden ehelichen Lebensgemeinschaft, besonders zum
gemeinsamen Wohnen, sowie zur Treue, zur anständigen Begegnung und zum
Beistand verpflichtet.
(2) Im Erwerb des
anderen hat ein Ehegatte mitzuwirken, soweit ihm dies zumutbar, es nach
den Lebensverhältnissen der Ehegatten üblich und nicht anderes vereinbart
ist.
§
91.
(1) Die Ehegatten
sollen ihre eheliche Lebensgemeinschaft, besonders die Haushaltsführung,
die Erwerbstätigkeit, die Leistung des Beistandes und die Obsorge, unter
Rücksichtnahme aufeinander und auf das Wohl der Kinder mit dem Ziel voller
Ausgewogenheit ihrer Beiträge einvernehmlich gestalten.
(2) Von einer
einvernehmlichen Gestaltung kann ein Ehegatte abgehen, wenn dem nicht ein
wichtiges Anliegen des anderen oder der Kinder entgegensteht oder, auch
wenn ein solches Anliegen vorliegt, persönliche Gründe des Ehegatten,
besonders sein Wunsch nach Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, als
gewichtiger anzusehen sind. In diesen Fällen haben sich die Ehegatten um
ein Einvernehmen über die Neugestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft
zu bemühen.
§
92.
(1) Verlangt ein
Ehegatte aus gerechtfertigten Gründen die Verlegung der gemeinsamen
Wohnung, so hat der andere diesem Verlangen zu entsprechen, es sei denn,
er habe gerechtfertigte Gründe von zumindest gleichem Gewicht, nicht
mitzuziehen.
(2) Ungeachtet des
Abs. 1, kann ein Ehegatte vorübergehend gesondert Wohnung nehmen,
solange ihm ein Zusammenleben mit dem anderen Ehegatten, besonders wegen
körperlicher Bedrohung, unzumutbar oder dies aus wichtigen persönlichen
Gründen gerechtfertigt ist.
(3) In den Fällen
der
Abs. 1 und
2
kann jeder der Ehegatten vor oder auch nach der Verlegung der Wohnung oder
der gesonderten Wohnungnahme die Entscheidung des Gerichtes beantragen.
Das Gericht hat im Verfahren außer Streitsachen festzustellen, ob das
Verlangen auf Verlegung der gemeinsamen Wohnung oder die Weigerung
mitzuziehen oder die gesonderte Wohnungnahme durch einen Ehegatten
rechtmäßig war oder ist. Es hat bei der Entscheidung auf die gesamten
Umstände der Familie, besonders auf das Wohl der Kinder, Bedacht zu
nehmen.
§
93.
(1) Die Ehegatten
führen den gleichen Familiennamen. Dieser ist der Familienname eines der
Ehegatten, den die Verlobten vor oder bei der Eheschließung in
öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde als gemeinsamen
Familiennamen bestimmt haben. Mangels einer solchen Bestimmung wird der
Familienname des Mannes gemeinsamer Familienname.
(2) Derjenige
Verlobte, der nach
Abs. 1 als Ehegatte den Familiennamen des anderen als gemeinsamen
Familiennamen zu führen hat, kann dem Standesbeamten gegenüber vor oder
bei der Eheschließung in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde
erklären, bei der Führung des gemeinsamen Familiennamens diesem seinen
bisherigen Familiennamen unter Setzung eines Bindestrichs zwischen den
beiden Namen voran- oder nachzustellen. Dieser Ehegatte ist zur Führung
des Doppelnamens verpflichtet. Eine andere Person kann ihren Namen nur vom
gemeinsamen Familiennamen ableiten.
(3) Derjenige
Verlobte, der nach
Abs. 1 mangels einer Bestimmung den Familiennamen des anderen
Ehegatten als gemeinsamen Familiennamen zu führen hätte, kann dem
Standesbeamten gegenüber vor oder bei der Eheschließung in öffentlicher
oder öffentlich beglaubigter Urkunde erklären, seinen bisherigen
Familiennamen weiterzuführen; auf Grund einer solchen Erklärung führt
jeder Ehegatte seinen bisherigen Familiennamen weiter. In diesem Fall
haben die Verlobten den Familiennamen der aus der Ehe stammenden Kinder zu
bestimmen (§
139 Abs. 2).
§
93a. Eine Person, deren Ehe aufgelöst ist, kann dem Standesbeamten
gegenüber in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde erklären,
einen früheren Familiennamen wieder anzunehmen. Ein Familienname, der von
einem früheren Ehegatten aus einer geschiedenen oder aufgehobenen Ehe
abgeleitet wird, darf nur wieder angenommen werden, wenn aus dieser
früheren Ehe Nachkommenschaft vorhanden ist.
§
94.
(1) Die Ehegatten
haben nach ihren Kräften und gemäß der Gestaltung ihrer ehelichen
Lebensgemeinschaft zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen angemessenen
Bedürfnisse gemeinsam beizutragen.
(2) Der Ehegatte,
der den gemeinsamen Haushalt führt, leistet dadurch seinen Beitrag im Sinn
des
Abs. 1; er hat an den anderen einen Anspruch auf Unterhalt, wobei
eigene Einkünfte angemessen zu berücksichtigen sind. Dies gilt nach der
Aufhebung des gemeinsamen Haushalts zugunsten des bisher
Unterhaltsberechtigten weiter, sofern nicht die Geltendmachung des
Unterhaltsanspruchs, besonders wegen der Gründe, die zur Aufhebung des
gemeinsamen Haushalts geführt haben, ein Mißbrauch des Rechtes wäre. Ein
Unterhaltsanspruch steht einem Ehegatten auch zu, soweit er seinen Beitrag
nach
Abs. 1 nicht zu leisten vermag.
(3) Auf Verlangen
des unterhaltsberechtigten Ehegatten ist der Unterhalt auch bei aufrechter
Haushaltsgemeinschaft ganz oder zum Teil in Geld zu leisten, soweit nicht
ein solches Verlangen, insbesondere im Hinblick auf die zur Deckung der
Bedürfnisse zur Verfügung stehenden Mittel, unbillig wäre. Auf den
Unterhaltsanspruch an sich kann im vorhinein nicht verzichtet werden.
§
95. Die Ehegatten haben an der Führung des gemeinsamen Haushalts
nach ihren persönlichen Verhältnissen, besonders unter Berücksichtigung
ihrer beruflichen Belastung, mitzuwirken. Ist jedoch ein Ehegatte nicht
erwerbstätig, so obliegt diesem die Haushaltsführung; der andere ist nach
Maßgabe des
§ 91
zur Mithilfe verpflichtet.
§
96. Der Ehegatte, der den gemeinsamen Haushalt führt und keine
Einkünfte hat, vertritt den anderen bei den Rechtsgeschäften des täglichen
Lebens, die er für den gemeinsamen Haushalt schließt und die ein den
Lebensverhältnissen der Ehegatten entsprechendes Maß nicht übersteigen.
Dies gilt nicht, wenn der andere Ehegatte dem Dritten zu erkennen gegeben
hat, daß er von seinem Ehegatten nicht vertreten sein wolle. Kann der
Dritte aus den Umständen nicht erkennen, daß der handelnde Ehegatte als
Vertreter auftritt, dann haften beide Ehegatten zur ungeteilten Hand.
§
97. Ist ein Ehegatte über die Wohnung, die der Befriedigung des
dringenden Wohnbedürfnisses des anderen Ehegatten dient,
verfügungsberechtigt, so hat dieser einen Anspruch darauf, daß der
verfügungsberechtigte Ehegatte alles unterlasse und vorkehre, damit der
auf die Wohnung angewiesene Ehegatte diese nicht verliere. Dies gilt
nicht, wenn das Handeln oder Unterlassen des verfügungsberechtigten
Ehegatten durch die Umstände erzwungen wird.
§
98. Wirkt ein Ehegatte im Erwerb des anderen mit, so hat er
Anspruch auf angemessene Abgeltung seiner Mitwirkung. Die Höhe des
Anspruchs richtet sich nach der Art und Dauer der Leistungen; die gesamten
Lebensverhältnisse der Ehegatten, besonders auch die gewährten
Unterhaltsleistungen, sind angemessen zu berücksichtigen.
§
99. Ansprüche auf Abgeltung der Mitwirkung eines Ehegatten im
Erwerb des anderen (§
98) sind vererblich, unter Lebenden oder von Todes wegen übertragbar
und verpfändbar, soweit sie durch Vertrag oder Vergleich anerkannt oder
gerichtlich geltend gemacht worden sind.
§
100. Der
§ 98
berührt nicht vertragliche Ansprüche eines Ehegatten an den anderen aus
einem Mit- oder Zusammenwirken im Erwerb. Solche Ansprüche schließen einen
Anspruch nach
§ 98
aus; bei einem Dienstverhältnis bleibt dem Ehegatten jedoch der Anspruch
nach § 98
gewahrt, soweit er seine Ansprüche aus dem Dienstverhältnis übersteigt.
§
101. außer Kraft getreten
§
102. außer Kraft getreten
§
103. außer Kraft getreten
§
104. außer Kraft getreten
§
105. außer Kraft getreten
§
106. außer Kraft getreten
§
107. aufgehoben
§
108. außer Kraft getreten
§
109. außer Kraft getreten
§
110. samt Überschrift
aufgehoben
§
111. außer Kraft getreten
§
112. aufgehoben
§
113. aufgehoben
§
114. aufgehoben
§
115. außer Kraft getreten
§
116. außer Kraft getreten
§
117. samt Überschrift
aufgehoben
§
118. samt Überschrift
aufgehoben
§
119. außer Kraft getreten
§
120. außer Kraft getreten
§
121. aufgehoben
§
122. außer Kraft getreten
§
123. außer Kraft getreten
§
124. außer Kraft getreten
§
125. außer Kraft getreten
§
126. außer Kraft getreten
§
127. außer Kraft getreten
§
128. außer Kraft getreten
§
129. außer Kraft getreten
§
130. außer Kraft getreten
§
131. außer Kraft getreten
§
132. außer Kraft getreten
§
133. außer Kraft getreten
§
134. außer Kraft getreten
§
135. außer Kraft getreten
§
136. außer Kraft getreten
Drittes Hauptstück
Von den Rechten zwischen Eltern und Kindern
Allgemeine Rechte und
Pflichten
§
137.
(1) Die Eltern
haben für die Erziehung ihrer minderjährigen Kinder zu sorgen und
überhaupt ihr Wohl zu fördern.
(2) Eltern und
Kinder haben einander beizustehen, die Kinder ihren Eltern Achtung
entgegenzubringen.
(3) Die Rechte und
Pflichten des Vaters und der Mutter sind, soweit in
diesem Hauptstück
nicht anderes bestimmt ist, gleich.
§
137a. Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur insoweit
eingreifen, als ihnen dies durch die Eltern selbst, unmittelbar auf Grund
des Gesetzes oder durch eine behördliche Verfügung gestattet ist.
Mutterschaft
§
137b. Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat.
Vermutung der
Ehelichkeit
§
138.
(1)
2) Wird ein Kind nach
der Eheschließung und vor Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der
Ehe seiner Mutter geboren, so wird vermutet, dass es ehelich ist. Gleiches
gilt, wenn das Kind vor Ablauf des 300. Tages nach dem Tod des Ehemannes
der Mutter geboren wird. Diese Vermutung kann, vorbehaltlich des
§ 163e,
nur durch eine gerichtliche Entscheidung widerlegt werden, mit der
festgestellt wird, dass das Kind nicht vom Ehemann der Mutter abstammt.
(2) Träfe die
Vermutung des
Abs. 1 auch auf einen Mann zu, mit dem die Mutter nach Eingehung,
Auflösung oder Nichtigerklärung ihrer Ehe eine weitere Ehe geschlossen
hat, so gilt sie nur für diesen Mann. Wird die diesbezügliche Abstammung
des Kindes mit Erfolg bestritten, so gilt die Vermutung mit dem Eintritt
der Rechtskraft der Entscheidung für den ersten Ehemann; frühestens mit
diesem Zeitpunkt beginnt für ihn die Frist zur Bestreitung der
Ehelichkeit.
Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und ehelichen Kindern
Name
§
139.
(1) Haben die
Eltern einen gemeinsamen Familiennamen, so erhält das Kind diesen.
(2) Haben die
Eltern keinen gemeinsamen Familiennamen, so erhält das Kind den
Familiennamen, den die Eltern dem Standesbeamten gegenüber vor oder bei
der Eheschließung in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zum
Familiennamen der aus der Ehe stammenden Kinder bestimmt haben. Hiezu
können die Eltern nur den Familiennamen eines Elternteils bestimmen.
(3) Mangels einer
Bestimmung nach
Abs. 2 erhält das Kind den Familiennamen des Vaters.
Unterhalt
§
140.
(1) Die Eltern
haben zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse
des Kindes unter Berücksichtigung seiner Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen
und Entwicklungsmöglichkeiten nach ihren Kräften anteilig beizutragen.
(2) Der Elternteil,
der den Haushalt führt, in dem er das Kind betreut, leistet dadurch seinen
Beitrag. Darüber hinaus hat er zum Unterhalt des Kindes beizutragen,
soweit der andere Elternteil zur vollen Deckung der Bedürfnisse des Kindes
nicht imstande ist oder mehr leisten müßte, als es seinen eigenen
Lebensverhältnissen angemessen wäre.
(3) Der Anspruch
auf Unterhalt mindert sich insoweit, als das Kind eigene Einkünfte hat
oder unter Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse
selbsterhaltungsfähig ist.
§
141. Soweit die Eltern nach ihren Kräften zur Leistung des
Unterhalts nicht imstande sind, schulden ihn die Großeltern nach den den
Lebensverhältnissen der Eltern angemessenen Bedürfnissen des Kindes. Im
übrigen gilt der
§ 140
sinngemäß; der Unterhaltsanspruch eines Enkels mindert sich jedoch auch
insoweit, als ihm die Heranziehung des Stammes eigenen Vermögens zumutbar
ist. Überdies hat ein Großelternteil nur insoweit Unterhalt zu leisten,
als er dadurch bei Berücksichtigung seiner sonstigen Sorgepflichten den
eigenen angemessenen Unterhalt nicht gefährdet.
§
142. Die Schuld eines Elternteils, dem Kind den Unterhalt zu
leisten, geht bis zum Wert der Verlassenschaft auf seine Erben über. In
den Anspruch des Kindes ist alles einzurechnen, was das Kind nach dem
Erblasser durch eine vertragliche oder letztwillige Zuwendung, als
gesetzlichen Erbteil, als Pflichtteil oder durch eine
öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Leistung erhält. Reicht der
Wert der Verlassenschaft nicht aus, um dem Kind den geschuldeten Unterhalt
bis zum voraussichtlichen Eintritt der Selbsterhaltungsfähigkeit zu
sichern, so mindert sich der Anspruch des Kindes entsprechend.
§
143.
(1) Das Kind
schuldet seinen Eltern und Großeltern unter Berücksichtigung seiner
Lebensverhältnisse den Unterhalt, soweit der Unterhaltsberechtigte nicht
imstande ist, sich selbst zu erhalten, und sofern er seine
Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind nicht gröblich vernachlässigt hat.
(2) Die
Unterhaltspflicht der Kinder steht der eines Ehegatten, eines früheren
Ehegatten, von Vorfahren und von Nachkommen näheren Grades des
Unterhaltsberechtigten im Rang nach. Mehrere Kinder haben den Unterhalt
anteilig nach ihren Kräften zu leisten.
(3) Der
Unterhaltsanspruch eines Eltern- oder Großelternteils mindert sich
insoweit, als ihm die Heranziehung des Stammes eigenen Vermögens zumutbar
ist. Überdies hat ein Kind nur insoweit Unterhalt zu leisten, als es
dadurch bei Berücksichtigung seiner sonstigen Sorgepflichten den eigenen
angemessenen Unterhalt nicht gefährdet.
Obsorge
§
144. 3) Die
Eltern haben das minderjährige Kind zu pflegen und zu erziehen, sein
Vermögen zu verwalten und es in diesen sowie allen anderen Angelegenheiten
zu vertreten; Pflege und Erziehung sowie die Vermögensverwaltung umfassen
auch die gesetzliche Vertretung in diesen Bereichen. Bei Erfüllung dieser
Pflichten und Ausübung dieser Rechte sollen die Eltern einvernehmlich
vorgehen.
§
145.
(1) Ist ein
Elternteil, der mit der Obsorge für das Kind gemeinsam mit dem anderen
Elternteil betraut war, gestorben, ist sein Aufenthalt seit mindestens
sechs Monaten unbekannt, kann die Verbindung mit ihm nicht oder nur mit
unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten hergestellt werden oder ist ihm
die Obsorge ganz oder teilweise entzogen, so ist der andere Elternteil
insoweit allein mit der Obsorge betraut. Ist in dieser Weise der
Elternteil, der mit der Obsorge allein betraut ist, betroffen, so hat das
Gericht unter Beachtung des Wohles des Kindes zu entscheiden, ob der
andere Elternteil oder ob und welches Großelternpaar (Großelternteil) oder
Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) mit der Obsorge zu betrauen ist;
Letzteres gilt auch, wenn beide Elternteile betroffen sind.4)
Die Regelungen über die Obsorge gelten dann für dieses Großelternpaar
(diesen Großelternteil).
(2) Auf Antrag des
Elternteiles, auf den die Obsorge nach
Abs. 1 erster Satz übergegangen ist, hat das Gericht diesen Übergang
festzustellen.
(3)
5) Geht die Obsorge auf
den anderen Elternteil über oder überträgt das Gericht die Obsorge, so
sind, sofern sich der Übergang oder die Übertragung der Obsorge darauf
bezieht, das Vermögen sowie sämtliche die Person des Kindes betreffenden
Urkunden und Nachweise zu übergeben.
§
145a. Solange ein Elternteil nicht voll geschäftsfähig ist, hat er
nicht das Recht und die Pflicht, das Vermögen des Kindes zu verwalten und
das Kind zu vertreten.
§
145b. 6) Bei
Ausübung der Rechte und Erfüllung der Pflichten nach
diesem Hauptstück
ist zur Wahrung des Kindeswohls alles zu unterlassen, was das Verhältnis
des Minderjährigen zu anderen Personen, denen nach
diesem Hauptstück
das Kind betreffende Rechte und Pflichten zukommen, beeinträchtigt oder
die Wahrnehmung von deren Aufgaben erschwert.
§
145c. 7) Wird
einem minderjährigen Kind ein Vermögen zugewendet und ein Elternteil von
der Verwaltung ausgeschlossen, so ist der andere Elternteil mit der
Verwaltung betraut. Sind beide Elternteile oder jener Elternteil, der mit
der Obsorge allein betraut ist, ausgeschlossen, so hat das Gericht andere
Personen mit der Verwaltung zu betrauen.
§
146.
(1) Die Pflege des
minderjährigen Kindes umfaßt besonders die Wahrung des körperlichen Wohles
und der Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht, die Erziehung
besonders die Entfaltung der körperlichen, geistigen, seelischen und
sittlichen Kräfte, die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und
Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie dessen Ausbildung in Schule und
Beruf.
(2) Das Ausmaß der
Pflege und Erziehung richtet sich nach den Lebensverhältnissen der Eltern.
(3)
8) Die Eltern haben in
Angelegenheiten der Pflege und Erziehung auch auf den Willen des Kindes
Bedacht zu nehmen, soweit dem nicht dessen Wohl oder ihre
Lebensverhältnisse entgegenstehen. Der Wille des Kindes ist umso
maßgeblicher, je mehr es den Grund und die Bedeutung einer Maßnahme
einzusehen und seinen Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen vermag.
§
146a. Das minderjährige Kind hat die Anordnungen der Eltern zu
befolgen. Die Eltern haben bei ihren Anordnungen und deren Durchsetzung
auf Alter, Entwicklung und Persönlichkeit des Kindes Bedacht zu nehmen;
die Anwendung von Gewalt und die Zufügung körperlichen oder seelischen
Leides sind unzulässig.
§
146b. Soweit die Pflege und Erziehung es erfordern, hat der hierzu
berechtigte Elternteil auch das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu
bestimmen. Hält sich das Kind woanders auf, so haben die Behörden und
Organe der öffentlichen Aufsicht auf Ersuchen eines berechtigten
Elternteils bei der Ermittlung des Aufenthalts, notfalls auch bei der
Zurückholung des Kindes mitzuwirken.
§
146c. 9)
(1) Einwilligungen
in medizinische Behandlungen kann das einsichts- und urteilsfähige Kind
nur selbst erteilen; im Zweifel wird das Vorliegen dieser Einsichts- und
Urteilsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen vermutet. Mangelt es an der
notwendigen Einsichts- und Urteilsfähigkeit, so ist die Zustimmung der
Person erforderlich, die mit Pflege und Erziehung betraut ist.
(2) Willigt ein
einsichts- und urteilsfähiges minderjähriges Kind in eine Behandlung ein,
die gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der
körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit verbunden ist, so darf
die Behandlung nur vorgenommen werden, wenn auch die Person zustimmt, die
mit der Pflege und Erziehung betraut ist.
(3) Die
Einwilligung des einsichts- und urteilsfähigen Kindes sowie die Zustimmung
der Person, die mit Pflege und Erziehung betraut ist, sind nicht
erforderlich, wenn die Behandlung so dringend notwendig ist, dass der mit
der Einholung der Einwilligung oder der Zustimmung verbundene Aufschub das
Leben des Kindes gefährden würde oder mit der Gefahr einer schweren
Schädigung der Gesundheit verbunden wäre.
§
146d. 10)
Weder ein minderjähriges Kind noch die Eltern können in eine medizinische
Maßnahme, die eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit des minderjährigen
Kindes zum Ziel hat, einwilligen.
§
147. Hat das mündige Kind seine Meinung über seine Ausbildung den
Eltern erfolglos vorgetragen, so kann es das Gericht anrufen. Dieses hat
nach sorgfältiger Abwägung der von den Eltern und dem Kind angeführten
Gründe die zum Wohl des Kindes angemessenen Verfügungen zu treffen.
§
148. 11)
(1) Lebt ein
Elternteil mit dem minderjährigen Kind nicht im gemeinsamen Haushalt, so
haben das Kind und dieser Elternteil das Recht, miteinander persönlich zu
verkehren. Die Ausübung dieses Rechtes sollen das Kind und die Eltern
einvernehmlich regeln. Soweit ein solches Einvernehmen nicht erzielt wird,
hat das Gericht auf Antrag des Kindes oder eines Elternteils die Ausübung
dieses Rechtes unter Bedachtnahme auf die Bedürfnisse und Wünsche des
Kindes in einer dem Wohl des Kindes gemäßen Weise zu regeln.
(2) Das Gericht hat
nötigenfalls, insbesondere wenn der berechtigte Elternteil seine
Verpflichtung aus
§ 145b
nicht erfüllt, die Ausübung des Rechtes auf persönlichen Verkehr
einzuschränken oder zu untersagen.
(3) Zwischen Enkeln
und ihren Großeltern gelten
Abs. 1 und
2
sinngemäß. Die Ausübung des Rechtes der Großeltern ist jedoch auch so weit
einzuschränken oder zu untersagen, als sonst das Familienleben der Eltern
(eines Elternteils) oder deren Beziehung zu dem Kind gestört würde.
(4) Wäre durch das
Unterbleiben des persönlichen Verkehrs des minderjährigen Kindes mit einem
hiezu bereiten Dritten sein Wohl gefährdet, so hat das Gericht auf Antrag
des Kindes, eines Elternteils, des Jugendwohlfahrtsträgers oder von Amts
wegen die zur Regelung des persönlichen Verkehrs nötigen Verfügungen zu
treffen.
§
149.
(1) Die Eltern
haben das Vermögen eines minderjährigen Kindes mit der Sorgfalt
ordentlicher Eltern zu verwalten. Sofern das Wohl des Kindes nicht anderes
erfordert, haben sie es in seinem Bestand zu erhalten und nach Möglichkeit
zu vermehren; Geld ist nach den Vorschriften über die Anlegung von
Mündelgeld anzulegen.12)
(2) Aus dem
Vermögen sind jedenfalls die Kosten der Verwaltung einschließlich der für
die Erhaltung des Vermögens und den ordentlichen Wirtschaftsbetrieb
nötigen Aufwendungen und die fälligen Zahlungen zu berichtigen; weiter
auch die Kosten des Unterhalts, soweit das Kind nach den
§§ 140
und 141
zur Heranziehung seines Vermögens verpflichtet ist oder die Bedürfnisse
des Kindes nicht in anderer Weise gedeckt sind.
§
150.
(1)
13) Die Eltern haben
über das Vermögen des minderjährigen Kindes dem Gericht Rechnung zu legen;
über die Erträgnisse jedoch nur, soweit sie nicht für den Unterhalt des
Kindes verwendet worden sind. Näheres wird in den Verfahrensgesetzen
bestimmt.
(2)
14) Das Gericht kann
die Eltern von der Rechnungslegung ganz oder zum Teil befreien, soweit
keine Bedenken bestehen, daß sie das Vermögen des Kindes ordentlich
verwalten werden.
§
151.
(1) Ein
minderjähriges Kind kann ohne ausdrückliche oder stillschweigende
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters rechtsgeschäftlich weder
verfügen noch sich verpflichten.
(2) Nach erreichter
Mündigkeit kann es jedoch über Sachen, die ihm zur freien Verfügung
überlassen worden sind, und über sein Einkommen aus eigenem Erwerb so weit
verfügen und sich verpflichten, als dadurch nicht die Befriedigung seiner
Lebensbedürfnisse gefährdet wird.
(3) Schließt ein
minderjähriges Kind ein Rechtsgeschäft, das von Minderjährigen seines
Alters üblicherweise geschlossen wird und eine geringfügige Angelegenheit
des täglichen Lebens betrifft, so wird dieses Rechtsgeschäft, auch wenn
die Voraussetzungen des
Abs. 2 nicht vorliegen, mit der Erfüllung der das Kind treffenden
Pflichten rückwirkend rechtswirksam.
§
152. Soweit nicht anderes bestimmt ist, kann sich ein mündiges
minderjähriges Kind selbständig durch Vertrag zu Dienstleistungen
verpflichten, ausgenommen zu Dienstleistungen auf Grund eines Lehr- oder
sonstigen Ausbildungsvertrags. Der gesetzliche Vertreter des Kindes kann
das durch den Vertrag begründete Rechtsverhältnis aus wichtigen Gründen
vorzeitig lösen.
§
153. 15)
Soweit einem minderjährigen Kind nicht bereits früher ein Verschulden
zugerechnet werden kann (§
1310), wird es mit der Erreichung der Mündigkeit nach den
schadenersatzrechtlichen Bestimmungen verschuldensfähig.
§
154.
(1) Jeder
Elternteil ist für sich allein berechtigt und verpflichtet, das Kind zu
vertreten; seine Vertretungshandlung ist selbst dann rechtswirksam, wenn
der andere Elternteil mit ihr nicht einverstanden ist.
(2)
Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils, die die
Änderung des Vornamens oder des Familiennamens, den Eintritt in eine
Kirche oder Religionsgesellschaft und den Austritt aus einer solchen, die
Übergabe in fremde Pflege, den Erwerb einer Staatsangehörigkeit oder den
Verzicht auf eine solche, die vorzeitige Lösung eines Lehr-, Ausbildungs-
oder Dienstvertrags und die Anerkennung der Vaterschaft zu einem
unehelichen Kind betreffen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Zustimmung des anderen Elternteils. Dies gilt nicht für die Entgegennahme
von Willenserklärungen und Zustellstücken.
(3)
Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils in
Vermögensangelegenheiten bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Zustimmung des anderen Elternteils und der Genehmigung des Gerichtes,
sofern die Vermögensangelegenheit nicht zum ordentlichen
Wirtschaftsbetrieb gehört. Unter dieser Voraussetzung gehören dazu
besonders die Veräußerung oder Belastung von Liegenschaften, die Gründung,
der, auch erbrechtliche, Erwerb16)
die Umwandlung, Veräußerung oder Auflösung sowie die Änderung des
Gegenstandes eines Unternehmens, der, auch erbrechtliche, Eintritt in eine
oder die Umwandlung einer Gesellschaft oder Genossenschaft, der Verzicht
auf ein Erbrecht, die unbedingte Annahme oder die Ausschlagung einer
Erbschaft, die Annahme einer mit Belastungen verbundenen Schenkung oder
die Ablehnung eines Schenkungsanbots, die Anlegung von Geld mit Ausnahme
der in den
§§ 230a
und
230b geregelten Arten sowie die Erhebung einer Klage und alle
verfahrensrechtlichen Verfügungen, die den Verfahrensgegenstand an sich
betreffen.17) Dies
gilt nicht für die Entgegennahme von Willenserklärungen und
Zustellstücken.
(4)
18) Bedarf ein
Rechtsgeschäft der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, der
Zustimmung des anderen Elternteils oder der Genehmigung des
Pflegschaftsgerichts, so ist bei deren Fehlen das volljährig gewordene
Kind nur dann daraus wirksam verpflichtet, wenn es schriftlich erklärt,
diese Verpflichtungen als rechtswirksam anzuerkennen. Fordert der
Gläubiger den volljährig Gewordenen auf, sich nach dem ersten Satz zu
erklären, so hat er ihm dafür eine angemessene Frist zu setzen.
§
154a.
(1) In
zivilgerichtlichen Verfahren ist nur ein Elternteil allein zur Vertretung
des Kindes berechtigt; solange sich die Eltern nicht auf den anderen
Elternteil einigen oder das Gericht nach
§ 176
diesen oder einen Dritten als Vertreter bestimmt, ist Vertreter derjenige
Elternteil, der die erste Verfahrenshandlung setzt.
(2) Die nach
§ 154
erforderliche Zustimmung des anderen Elternteils und Genehmigung des
Gerichtes gelten für das ganze Verfahren.
§
154b. 19)
Soweit einem Kind infolge merkbar verzögerter Entwicklung, einer
psychischen Krankheit oder einer geistigen Behinderung die für eine
einzelne oder einen Kreis von Angelegenheiten erforderliche Einsichts- und
Urteilsfähigkeit oder Geschäftsfähigkeit fehlt, hat das Gericht dies von
Amts wegen oder auf Antrag einer Person, die ganz oder zum Teil mit der
Obsorge betraut ist, auszusprechen. Dieser Ausspruch wirkt, sofern er
nicht vom Gericht widerrufen oder befristet wurde, längstens bis zur
Volljährigkeit des Kindes.
Vermutung der
Unehelichkeit
§
155. Wird ein Kind nach Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung
der Ehe seiner Mutter geboren, so wird vermutet, dass es unehelich ist;
Gleiches gilt, wenn das Kind nach Ablauf des 300. Tages nach dem Tod des
Ehemannes der Mutter geboren wird.20)
Diese Vermutung kann nur durch eine gerichtliche Entscheidung widerlegt
werden, mit der festgestellt wird, daß das Kind vom früheren Ehemann der
Mutter abstammt; hiefür ist zu beweisen, daß während der Ehe das Kind vom
Ehemann gezeugt oder die Schwangerschaft mit dem Samen des Ehemanns oder,
sofern der Ehemann in Form eines gerichtlichen Protokolls oder eines
Notariatsakts zugestimmt hat, mit dem Samen eines Dritten durch eine
medizinisch unterstützte Fortpflanzung herbeigeführt worden ist.
Bestreitung der
Ehelichkeit
§
156.
(1) Der Ehemann der
Mutter kann die Ehelichkeit des Kindes binnen Jahresfrist bestreiten.
(2) Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Mann Kenntnis von den Umständen
erlangt, die für die Unehelichkeit des Kindes sprechen. Sie beginnt
frühestens mit der Geburt des Kindes.
(3) Der Lauf der
Frist ist gehemmt, solange der Mann innerhalb der letzten sechs Monate der
Frist durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis an der
Bestreitung gehindert ist.
§
156a. Hat der Ehemann der Mutter einer medizinisch unterstützten
Fortpflanzung mit dem Samen eines Dritten in Form eines gerichtlichen
Protokolls oder Notariatsakts zugestimmt, so kann die Ehelichkeit des mit
dem Samen des Dritten gezeugten Kindes nicht bestritten werden.
§
157.
(1) Die Bestreitung
der Ehelichkeit durch den Ehemann der Mutter ist, abgesehen vom Fall des
Abs. 2, ein höchstpersönliches Recht des Mannes. Ist der Mann
minderjährig, so bedarf er nicht der Zustimmung seines gesetzlichen
Vertreters.
(2) Ist dem Mann
ein Sachwalter nach
§ 273
bestellt worden und gehört zu den von ihm zu besorgenden Angelegenheiten
die Bestreitung der Ehelichkeit, so steht das Recht der Bestreitung dem
Sachwalter allein zu; er bedarf hierzu der gerichtlichen Genehmigung. Ist
dem Mann ein solcher Sachwalter nicht bestellt, obwohl die Voraussetzungen
vorliegen, so endet die Frist für die Bestreitung nicht vor dem Ablauf von
sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, von dem ab der Mann die Ehelichkeit
selbst bestreiten kann oder in dem ihm ein Sachwalter bestellt wird. Hat
der Sachwalter die Ehelichkeit nicht rechtzeitig bestritten, so kann der
Mann nach Beendigung der Sachwalterschaft selbst bestreiten; mit dem
Zeitpunkt der Beendigung der Sachwalterschaft beginnt die Frist neu zu
laufen.
§
158. Hat der Mann die Ehelichkeit eines Kindes nicht innerhalb
eines Jahres seit der Geburt bestritten, oder ist er gestorben oder ist
sein Aufenthalt unbekannt, so kann der Staatsanwalt die Ehelichkeit
bestreiten, wenn er dies im öffentlichen Interesse oder im Interesse des
Kindes oder seiner Nachkommenschaft für geboten erachtet.
§
159.
(1) Die Bestreitung
der Ehelichkeit erfolgt bei Lebzeiten des Kindes durch Erhebung der Klage.
Die Klage ist gegen das Kind zu richten. Wird sie zurückgenommen, so ist
die Bestreitung als nicht erfolgt anzusehen.
(2) Nach dem Tode
des Kindes kann nur der Staatsanwalt die Ehelichkeit bestreiten. Die
Bestreitung erfolgt durch Antrag auf Feststellung der Unehelichkeit. Über
den Antrag entscheidet das Pflegschaftsgericht.21)
§
159a. samt Überschrift
aufgehoben
§
159b. samt Überschrift
aufgehoben
§
160. samt Überschrift
aufgehoben
Legitimation der unehelichen Kinder
b) durch die
nachfolgende Ehe
§
161.
(1) Ist die
Vaterschaft zum Kind festgestellt (§
163b) und schließen Vater und Mutter des Kindes die Ehe, so wird das
Kind zum Zeitpunkt der Eheschließung seiner Eltern ehelich.
(2) Wird die
Vaterschaft nach der Eheschließung festgestellt, so bleiben die vor der
Feststellung für das Kind gesetzten Vertretungshandlungen unberührt.
(3) Die Wirkungen
der Legitimation treten nur auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung
außer Kraft, die in einem für die Beseitigung der Feststellung der
Vaterschaft vorgesehenen Verfahren ergeht.
c) durch Begünstigung
des Landesfürsten [nunmehr:
Bundespräsidenten]
§
162. Die uneheliche Geburt kann einem Kinde an seiner bürgerlichen
Achtung und an seinem Fortkommen keinen Abbruch tun. Zu diesem Ende bedarf
es keiner besondern Begünstigung des Landesfürsten
[nunmehr: Bundespräsidenten],
wodurch das Kind als ein eheliches erklärt wird. Nur die Eltern können um
solche ansuchen, wenn sie das Kind gleich einem ehelichen [der
Standesvorzüge oder] des Rechtes an dem frei vererblichen Vermögen
teilhaft machen wollen. In Rücksicht auf die übrigen Familienglieder hat
diese Begünstigung keine Wirkung.
§
162a.
(1) Wird ein Kind
legitimiert, so gilt
§ 139
entsprechend.
(2) Wird ein
bereits mündiges Kind legitimiert, so gilt der
Abs. 1 nur, wenn das Kind der Namensänderung zustimmt.
§
162b. Wird ein Ehegatte legitimiert, so ändert sich der gemeinsame
Familienname nur, wenn beide Ehegatten der Namensänderung zustimmen. Sonst
ändert sich, unter der Voraussetzung des
§
162a Abs. 2, nur der Familienname des Legitimierten.
§
162c.
(1) Führt ein Kind
des Legitimierten einen von diesem allein abgeleiteten Familiennamen, so
geht der vom Legitimierten erworbene Familienname auf das Kind über.
(2) Ist das Kind
des Legitimierten im Zeitpunkt der Legitimation bereits mündig, so gilt
der
Abs. 1 nur, wenn das Kind der Namensänderung zustimmt.
(3) Im übrigen
gelten für das Kind des Legitimierten die
§§ 139,
162a
und
162b entsprechend.
§
162d.
(1) Eine Zustimmung
nach den
§§ 162a
bis 162c ist dem Standesbeamten in öffentlicher oder
öffentlich-beglaubigter Urkunde zu erklären; ihre namensrechtlichen
Wirkungen treten ein, sobald sie dem Standesbeamten zukommt.
(2) Eine Zustimmung
ist unwirksam, wenn sie dem Standesbeamten später als drei Jahre nach der
Verständigung des Zustimmungsberechtigten vom Eintritt der Legitimation
durch den Standesbeamten zugekommen ist.
Vaterschaft zu einem
unehelichen Kinde
§
163.
(1) Hat ein Mann
der Mutter eines unehelichen Kindes innerhalb eines Zeitraums von nicht
mehr als 30022) und
nicht weniger als 180 Tagen vor der Entbindung beigewohnt, so wird
vermutet, daß er das Kind gezeugt hat. Ist an der Mutter eine medizinisch
unterstützte Fortpflanzung innerhalb dieses Zeitraums durchgeführt worden,
so wird vermutet, daß der Mann, dessen Samen verwendet worden ist, der
Vater des Kindes ist.
(2) Der Mann, auf
den eine Vermutung nach
Abs. 1 zutrifft, kann sie durch den Beweis einer solchen
Unwahrscheinlichkeit der Vaterschaft entkräften, die unter Würdigung aller
Umstände gegen die Annahme spricht, daß er das Kind gezeugt hat; weiters
durch den Beweis, daß seine Vaterschaft unwahrscheinlicher als die eines
anderen Mannes ist, für den eine Vermutung nach
Abs. 1 gleichfalls gilt.
(3) Ist an der
Mutter eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung mit dem Samen eines
Dritten durchgeführt worden, so wird vermutet, daß der Mann, der dieser
medizinisch unterstützten Fortpflanzung in Form eines gerichtlichen
Protokolls oder eines Notariatsakts zugestimmt hat, der Vater des Kindes
ist, es sei denn, er weist nach, daß das Kind nicht durch diese
medizinisch unterstützte Fortpflanzung gezeugt worden ist.
(4) Ein Dritter,
dessen Samen für eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung verwendet
wird, kann nicht als Vater des mit seinem Samen gezeugten Kindes
festgestellt werden.
§
163a.
(1) Der gesetzliche
Vertreter hat dafür zu sorgen, daß die Vaterschaft festgestellt wird, es
sei denn, daß die Feststellung der Vaterschaft für das Wohl des Kindes
nachteilig ist oder die Mutter von ihrem Recht, den Namen des Vaters nicht
bekanntzugeben, Gebrauch macht.
(2) Der
Jugendwohlfahrtsträger hat die Mutter darauf aufmerksam zu machen, welche
Folgen es hat, wenn die Vaterschaft nicht festgestellt wird.
§
163b. Die Vaterschaft wird durch Urteil oder durch Anerkenntnis
festgestellt. Die Feststellung der Vaterschaft wirkt gegenüber jedermann.
§
163c.
(1) Die Vaterschaft
wird durch persönliche Erklärung in inländischer öffentlicher oder
öffentlich-beglaubigter Urkunde anerkannt. Das Anerkenntnis wirkt ab dem
Zeitpunkt der Erklärung, sofern die Urkunde oder ihre
öffentlich-beglaubigte Abschrift dem Standesbeamten zukommt.
(2) Das
Anerkenntnis soll eine genaue Bezeichnung des Anerkennenden, der Mutter
und des Kindes, sofern es bereits geboren ist, enthalten.23)
(3)
Handlungsunfähige können die Vaterschaft nicht anerkennen. Der beschränkt
handlungsfähige Anerkennende hat sein Anerkenntnis selbst zu erklären; es
bedarf der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Für diese
Einwilligung gilt
Abs. 1 entsprechend.
§
163d.
(1) Die Mutter oder
das Kind können gegen das Anerkenntnis bei Gericht Widerspruch erheben.
Der Widerspruch gegen das Anerkenntnis kann nur innerhalb eines Jahres ab
Kenntnis erhoben werden.
(2) Die beschränkt
handlungsfähige Mutter hat den Widerspruch selbst zu erklären; er bedarf
der Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters. Der Widerspruch des
gesetzlichen Vertreters des bereits mündigen Kindes bedarf dessen
Zustimmung.
§
163e. 24)
(1) Steht zum
Zeitpunkt der Anerkennung bereits die Vaterschaft eines anderen Mannes
fest, so wird das Anerkenntnis erst rechtswirksam, sobald mit allgemein
verbindlicher Wirkung festgestellt ist, dass der andere Mann nicht der
Vater des betreffenden Kindes ist.
(2) Ein zu einem
Zeitpunkt, zu dem die Vaterschaft eines anderen Mannes feststand,
abgegebenes Vaterschaftsanerkenntnis wird jedoch rechtswirksam, wenn die
Mutter den Anerkennenden als Vater bezeichnet und das Kind dem
Anerkenntnis zustimmt. Das Anerkenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt seiner
Erklärung, sofern die Urkunde oder ihre öffentlich-beglaubigte Abschrift
sowie die Urkunden über die Bezeichnung des Anerkennenden als Vater und
die Zustimmung zum Anerkenntnis dem Standesbeamten zukommen.
(3) Der Mann, der
als Vater feststand, kann gegen das Anerkenntnis bei Gericht Widerspruch
erheben.
§ 163d
gilt sinngemäß.
(4) Für
minderjährige Kinder hat der Jugendwohlfahrtsträger die Zustimmung als
gesetzlicher Vertreter zu erklären; er hat hiebei soweit wie möglich den
Willen des Minderjährigen zu berücksichtigen.
§
164. Das Gericht hat die Rechtsunwirksamkeit des Anerkenntnisses
im Verfahren außer Streitsachen festzustellen, wenn gegen das Anerkenntnis
Widerspruch erhoben wurde25)
, das Anerkenntnis den Formvorschriften nicht entspricht, zu unbestimmt
ist, ein Geschäftsunfähiger die Vaterschaft anerkannt hat oder ein
beschränkt Geschäftsfähiger die Vaterschaft ohne Zustimmung seines
gesetzlichen Vertreters anerkannt hat, es sei denn, diese Zustimmung ist
nachträglich erklärt worden oder der Anerkennende hat nach Erlangung der
Eigenberechtigung das Anerkenntnis gebilligt.
§
164a. Die in den
§§ 163c
bis 164 angeführten Einwilligungen und Vertretungshandlungen des
gesetzlichen Vertreters bedürfen keiner gerichtlichen Genehmigung.
§
164b. Die Rechtsunwirksamkeit des Anerkenntnisses ist auf Klage
des Anerkennenden gegen das Kind festzustellen, wenn der Anerkennende
beweist, daß sein Anerkenntnis durch List, ungerechte und gegründete
Furcht oder Irrtum darüber veranlaßt worden ist, daß er der Mutter
innerhalb der gesetzlichen Empfängniszeit beigewohnt hat, oder daß solche
Umstände vorliegen, die die Vermutung seiner Vaterschaft entkräften und
die er zur Zeit der Anerkennung nicht gekannt hat. Die Klage kann nur
binnen Jahresfrist nach Entdeckung der Täuschung, des Irrtums oder der
genannten Umstände oder nach Wegfall der Zwangslage erhoben werden.
§
164c. Das Recht zur Klage auf Feststellung der Vaterschaft steht
zu
1. dem unehelichen
Kinde gegen den mutmaßlichen Vater;
2. dem Mann, dessen
Anerkenntnis wegen eines Widerspruchs unwirksam geworden ist, gegen das
Kind;
3. dem Staatsanwalt
im öffentlichen Interesse oder im Interesse des Kindes oder seiner
Nachkommenschaft, wenn zwar bereits ein Anerkenntnis vorliegt, aber
begründete Bedenken gegen die Vaterschaft des Anerkennenden bestehen,
gegen den mutmaßlichen Vater;
mit dem Eintritt der Rechtskraft des Urteiles, mit dem die Vaterschaft
festgestellt wird, wird das Anerkenntnis rechtsunwirksam.
§
164d. Die in den
§§ 163c
bis 164c angeführten Rechtshandlungen können auch von den
Rechtsnachfolgern der genannten Personen oder gegen diese gesetzt werden.
Rechtsverhältnisse
zwischen Eltern und unehelichen Kindern
§
165. Das uneheliche Kind erhält den Familiennamen der Mutter.
§
165a. aufgehoben
§
165b. aufgehoben
§
165c. aufgehoben
§
166. Mit der Obsorge für das uneheliche Kind ist die Mutter allein
betraut.26) Im
übrigen gelten, soweit nicht anderes bestimmt ist, die das eheliche Kind
betreffenden Bestimmungen über den Unterhalt und die Obsorge auch für das
uneheliche Kind.
§
166a. aufgehoben
§
167. 27)
(1) Leben die
Eltern des Kindes in häuslicher Gemeinschaft, so können sie vereinbaren,
dass in Hinkunft beide Elternteile mit der Obsorge betraut sind. Das
Gericht hat die Vereinbarung zu genehmigen, wenn sie dem Wohl des Kindes
entspricht. Hebt ein Elternteil die häusliche Gemeinschaft nicht bloß
vorübergehend auf, so sind die
§§ 177
und
177a entsprechend anzuwenden.
(2) Leben die
Eltern nicht in häuslicher Gemeinschaft, so können sie vereinbaren, dass
in Hinkunft auch der Vater ganz oder in bestimmten Angelegenheiten mit der
Obsorge betraut ist, wenn sie dem Gericht eine Vereinbarung darüber
vorlegen, bei welchem Elternteil sich das Kind hauptsächlich aufhalten
soll. Soll sich das Kind hauptsächlich im Haushalt des Vaters aufhalten,
so muss auch dieser immer mit der gesamten Obsorge betraut sein. Das
Gericht hat die Vereinbarung zu genehmigen, wenn sie dem Wohl des Kindes
entspricht.
§
177a Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.
§
168.
(1) Der Vater ist
verpflichtet, der Mutter die Kosten der Entbindung sowie die Kosten ihres
Unterhaltes für die ersten sechs Wochen nach der Entbindung und, falls
infolge der Entbindung weitere Auslagen notwendig werden, auch diese zu
ersetzen.
(2) Die Forderung
ist mit Ablauf von drei Jahren nach der Entbindung verjährt.
§
169. aufgehoben
§
170. aufgehoben
§
171. aufgehoben
Erlöschen der Obsorge
§
172.
(1) Die Obsorge für
das Kind erlischt mit dem Eintritt seiner Volljährigkeit.
(2) Der gesetzliche
Vertreter hat dem volljährig gewordenen Kind dessen Vermögen sowie
sämtliche dessen Person betreffenden Urkunden und Nachweise zu übergeben.28)
§
173. samt Überschrift
aufgehoben29)
§
174. aufgehoben30)
§
175. 31) Ein
verheiratetes minderjähriges Kind steht hinsichtlich seiner persönlichen
Verhältnisse einem Volljährigen gleich, solange die Ehe dauert.
Entziehung oder
Einschränkung der Obsorge
§
176. 32)
(1) Gefährden die
Eltern durch ihr Verhalten das Wohl des minderjährigen Kindes, so hat das
Gericht, von wem immer es angerufen wird, die zur Sicherung des Wohles des
Kindes nötigen Verfügungen zu treffen. Besonders darf das Gericht die
Obsorge für das Kind ganz oder teilweise, auch gesetzlich vorgesehene
Einwilligungs- und Zustimmungsrechte, entziehen. Im Einzelfall kann das
Gericht auch eine gesetzlich erforderliche Einwilligung oder Zustimmung
ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen.
(2) Solche
Verfügungen können von einem Elternteil, etwa wenn die Eltern in einer
wichtigen Angelegenheit des Kindes kein Einvernehmen erzielen, den
sonstigen Verwandten in gerader aufsteigender Linie, den Pflegeeltern
(einem Pflegeelternteil), dem Jugendwohlfahrtsträger und dem mündigen
Minderjährigen, von diesem jedoch nur in Angelegenheiten seiner Pflege und
Erziehung, beantragt werden. Andere Personen können solche Verfügungen
anregen.
(3) Die gänzliche
oder teilweise Entziehung der Pflege und Erziehung oder der Verwaltung des
Vermögens des Kindes schließt die Entziehung der gesetzlichen Vertretung
in dem jeweiligen Bereich mit ein; die gesetzliche Vertretung in diesen
Bereichen kann für sich allein entzogen werden, wenn die Eltern oder der
betreffende Elternteil ihre übrigen Pflichten erfüllen.
(4) Fordert das
Gesetz die Einwilligung oder Zustimmung der mit Pflege und Erziehung
betrauten Personen (Erziehungsberechtigten), so ist die Erklärung der mit
der gesetzlichen Vertretung in diesem Bereich betrauten Person notwendig,
aber auch hinreichend, sofern nicht Abweichendes bestimmt ist.
§
176a. aufgehoben33)
§
176b. 34)
Durch eine Verfügung nach
§ 176
darf das Gericht die Obsorge nur so weit beschränken, als dies zur
Sicherung des Wohles des Kindes nötig ist.
§
177. 35)
(1) Wird die Ehe
der Eltern eines minderjährigen ehelichen Kindes geschieden, aufgehoben
oder für nichtig erklärt, so bleibt die Obsorge beider Eltern aufrecht.
Sie können jedoch dem Gericht – auch in Abänderung einer bestehenden
Regelung – eine Vereinbarung über die Betrauung mit der Obsorge vorlegen,
wobei die Betrauung eines Elternteils allein oder beider Eltern vereinbart
werden kann. Im Fall der Obsorge beider Eltern kann diejenige eines
Elternteils auf bestimmte Angelegenheiten beschränkt sein.
(2) In jedem Fall
einer Obsorge beider Eltern haben sie dem Gericht eine Vereinbarung
darüber vorzulegen, bei welchem Elternteil sich das Kind hauptsächlich
aufhalten soll. Dieser Elternteil muss immer mit der gesamten Obsorge
betraut sein.
(3) Das Gericht hat
die Vereinbarung der Eltern zu genehmigen, wenn sie dem Wohl des Kindes
entspricht.
§
177a. 36)
(1) Kommt innerhalb
angemessener Frist nach Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe
der Eltern eine Vereinbarung nach
§ 177
über den hauptsächlichen Aufenthalt des Kindes oder über die Betrauung mit
der Obsorge nicht zustande oder entspricht sie nicht dem Wohl des Kindes,
so hat das Gericht, wenn es nicht gelingt eine gütliche Einigung
herbeizuführen, zu entscheiden, welcher Elternteil künftig allein mit der
Obsorge betraut ist.
(2) Sind beide
Eltern gemäß
§ 177
nach Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung ihrer Ehe mit der Obsorge
betraut und beantragt ein Elternteil die Aufhebung dieser Obsorge, so hat
das Gericht, wenn es nicht gelingt eine gütliche Einigung herbeizuführen,
nach Maßgabe des Kindeswohles einen Elternteil allein mit der Obsorge zu
betrauen.
§
177b. Die vorstehenden Bestimmungen sind auch anzuwenden, wenn die
Eltern eines minderjährigen ehelichen Kindes nicht bloß vorübergehend
getrennt leben. Doch entscheidet das Gericht in einem solchen Fall über
die Obsorge nur auf Antrag eines Elternteils.37)
Informations- und
Äußerungsrechte
§
178. 38)
(1) Soweit ein
Elternteil nicht mit der Obsorge betraut ist, hat er, außer dem Recht auf
persönlichen Verkehr, das Recht, von demjenigen, der mit der Obsorge
betraut ist, von wichtigen Angelegenheiten, insbesondere von
beabsichtigten Maßnahmen nach
§
154 Abs. 2 und
3,
rechtzeitig verständigt zu werden und sich hiezu in angemessener Frist zu
äußern. Findet trotz Bereitschaft des nicht mit der Obsorge betrauten
Elternteils ein persönlicher Verkehr mit dem Kind nicht regelmäßig statt,
so stehen diese Rechte auch in minderwichtigen Angelegenheiten zu, sofern
es sich dabei nicht bloß um Angelegenheiten des täglichen Lebens handelt.
Die Äußerung ist zu berücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte Wunsch
dem Wohl des Kindes besser entspricht.
(2) Kommt der mit
der Obsorge betraute Elternteil seinen Pflichten nach
Abs. 1 beharrlich nicht nach, so hat das Gericht auf Antrag, sofern
das Wohl des Kindes gefährdet scheint, auch von Amts wegen angemessene
Verfügungen zu treffen.
(3) Würde die
Wahrnehmung der Rechte nach
Abs. 1 das Wohl des Kindes ernstlich gefährden oder nimmt sie der mit
der Obsorge nicht betraute Elternteil in rechtsmissbräuchlicher oder für
den anderen in unzumutbarer Weise in Anspruch, so hat das Gericht diese
Rechte auf Antrag einzuschränken oder ganz zu entziehen. Die Rechte nach
Abs. 1 entfallen, wenn der mit der Obsorge nicht betraute Elternteil
grundlos das Recht des Kindes auf persönlichen Verkehr ablehnt.
Berücksichtigung des
Kindeswohls
§
178a. Bei Beurteilung des Kindeswohls sind die Persönlichkeit des
Kindes und seine Bedürfnisse, besonders seine Anlagen, Fähigkeiten,
Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten, sowie die Lebensverhältnisse der
Eltern entsprechend zu berücksichtigen.
§
178b. samt Überschrift
aufgehoben39)
Dem
Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Kindern ähnliche Verbindungen:
1. Annahme an
Kindesstatt
§
179.
(1)
Eigenberechtigte Personen, die den ehelosen Stand nicht feierlich angelobt
haben, können an Kindesstatt annehmen. Durch die Annahme an Kindesstatt
wird die Wahlkindschaft begründet.
(2) Die Annahme
eines Wahlkindes durch mehr als eine Person, sei es gleichzeitig, sei es,
solange die Wahlkindschaft besteht, nacheinander, ist nur zulässig, wenn
die Annehmenden miteinander verheiratet sind. Ehegatten dürfen in der
Regel nur gemeinsam annehmen. Ausnahmen sind zulässig, wenn das leibliche
Kind des anderen Ehegatten angenommen werden soll, wenn ein Ehegatte nicht
annehmen kann, weil er die gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich der
Eigenberechtigung oder des Alters nicht erfüllt, wenn sein Aufenthalt seit
mindestens einem Jahr unbekannt ist, wenn die Ehegatten seit mindestens
drei Jahren die eheliche Gemeinschaft aufgegeben haben oder wenn ähnliche
und besonders gewichtige Gründe die Annahme durch nur einen der Ehegatten
rechtfertigen.
(3) Personen, denen
die Sorge für das Vermögen des anzunehmenden Wahlkindes durch behördliche
Verfügung anvertraut ist, können dieses so lange nicht annehmen, als sie
nicht von dieser Pflicht entbunden sind. Sie müssen vorher Rechnung gelegt
und die Bewahrung des anvertrauten Vermögens nachgewiesen haben.
Form; Eintritt der
Wirksamkeit
§
179a.
(1) Die Annahme an
Kindesstatt kommt durch schriftlichen Vertrag zwischen dem Annehmenden und
dem Wahlkind und durch gerichtliche Bewilligung auf Antrag eines
Vertragsteiles zustande. Sie wird im Fall ihrer Bewilligung mit dem
Zeitpunkt der vertraglichen Willenseinigung wirksam. Stirbt der Annehmende
nach diesem Zeitpunkt, so hindert dies die Bewilligung nicht.
(2) Das nicht
eigenberechtigte Wahlkind schließt den Vertrag durch seinen gesetzlichen
Vertreter, dieser bedarf hiezu keiner gerichtlichen Genehmigung.
Verweigert der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung, so hat das
Gericht sie auf Antrag des Annehmenden oder des Wahlkindes zu ersetzen,
wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen.
Alter
§
180.
(1) Der Wahlvater
muß das dreißigste, die Wahlmutter das achtundzwanzigste Lebensjahr
vollendet haben. Nehmen Ehegatten gemeinsam an oder ist das Wahlkind ein
leibliches Kind des Ehegatten des Annehmenden, so ist eine Unterschreitung
dieser Altersgrenze zulässig, wenn zwischen dem Annehmenden und dem
Wahlkind bereits eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und
Kindern entsprechende Beziehung besteht.
(2) Wahlvater und
Wahlmutter müssen mindestens achtzehn Jahre älter als das Wahlkind sein;
eine geringfügige Unterschreitung dieses Zeitraumes ist unbeachtlich, wenn
zwischen dem Annehmenden und dem Wahlkind bereits eine dem Verhältnis
zwischen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung besteht.
Ist das Wahlkind ein leibliches Kind des Ehegatten des Annehmenden oder
mit dem Annehmenden verwandt, so genügt ein Altersunterschied von sechzehn
Jahren.
Bewilligung
§
180a.
(1) Die Annahme ist
zu bewilligen, wenn eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und
Kindern entsprechende Beziehung besteht oder hergestellt werden soll. Sie
muß dem Wohle des nicht eigenberechtigten Wahlkindes dienen. Ist das
Wahlkind eigenberechtigt, so muß ein gerechtfertigtes Anliegen des
Annehmenden oder des Wahlkindes vorliegen.
(2) Die Bewilligung
ist, außer bei Fehlen der Voraussetzungen des
Abs. 1, zu versagen, wenn ein überwiegendes Anliegen eines leiblichen
Kindes des Annehmenden entgegensteht, insbesondere dessen Unterhalt oder
Erziehung gefährdet wäre; im übrigen sind wirtschaftliche Belange nicht zu
beachten, außer der Annehmende handelt in der ausschließlichen oder
überwiegenden Absicht, ein leibliches Kind zu schädigen.
§
181.
(1) Die Bewilligung
darf nur erteilt werden, wenn folgende Personen der Annahme zustimmen:
1. die Eltern des
minderjährigen Wahlkindes;
2. der Ehegatte des
Annehmenden;
3. der Ehegatte des
Wahlkindes.
(2) Das
Zustimmungsrecht einer im
Abs. 1 genannten Person entfällt, wenn sie als gesetzlicher Vertreter
des Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat; ferner, wenn sie zu
einer verständigen Äußerung nicht nur vorübergehend unfähig oder ihr
Aufenthalt seit mindestens sechs Monaten unbekannt ist.
(3) Das Gericht hat
die verweigerte Zustimmung auf Antrag eines Vertragsteiles zu ersetzen,
wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen.
§
181a.
(1) Ein Recht auf
Anhörung haben:
1. das nicht
eigenberechtigte Wahlkind ab dem vollendeten fünften Lebensjahr, außer es
hat bereits seit diesem Zeitpunkt beim Annehmenden gelebt;
2. die Eltern des
volljährigen Wahlkindes;
3. die Pflegeeltern
oder der Leiter des Heimes, in dem sich das Wahlkind befindet;
4. der
Jugendwohlfahrtsträger.
(2) Das
Anhörungsrecht eines im
Abs. 1 genannten Berechtigten entfällt, wenn er als gesetzlicher
Vertreter des Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat; ferner, wenn
er nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten gehört werden
könnte.
Wirkungen
§
182.
(1) Zwischen dem
Annehmenden und dessen Nachkommen einerseits und dem Wahlkind und dessen
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen
andererseits entstehen mit diesem Zeitpunkt die gleichen Rechte, wie sie
durch die eheliche Abstammung begründet werden.
(2) Wird das
Wahlkind durch Ehegatten als Wahleltern angenommen, so erlöschen mit den
im §
182a bestimmten Ausnahmen die nicht bloß in der Verwandtschaft an sich
(§ 40)
bestehenden familienrechtlichen Beziehungen zwischen den leiblichen Eltern
und deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits mit
diesem Zeitpunkt. Wird das Wahlkind nur durch einen Wahlvater (eine
Wahlmutter) angenommen, so erlöschen diese Beziehungen lediglich
hinsichtlich des leiblichen Vaters (der leiblichen Mutter) und dessen
(deren) Verwandten; insoweit danach diese Beziehungen aufrecht bleiben
würden, hat das Gericht, wenn der in Frage kommende Elternteil darin
eingewilligt hat, das Erlöschen diesem Elternteil gegenüber auszusprechen;
das Erlöschen wirkt vom Zeitpunkt der Abgabe der Einwilligungserklärung,
frühestens jedoch vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme.
§
182a.
(1) Die im
Familienrecht begründeten Pflichten der leiblichen Eltern und deren
Verwandten zur Leistung des Unterhaltes, des Heiratsgutes und der
Ausstattung gegenüber dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen bleiben aufrecht.
(2) Das gleiche
gilt für die Unterhaltspflicht des Wahlkindes gegenüber den leiblichen
Eltern, sofern diese ihre Unterhaltspflicht gegenüber dem noch nicht
vierzehn Jahre alten Kinde vor dessen Annahme an Kindesstatt nicht
gröblich vernachlässigt haben.
(3) Die nach den
Abs. 1 und
2
aufrecht bleibenden Pflichten stehen jedoch den durch die Annahme
begründeten gleichen Pflichten im Range nach.
§
182b.
(1) Die im Erbrecht
begründeten Rechte zwischen den leiblichen Eltern und deren Verwandten
einerseits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits bleiben aufrecht.
(2) Bei der
gesetzlichen Erbfolge in das Vermögen des Wahlkindes in der zweiten Linie
gehen die Wahleltern und deren Nachkommen einerseits den leiblichen Eltern
und deren Nachkommen andererseits vor; ist das Wahlkind nur durch einen
Wahlvater (eine Wahlmutter) angenommen worden und sind sowohl der
Wahlvater (die Wahlmutter) oder dessen (deren) Nachkommen als auch die
leibliche Mutter (der eheliche Vater) oder deren (dessen) Nachkommen
vorhanden, so fällt der Nachlaß je zur Hälfte auf den Stamm des Wahlvaters
(der Wahlmutter) und den der leiblichen Mutter (des ehelichen Vaters).
§
183.
(1) Wird das
Wahlkind nur von einer Person an Kindesstatt angenommen und erlöschen die
familienrechtlichen Beziehungen zum anderen Elternteil im Sinn des
§
182 Abs. 2 zweiter Satz, so erhält das Wahlkind den Familiennamen des
Annehmenden. Die
§§ 162a Abs. 2 bis 162d gelten entsprechend.
(2) Im übrigen
gelten für die Ableitung des Familiennamens des Wahlkindes von den
Wahleltern beziehungsweise von einem Wahlelternteil und demjenigen
Elternteil, zu dem die familienrechtlichen Beziehungen aufrecht geblieben
sind, die
§§ 139
sowie
162a Abs. 2 bis 162d entsprechend.
§
183a. aufgehoben
Widerruf und
Aufhebung
§
184.
(1) Die
gerichtliche Bewilligung ist vom Gericht mit rückwirkender Kraft zu
widerrufen:
1. von Amts wegen
oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn beim Abschluß des
Annahmevertrages der Annehmende nicht eigenberechtigt gewesen ist, außer
er hat nach der Erlangung seiner Eigenberechtigung zu erkennen gegeben,
daß er die Wahlkindschaft fortsetzen wolle;
2. von Amts wegen
oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn ein nicht eigenberechtigtes
Wahlkind selbst den Annahmevertrag geschlossen hat, außer es hat der
gesetzliche Vertreter oder nach Erlangung der Eigenberechtigung das
Wahlkind nachträglich zugestimmt oder das Gericht die verweigerte
nachträgliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters im Sinne des
§
179a Abs. 2 ersetzt;
3. von Amts wegen
oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn das Wahlkind durch mehr als
eine Person angenommen worden ist, außer die Annehmenden sind im Zeitpunkt
der Bewilligung miteinander verheiratet gewesen;
4. von Amts wegen
oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn der Annahmevertrag
ausschließlich oder vorwiegend in der Absicht geschlossen worden ist, dem
Wahlkind die Führung des Familiennamens des Wahlvaters oder der Wahlmutter
zu ermöglichen oder den äußeren Schein einer Wahlkindschaft zur Verdeckung
rechtswidriger geschlechtlicher Beziehungen zu schaffen;
5. auf Antrag eines
Vertragsteiles, wenn der Annahmevertrag nicht schriftlich geschlossen
worden ist und seit dem Eintritt der Rechtskraft des
Bewilligungsbeschlusses nicht mehr als fünf Jahre verstrichen sind.
(2) Hat einer der
Vertragsteile den Widerrufsgrund (Abs.
1 Z. 1 bis 3 und
5) bei Abschließung des Annahmevertrages nicht gekannt, so gilt in
seinem Verhältnis zum anderen Vertragsteil der Widerruf insoweit als
Aufhebung (§
184a), als er dies beansprucht.
(3) Einem Dritten,
der im Vertrauen auf die Gültigkeit der Annahme an Kindesstatt vor dem
Widerruf Rechte erworben hat, kann nicht eingewendet werden, daß die
Bewilligung widerrufen worden ist. Zum Nachteil eines der Vertragsteile,
der den Widerrufsgrund bei Abschließung des Annahmevertrages nicht gekannt
hat, kann ein Dritter nicht die Wirkungen des Widerrufes beanspruchen.
§
184a.
(1) Die
Wahlkindschaft ist vom Gericht aufzuheben:
1. wenn die
Erklärung eines Vertragsteiles oder eines Zustimmungsberechtigten durch
List oder ungerechte und gegründete Furcht veranlaßt worden ist und der
Betroffene die Aufhebung binnen Jahresfrist nach Entdeckung der Täuschung
oder Wegfall der Zwangslage beantragt;
2. von Amts wegen,
wenn die Aufrechterhaltung der Wahlkindschaft das Wohl des nicht
eigenberechtigten Wahlkindes ernstlich gefährden würde;
3. auf Antrag des
Wahlkindes, wenn die Aufhebung nach Auflösung oder Nichtigerklärung der
Ehe der Wahleltern oder nach dem Tode des Wahlvaters (der Wahlmutter) dem
Wohle des Wahlkindes dient und nicht einem gerechtfertigten Anliegen des
(der) von der Aufhebung betroffenen, wenn auch bereits verstorbenen
Wahlvaters (Wahlmutter) widerspricht;
4. wenn der
Wahlvater (die Wahlmutter) und das eigenberechtigte Wahlkind die Aufhebung
beantragen.
(2) Besteht die
Wahlkindschaft gegenüber einem Wahlvater und einer Wahlmutter, so darf die
Aufhebung im Sinne des
Abs. 1 nur beiden gegenüber bewilligt werden; die Aufhebung gegenüber
einem von ihnen allein ist nur im Falle der Auflösung oder
Nichtigerklärung ihrer Ehe zulässig.
§
185.
(1) Mit dem
Eintritt der Rechtskraft des Aufhebungsbeschlusses erlöschen die durch die
Annahme zwischen dem Wahlvater (der Wahlmutter) und dessen (deren)
Nachkommen einerseits und dem Wahlkind und dessen Nachkommen andererseits
begründeten Rechtsbeziehungen.
(2) Mit diesem
Zeitpunkt leben die familienrechtlichen Beziehungen zwischen den
leiblichen Eltern und deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und
dessen Nachkommen andererseits, soweit sie nach dem
§ 182
erloschen sind, wieder auf.
(3) Mit dem im
Abs. 1 genannten Zeitpunkt sind hinsichtlich des Wahlkindes und dessen
minderjährigen Nachkommen die namensrechtlichen Wirkungen der Annahme so
anzusehen, als wären sie nicht eingetreten.
§
185a. Ein Widerruf oder eine Aufhebung aus anderen als den in den
§§ 184
und
184a angeführten Gründen ist unzulässig; ebenso eine vertragliche
Einigung oder ein Rechtsstreit über die Anfechtung des Annahmevertrages.
2. Pflegeeltern
§
186. 40)
Pflegeeltern sind Personen, die die Pflege und Erziehung des Kindes ganz
oder teilweise besorgen und zu denen eine dem Verhältnis zwischen
leiblichen Eltern und Kindern nahe kommende Beziehung besteht oder
hergestellt werden soll. Sie haben das Recht, in den die Person des Kindes
betreffenden Verfahren Anträge zu stellen.
§
186a.
(1)
41) Das Gericht hat
einem Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) auf seinen Antrag die Obsorge
für das Kind ganz oder teilweise zu übertragen, wenn das Pflegeverhältnis
nicht nur für kurze Zeit beabsichtigt ist und die Übertragung dem Wohl des
Kindes entspricht. Die Regelungen über die Obsorge gelten dann für dieses
Pflegeelternpaar (diesen Pflegeelternteil).
(2)
42) Sind die Eltern
oder Großeltern mit der Obsorge betraut und stimmen sie der Übertragung
nicht zu, so darf diese nur verfügt werden, wenn ohne sie das Wohl des
Kindes gefährdet wäre.
(3) Die Übertragung
ist aufzuheben, wenn dies dem Wohl des Kindes entspricht. Gleichzeitig hat
das Gericht unter Beachtung des Wohles des Kindes auszusprechen, auf wen
die Obsorge übergeht.
(4) Das Gericht hat
vor seiner Entscheidung die Eltern, den gesetzlichen Vertreter, weitere
Erziehungsberechtigte, den Jugendwohlfahrtsträger und jedenfalls das
bereits zehnjährige Kind zu hören.
§
181a Abs. 2 gilt sinngemäß.
Viertes Hauptstück
Von der Obsorge einer anderen Person, der Sachwalterschaft und der Kuratel
I.
Von der Obsorge einer anderen Person
§
187. 43)
Soweit nach dem
dritten Hauptstück weder Eltern noch Großeltern oder Pflegeeltern mit
der Obsorge betraut sind oder betraut werden können und kein Fall des
§ 211
vorliegt, hat das Gericht unter Beachtung des Wohles des Kindes eine
andere geeignete Person mit der Obsorge zu betrauen.
§
188. 44)
(1) Bei der Auswahl
einer anderen Person für die Obsorge ist besonders auf das Wohl des Kindes
Bedacht zu nehmen. Wünsche des Kindes und der Eltern, im Falle des
§ 145c
des Zuwendenden, sind zu berücksichtigen, sofern sie dem Wohl des Kindes
entsprechen.
(2) Mit der Obsorge
dürfen nicht betraut werden
1. nicht voll
handlungsfähige Personen;
2. Personen, von
denen, besonders auch wegen der durch eine strafgerichtliche Verurteilung
zutage getretenen Veranlagung oder Eigenschaft, eine dem Wohl des
minderjährigen Kindes förderliche Ausübung der Obsorge nicht zu erwarten
ist.
§
189. 45)
(1) Derjenige, den
das Gericht mit der Obsorge betrauen will, hat alle Umstände, die ihn
dafür ungeeignet erscheinen lassen, dem Gericht mitzuteilen. Unterlässt er
diese Mitteilung schuldhaft, so haftet er für alle dem minderjährigen Kind
daraus entstehenden Nachteile.
(2) Eine besonders
geeignete Person kann die Betrauung mit der Obsorge nur ablehnen, wenn ihr
diese unzumutbar wäre.
§
190. samt Überschrift
aufgehoben46)
§
191. samt Überschrift
aufgehoben47)
§
192. aufgehoben48)
§
193. aufgehoben49)
§
194. samt Überschrift
aufgehoben50)
§
195. samt Überschrift
aufgehoben51)
§
196. samt Überschriften
aufgehoben52)
§
197. aufgehoben
§
198. samt Überschrift
aufgehoben53)
§
199. samt Überschrift
aufgehoben54)
§
200. samt Überschrift
aufgehoben55)
§
201. samt Überschrift
aufgehoben56)
§
202. samt Überschrift
aufgehoben57)
§
203. aufgehoben58)
§
204. samt Überschrift
aufgehoben59)
§
205. samt Überschrift
aufgehoben60)
§
206. samt Überschrift
aufgehoben61)
§
207. samt Überschrift
aufgehoben
§
208. samt Überschrift
aufgehoben
§
209. samt Überschrift
aufgehoben62)
§
210. samt Überschrift
aufgehoben63)
Aufgaben des
Jugendwohlfahrtsträgers
§
211. 64) Wird
ein minderjähriges Kind im Inland gefunden und sind dessen Eltern
unbekannt, so ist kraft Gesetzes der Jugendwohlfahrtsträger mit der
Obsorge betraut. Dies gilt für den Bereich der Vermögensverwaltung und der
Vertretung auch, wenn ein Kind im Inland geboren wird und in diesem
Bereich kein Elternteil mit der Obsorge betraut ist.
§
212.
(1) Der
Jugendwohlfahrtsträger hat, soweit es nach den Umständen geboten scheint,
den gesetzlichen Vertreter eines im Inland geborenen Kindes innerhalb
angemessener Frist nach der Geburt über die elterlichen Rechte und
Pflichten, besonders über den Unterhaltsanspruch des Kindes,
gegebenenfalls auch über die Feststellung der Vaterschaft, in Kenntnis zu
setzen und ihm für die Wahrnehmung der Rechte des Kindes seine Hilfe
anzubieten.
(2)
65) Für die
Festsetzung oder Durchsetzung der Unterhaltsansprüche des Kindes sowie
gegebenenfalls für die Feststellung der Vaterschaft ist der
Jugendwohlfahrtsträger Vertreter des Kindes, wenn die schriftliche
Zustimmung des sonstigen gesetzlichen Vertreters vorliegt.
(3)
66) Für andere
Angelegenheiten ist der Jugendwohlfahrtsträger Vertreter des Kindes, wenn
er sich zur Vertretung bereit erklärt und die schriftliche Zustimmung des
sonstigen gesetzlichen Vertreters vorliegt.
(4) Durch die
Vertretungsbefugnis des Jugendwohlfahrtsträgers wird die
Vertretungsbefugnis des sonstigen gesetzlichen Vertreters nicht
eingeschränkt, jedoch gilt
§ 154a
sinngemäß. Der Jugendwohlfahrtsträger und der sonstige gesetzliche
Vertreter haben einander über ihre Vertretungshandlungen in Kenntnis zu
setzen.
(5)
67) Die
Vertretungsbefugnis des Jugendwohlfahrtsträgers endet, wenn der sonstige
gesetzliche Vertreter seine Zustimmung schriftlich widerruft, der
Jugendwohlfahrtsträger seine Erklärung nach
Abs. 3 zurücknimmt oder das Gericht den Jugendwohlfahrtsträger auf
dessen Antrag als Vertreter enthebt, weil er zur Wahrung der Rechte und
zur Durchsetzung der Ansprüche des Kindes nach Lage des Falles nichts mehr
beizutragen vermag.
§
213. 68) Ist
eine andere Person mit der Obsorge für einen Minderjährigen ganz oder
teilweise zu betrauen und lassen sich dafür Verwandte oder andere nahe
stehende oder sonst besonders geeignete Personen nicht finden, so hat das
Gericht die Obsorge dem Jugendwohlfahrtsträger zu übertragen.
§
214.
(1)
69) Die
§§ 216,
234,
265,
266
und 267
gelten für den Jugendwohlfahrtsträger nicht. Dieser ist vor der Anlegung
des Vermögens eines Minderjährigen nur im Fall des
§ 230e
verpflichtet, die Zustimmung des Gerichtes einzuholen.
(2) Der
Jugendwohlfahrtsträger bedarf zu Klagen auf Feststellung der Vaterschaft
und Leistung des Unterhalts sowie zum Abschluß von Vereinbarungen über die
Höhe gesetzlicher Unterhaltsleistungen nicht der Genehmigung des
Gerichtes. Vereinbarungen über die Leistung des Unterhalts eines
Minderjährigen, die vor dem Jugendwohlfahrtsträger oder von ihm
geschlossen und von ihm beurkundet werden, haben die Wirkung eines
gerichtlichen Vergleiches.
(3) Der
Jugendwohlfahrtsträger hat Personen, die ein Kind pflegen und erziehen
oder gesetzlich vertreten, über seine Vertretungstätigkeit bezüglich
dieses Kindes Auskünfte zu erteilen, soweit das Wohl des Kindes hiedurch
nicht gefährdet wird.
§
215. 70)
(1) Der
Jugendwohlfahrtsträger hat die zur Wahrung des Wohles eines Minderjährigen
erforderlichen gerichtlichen Verfügungen im Bereich der Obsorge zu
beantragen. Bei Gefahr im Verzug kann er die erforderlichen Maßnahmen der
Pflege und Erziehung vorläufig mit Wirksamkeit bis zur gerichtlichen
Entscheidung selbst treffen; er hat diese Entscheidung unverzüglich,
jedenfalls innerhalb von acht Tagen, zu beantragen. Im Umfang der
getroffenen Maßnahmen ist der Jugendwohlfahrtsträger vorläufig mit der
Obsorge betraut.
(2) Eine
einstweilige Verfügung nach
§ 382b EO
und deren Vollzug nach
§ 382d EO
kann der Jugendwohlfahrtsträger als Vertreter des Minderjährigen
beantragen, wenn der sonstige gesetzliche Vertreter einen erforderlichen
Antrag nicht unverzüglich gestellt hat;
§
212 Abs. 4 gilt hiefür entsprechend.
§
215a. 71)
Sofern nicht anderes angeordnet ist, fallen die Aufgaben dem Bundesland
als Jugendwohlfahrtsträger zu, in dem das minderjährige Kind seinen
gewöhnlichen Aufenthalt, mangels eines solchen im Inland seinen Aufenthalt
hat. Fehlt ein Aufenthalt im Inland, so ist, sofern das minderjährige Kind
österreichischer Staatsbürger ist, für im Inland zu besorgende Aufgaben
das Bundesland als Jugendwohlfahrtsträger zuständig, in dem der
Minderjährige seinen letzten Aufenthalt gehabt hat, dann dasjenige, in dem
ein Elternteil seinen Aufenthalt hat oder zuletzt gehabt hat. Wechselt das
minderjährige Kind seinen Aufenthalt in ein anderes Bundesland, so kann
der Jugendwohlfahrtsträger seine Aufgaben dem anderen mit dessen
Zustimmung übertragen. Hievon ist das Gericht zu verständigen, wenn es mit
den Angelegenheiten des minderjährigen Kindes bereits befasst war.
Besondere Pflichten und Rechte anderer mit der Obsorge betrauter Personen
a)
in Angelegenheiten der Pflege und Erziehung
§
216. 72) Ist
eine andere Person mit der Obsorge betraut, so hat sie, soweit nicht
anderes bestimmt ist, in wichtigen, die Person des Kindes betreffenden
Angelegenheiten, insbesondere in den Angelegenheiten des
§
154 Abs. 2, die Genehmigung des Gerichtes einzuholen. Ohne Genehmigung
getroffene Maßnahmen oder Vertretungshandlungen sind unzulässig und
unwirksam, sofern nicht Gefahr im Verzug vorliegt.
§
217. samt Überschrift
aufgehoben73)
§
218. samt Überschrift
aufgehoben
§
219. samt Überschrift
aufgehoben
§
220. samt Überschrift
aufgehoben
§
221. samt Überschrift
aufgehoben
§
222. samt Überschriften
aufgehoben74)
§
223. samt Überschrift
aufgehoben75)
§
224. samt Überschrift
aufgehoben76)
§
225. samt Überschrift
aufgehoben
§
226. samt Überschrift
aufgehoben
§
227. samt Überschrift
aufgehoben
§
228. samt Überschrift
aufgehoben77)
b) in Angelegenheiten
der Vermögensverwaltung
§
229. 78) Die
mit der gesetzlichen Vertretung in Angelegenheiten der Vermögensverwaltung
betraute Person hat bei Antritt der Obsorge nach gründlicher Erforschung
des Vermögensstandes dem Gericht gegenüber das Vermögen im Einzelnen
anzugeben und bei Beendigung der Obsorge Rechnung zu legen. Das Gericht
hat die Tätigkeit des gesetzlichen Vertreters zur Vermeidung einer
Gefährdung des Wohls des minderjährigen Kindes zu überwachen und die dazu
notwendigen Aufträge zu erteilen. Näheres wird in den Verfahrensgesetzen
bestimmt.
Anlegung von
Mündelgeld79)
§
230.
(1) Soweit Geld
eines Minderjährigen nicht, dem Gesetz entsprechend, für besondere Zwecke
zu verwenden ist, ist es unverzüglich sicher und möglichst fruchtbringend
durch Spareinlagen, den Erwerb von Wertpapieren (Forderungen), die
Gewährung von Darlehen, den Erwerb von Liegenschaften oder in anderer
Weise nach den folgenden Bestimmungen anzulegen.
(2) Ist es
wirtschaftlich zweckmäßig, so ist Mündelgeld auf mehrere dieser Arten
anzulegen.
§
230a. Spareinlagen bei einem inländischen Kreditinstitut, das zur
Entgegennahme von Spareinlagen berechtigt ist, sind zur Anlegung von
Mündelgeld geeignet, wenn sie auf den Namen des Mündels lauten,
ausdrücklich die Bezeichnung „Mündelgeld” tragen und entweder allgemein
für die Verbindlichkeiten des Kreditinstitutes der Bund oder eines der
Länder oder für die Verzinsung und Rückzahlung der Mündelgeldspareinlagen
im besonderen ein von dem Kreditinstitut gebildeter, jederzeit mit der
jeweiligen Höhe solcher Einlagen übereinstimmender unbelasteter
Deckungsstock haftet. Dieser Deckungsstock hat ausschließlich in
mündelsicheren Wertpapieren (§
230b), in Hypothekarforderungen mit gesetzgemäßer Sicherheit (§
230c), in Forderungen, für die der Bund oder eines der Länder haftet,
oder in Bargeld zu bestehen.
§
230b. Der Erwerb folgender Wertpapiere und Forderungen ist zur
Anlegung von Mündelgeld geeignet:
1.
Teilschuldverschreibungen von Anleihen, für deren Verzinsung und
Rückzahlung der Bund oder eines der Länder haftet;
2. Forderungen, die
in das Hauptbuch der Staatsschuld eingetragen sind;
3. Pfandbriefe und
Kommunalschuldverschreibungen der nach den gesetzlichen Vorschriften zur
Ausgabe solcher Wertpapiere zugelassenen inländischen Kreditinstitute;
4. von einem
inländischen Kreditinstitut ausgegebene Teilschuldverschreibungen, sofern
das Kreditinstitut verpflichtet ist, die Ansprüche aus diesen
Teilschuldverschreibungen vorzugsweise zu befriedigen und als Sicherheit
für diese Befriedigung Forderungen des Kreditinstitutes, für das der Bund
haftet, Wertpapiere oder Forderungen gemäß den
Z.
1 bis 3 und
5
oder Bargeld zu bestellen, und dies auf den Teilschuldverschreibungen
ausdrücklich ersichtlich gemacht ist;
5. sonstige
Wertpapiere, sofern sie durch besondere gesetzliche Vorschriften zur
Anlegung von Mündelgeld geeignet erklärt worden sind.
§
230c.
(1) Darlehen sind
zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn zu ihrer Sicherstellung an
einer inländischen Liegenschaft eine Hypothek bestellt wird und die
Liegenschaft samt ihrem Zubehör während der Laufzeit des Darlehens
ausreichend feuerversichert ist. Liegenschaften, deren Wert sich wegen
eines darauf befindlichen Abbaubetriebs ständig und beträchtlich
vermindert, sind nicht geeignet.
(2) Es darf jedoch
eine Liegenschaft nicht über die Hälfte des Verkehrswertes belastet
werden.80) Bei
Weingärten, Wäldern und anderen Liegenschaften, deren Ertrag auf ähnlichen
dauernden Anpflanzungen beruht, ist die Belastungsgrenze ohne
Berücksichtigung des Wertes der Kulturgattung vom Grundwert zu errechnen.
Ebenso ist bei industriell oder gewerblich genutzten Liegenschaften vom
bloßen Grundwert auszugehen, doch sind von diesem die Kosten der
Freimachung der Liegenschaft von industriell oder gewerblich genutzten
Baulichkeiten abzuziehen. Die Art (Widmung, Nutzung) der Liegenschaft und
die maßgebende Belastungsgrenze sind durch einen allgemein beeideten
gerichtlichen Sachverständigen festzustellen.
§
230d. 81)
(1) Der Erwerb
inländischer Liegenschaften ist zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn
sich ihr Wert nicht wegen eines darauf befindlichen Abbaubetriebs ständig
und beträchtlich vermindert oder sie nicht ausschließlich oder überwiegend
industriellen oder gewerblichen Zwecken dienen.
(2) Der Kaufpreis
soll in der Regel den Verkehrswert nicht übersteigen.
§
230e.
(1) Die Anlegung
von Mündelgeld in anderer Weise als nach den vorstehenden Bestimmungen hat
das Gericht, im Fall des Erwerbes von Wertpapieren jedenfalls nach
Anhörung eines Sachverständigen für das Börsen- oder Bankwesen, zu
genehmigen, wenn sie nach den Verhältnissen des Einzelfalls den
Grundsätzen einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung entspricht.
(2) Unter diesen
Voraussetzungen kommen für die Anlegung besonders in Betracht
1. Wertpapiere, die
im §
230b nicht genannt sind, sofern dafür vorgesorgt ist, daß die
Verwaltung der Wertpapiere einschließlich eines Verkaufes, falls er durch
die Marktlage geboten sein sollte, sachkundig vorgenommen wird;
2. Liegenschaften,
die nicht geeignet im Sinn des
§ 230d
sind, sofern ihr Erwerb dem Mündel mit Beziehung auf die gegenwärtige oder
künftige Berufsausübung oder sonst zum klaren Vorteil gereichen würde; der
Kaufpreis darf auch hier den gemeinen Wert nicht übersteigen.
§
231. 82) Das
übrige bewegliche Vermögen, das nicht zur Befriedigung der gegenwärtigen
oder zukünftigen Bedürfnisse des minderjährigen Kindes benötigt wird oder
zumindest nicht dazu geeignet scheint, ist bestmöglich zu verwerten. Einer
gerichtlichen Genehmigung bedarf es nur, wenn der Verkehrswert der
einzelnen Sache voraussichtlich 1 000 Euro oder die Summe der Werte der
zur Verwertung bestimmten Sachen voraussichtlich 10 000 Euro übersteigt.
§
232. 83) Ein
unbewegliches Gut darf nur im Notfall oder zum offenbaren Vorteil des
minderjährigen Kindes mit gerichtlicher Genehmigung veräußert werden.
§
233. samt Überschrift
aufgehoben
§
234. 84) Der
gesetzliche Vertreter kann 10 000 Euro übersteigende Zahlungen an das
minderjährige Kind nur entgegennehmen und darüber quittieren, wenn er dazu
vom Gericht im Einzelfall oder allgemein ermächtigt wurde. Fehlt eine
solche Ermächtigung, so wird der Schuldner durch Zahlung an den Vertreter
von seiner Schuld nur befreit, wenn das Gezahlte noch im Vermögen des
minderjährigen Kindes vorhanden ist oder für seine Zwecke verwendet wurde.
§
235. samt Überschrift
aufgehoben
§
236. samt Überschrift
aufgehoben85)
§
237. samt Überschrift
aufgehoben86)
§
238. samt Überschrift
aufgehoben87)
§
239. samt Überschrift
aufgehoben
§
240. samt Überschrift
aufgehoben
§
241. samt Überschrift
aufgehoben
§
242. samt Überschrift
aufgehoben
§
243. samt Überschrift
aufgehoben
§
244. samt Überschrift
aufgehoben
§245. samt Überschrift
aufgehoben88)
§
246. samt Überschrift
aufgehoben
§
247. samt Überschrift
aufgehoben
§
248. samt Überschrift
aufgehoben
§
249. samt Überschriften
aufgehoben89)
Änderungen in der
Obsorge
§
250. 90) Die
Obsorge des Jugendwohlfahrtsträgers (§
211) endet, sofern der Umstand, der die Eltern von der Ausübung der
Obsorge ausgeschlossen hat, weggefallen ist; im ersten Fall des
§ 211
bedarf es hiezu jedoch der Übertragung der Obsorge an die Eltern durch das
Gericht.
§
251. samt Überschrift
aufgehoben91)
§
252. samt Überschrift
aufgehoben
§
253. 92) Das
Gericht hat die Obsorge an eine andere Person zu übertragen, wenn das Wohl
des minderjährigen Kindes dies erfordert, insbesondere wenn die mit der
Obsorge betraute Person ihre Verpflichtungen aus
§ 145b
nicht erfüllt, einer der Umstände des
§
188 Abs. 2 eintritt oder bekannt wird oder die Person, die bisher mit
der Obsorge betraut war, stirbt.
§
254. aufgehoben93)
§
255. aufgehoben94)
§
256. aufgehoben95)
§
257. aufgehoben96)
§
258. aufgehoben97)
§
259. samt Überschrift
aufgehoben
§
260. aufgehoben
§
261. samt Überschriften
aufgehoben98)
§
262. samt Überschrift
aufgehoben99)
§
263. samt Überschrift
aufgehoben100)
Haftung
§
264. 101)
(1) Die nach
§ 187
mit der Obsorge betrauten Personen haften dem Kind gegenüber für jeden
durch ihr Verschulden verursachten Schaden.
(2) Soweit sich die
mit der Obsorge betraute Person zu ihrer Ausübung rechtmäßig anderer
Personen bedient, haftet sie nur insoweit, als sie schuldhaft eine
untüchtige oder gefährliche Person ausgewählt, deren Tätigkeit nur
unzureichend überwacht oder die Geltendmachung von Ersatzansprüchen des
minderjährigen Kindes gegen diese Personen schuldhaft unterlassen hat.
§
265. 102)
Der Richter kann die Ersatzpflicht nach
§ 264
insoweit mäßigen oder ganz erlassen, als sie die mit der Obsorge betraute
Person unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere des Grades des
Verschuldens oder eines besonderen Naheverhältnisses zwischen dem
minderjährigen Kind und der mit der Obsorge betrauten Person, unbillig
hart träfe.
Entschädigung
§
266. 103)
(1) Der nach
§ 187
mit der Obsorge betrauten Person gebührt unter Bedachtnahme auf Art und
Umfang ihrer Tätigkeit und des damit gewöhnlich verbundenen Aufwands an
Zeit und Mühe eine jährliche Entschädigung, soweit dadurch die
Befriedigung der Lebensbedürfnisse des Kindes nicht gefährdet wird.
(2) Sofern das
Gericht nicht aus besonderen Gründen eine geringere Entschädigung für
angemessen findet, beträgt sie fünf vom Hundert sämtlicher Einkünfte nach
Abzug der hievon zu entrichtenden gesetzlichen Steuern und Abgaben.
Bezüge, die kraft besonderer gesetzlicher Anordnung zur Deckung bestimmter
Aufwendungen dienen, sind nicht als Einkünfte zu berücksichtigen.
Übersteigt der Wert des Vermögens des minderjährigen Kindes 10 000 Euro,
so kann das Gericht überdies pro Jahr bis zu zwei vom Hundert des
Mehrbetrags als Entschädigung gewähren, soweit sich die mit der Obsorge
betraute Person um die Erhaltung des Vermögens oder dessen Verwendung zur
Deckung von Bedürfnissen des Kindes besonders verdient gemacht hat.
Betrifft die Obsorge nur einen Teilbereich der Obsorge oder dauert die
Tätigkeit der mit der Obsorge betrauten Person nicht ein volles Jahr, so
vermindert sich der Anspruch auf Entschädigung entsprechend.
(3) Bei besonders
umfangreichen und erfolgreichen Bemühungen der mit der Obsorge betrauten
Person kann das Gericht die Entschädigung auch höher als nach
Abs. 2 erster Satz bemessen, jedoch nicht höher als zehn vom Hundert
der Einküfte.
Entgelt und
Aufwandsersatz
§
267. 104)
(1) Nützt die mit
der Obsorge betraute Person für Angelegenheiten, deren Besorgung sonst
einem Dritten übertragen werden müsste, ihre besonderen beruflichen
Kenntnisse und Fähigkeiten, so hat sie hiefür einen Anspruch auf
angemessenes Entgelt. Dieser Anspruch besteht für die Kosten einer
rechtsfreundlichen Vertretung jedoch nicht, soweit beim minderjährigen
Kind die Voraussetzungen für die Bewilligung der Verfahrenshilfe gegeben
sind oder diese Kosten nach gesetzlichen Vorschriften vom Gegner ersetzt
werden.
(2) Zur
zweckentsprechenden Ausübung der Obsorge notwendige Barauslagen,
tatsächliche Aufwendungen und die Kosten der Versicherung der Haftpflicht
nach §
264 sind der mit der Obsorge betrauten Person vom minderjährigen Kind
jedenfalls zu erstatten, soweit sie nach gesetzlichen Vorschriften nicht
unmittelbar von Dritten getragen werden.
(3) Ansprüche nach
den
Abs. 1 und
2
bestehen insoweit nicht, als durch sie die Befriedigung der
Lebensbedürfnisse des Kindes gefährdet wäre.
§
268. samt Überschrift
aufgehoben
II.
Von der Kuratel und der Sachwalterschaft
§
269. aufgehoben105)
§
270. samt Überschrift
aufgehoben106)
a) im Kollisionsfall
§
271. 107)
(1) Widerstreiten
einander in einer bestimmten Angelegenheit die Interessen einer
minderjährigen oder sonst nicht voll handlungsfähigen Person und jene
ihres gesetzlichen Vertreters, so hat das Gericht der Person zur Besorgung
dieser Angelegenheiten einen besonderen Kurator zu bestellen.
(2) Der Bestellung
eines Kurators bedarf es nicht, wenn eine Gefährdung der Interessen des
minderjährigen Kindes oder der sonst nicht voll handlungsfähigen Person
nicht zu besorgen ist und die Interessen des minderjährigen Kindes oder
der sonst nicht voll handlungsfähigen Person vom Gericht ausreichend
wahrgenommen werden können. Dies gilt im Allgemeinen in Verfahren zur
Durchsetzung der Rechte des Kindes nach
§ 140
und §
148, auch wenn es durch den betreuenden Elternteil vertreten wird,
sowie in Verfahren über Ansprüche nach
§
266 Abs. 1 und
2
oder §
267.
§
272. 108)
(1) Widerstreiten
einander die Interessen zweier oder mehrerer minderjähriger oder sonst
nicht voll handlungsfähiger Personen, die denselben gesetzlichen Vertreter
haben, so darf dieser keine der genannten Personen vertreten. Das Gericht
hat für jede von ihnen einen besonderen Kurator zu bestellen.
(2)
§
271 Abs. 2 gilt entsprechend.
b) für behinderte
Personen;
§
273.
(1)
109) Vermag eine
volljährige Person, die an einer psychischen Krankheit leidet oder geistig
behindert ist, alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten nicht ohne Gefahr
eines Nachteils für sich selbst zu besorgen, so ist ihr auf ihren Antrag
oder von Amts wegen dazu ein Sachwalter zu bestellen.
(2) Die Bestellung
eines Sachwalters ist unzulässig, wenn der Betreffende durch andere Hilfe,
besonders im Rahmen seiner Familie oder von Einrichtungen der öffentlichen
oder privaten Behindertenhilfe, in die Lage versetzt werden kann, seine
Angelegenheiten im erforderlichen Ausmaß zu besorgen. Ein Sachwalter darf
nicht nur deshalb bestellt werden, um einen Dritten vor der Verfolgung
eines, wenn auch bloß vermeintlichen, Anspruchs zu schützen.
(3) Je nach Ausmaß
der Behinderung sowie Art und Umfang der zu besorgenden Angelegenheiten
ist der Sachwalter zu betrauen
1. mit der
Besorgung einzelner Angelegenheiten, etwa der Durchsetzung oder der Abwehr
eines Anspruchs oder der Eingehung und der Abwicklung eines
Rechtsgeschäfts,
2. mit der
Besorgung eines bestimmten Kreises von Angelegenheiten, etwa der
Verwaltung eines Teiles oder des gesamten Vermögens, oder
3. mit der
Besorgung aller Angelegenheiten der behinderten Person.
§
273a.
(1) Die behinderte
Person kann innerhalb des Wirkungskreises des Sachwalters ohne dessen
ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung rechtsgeschäftlich weder
verfügen noch sich verpflichten. Sofern dadurch nicht das Wohl der
behinderten Person gefährdet wird, kann das Gericht bestimmen, daß die
behinderte Person innerhalb des Wirkungskreises des Sachwalters
hinsichtlich bestimmter Sachen oder ihres Einkommens oder eines bestimmten
Teiles davon frei verfügen und sich verpflichten kann.
(2) Schließt die
behinderte Person im Rahmen des Wirkungskreises des Sachwalters ein
Rechtsgeschäft, das eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens
betrifft, so wird dieses Rechtsgeschäft, auch wenn die Voraussetzungen des
Abs. 1 zweiter Satz nicht vorliegen, mit der Erfüllung der die
behinderte Person treffenden Pflichten rückwirkend rechtswirksam.
(3) Die behinderte
Person hat das Recht, von beabsichtigten wichtigen Maßnahmen in ihre
Person oder ihr Vermögen betreffenden Angelegenheiten vom Sachwalter
rechtzeitig verständigt zu werden und sich hierzu, wie auch zu anderen
Maßnahmen, in angemessener Frist zu äußern; diese Äußerung ist zu
berücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte Wunsch dem Wohl der
behinderten Person nicht weniger entspricht.
d) für Ungeborne;
§
274. 110)
In Rücksicht auf Ungeborne wird ein Kurator entweder für die
Nachkommenschaft überhaupt, oder für eine bereits vorhandene Leibesfrucht
(§ 22)
aufgestellt. Im ersten Falle hat der Kurator dafür zu sorgen, daß die
Nachkommenschaft bei einem ihr bestimmten Nachlasse nicht verkürzt werde;
im zweiten Falle aber, daß die Rechte des noch ungebornen Kindes erhalten
werden.
§
275. samt Überschrift
aufgehoben
f) für Abwesende und
für unbekannte Teilnehmer an einem Geschäfte;
§
276. Die Bestellung eines Kurators für Abwesende, oder für die dem
Gerichte zur Zeit noch unbekannten Teilnehmer an einem Geschäfte findet
dann statt, wenn sie keinen ordentlichen Vertreter zurückgelassen haben,
ohne solchen aber ihre Rechte durch Verzug gefährdet, oder die Rechte
eines andern in ihrem Gange gehemmt würden und nicht in anderer Weise,
etwa durch die Bestellung eines Kurators in einem bestimmten gerichtlichen
Verfahren durch das dort zur Entscheidung berufene Gericht, für die
Wahrung dieser Rechte Sorge getragen werden kann.111)
Ist der Aufenthaltsort eines Abwesenden bekannt, so muß ihn sein Kurator
von der Lage seiner Angelegenheiten unterrichten, und diese
Angelegenheiten, wenn keine andere Verfügung getroffen wird, wie jene
eines Minderjährigen besorgen.
§
277. aufgehoben
§
278. [Der Tag, an welchem eine Todeserklärung ihre Rechtskraft
erlangt hat, wird für den rechtlichen Sterbetag eines Abwesenden
gehalten;] doch schließt eine Todeserklärung den Beweis nicht aus, daß der
Abwesende früher oder später gestorben; oder daß er noch am Leben sei.
Kommt ein solcher Beweis zustande, so ist derjenige, welcher auf [den]
Grund der gerichtlichen Todeserklärung ein Vermögen in Besitz genommen
hat, wie ein anderer redlicher Besitzer zu behandeln.
[g) für Sträflinge]
§
279. aufgehoben
Bestellung
§
280. Bei der Auswahl des Sachwalters oder Kurators ist auf die Art
der Angelegenheiten, die er zu besorgen hat, bei der Auswahl des
Sachwalters für eine behinderte Person besonders auch auf deren
persönliche Bedürfnisse zu achten.
§
281.
(1) Einer
behinderten Person ist, wenn ihr Wohl nicht anderes erfordert, eine
geeignete, ihr nahestehende Person, ist sie minderjährig, der bisherige
gesetzliche Vertreter zum Sachwalter zu bestellen.
(2) Erfordert es
das Wohl der behinderten Person, so ist, soweit verfügbar, ein Sachwalter
aus dem Kreis der von einem geeigneten Verein namhaft gemachten Personen
zu bestellen.
(3) Erfordert die
Besorgung der Angelegenheit der behinderten Person vorwiegend
Rechtskenntnisse, so ist ein Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsanwärter) oder
Notar (Notariatskandidat) zum Sachwalter zu bestellen.
Rechte und Pflichten
§
282. 112)
(1) Soweit nicht
anderes bestimmt ist, sind die Bestimmungen des
3. Hauptstücks
sowie die Bestimmungen
dieses Hauptstücks
für sonstige mit der Obsorge betraute Personen auch auf die Rechte und
Pflichten des Sachwalters (Kurators) entsprechend anzuwenden.
(2) Der Sachwalter
hat persönlichen Kontakt mit der behinderten Person zu halten und sich
darum zu bemühen, dass die gebotene ärztliche und soziale Betreuung der
behinderten Person gewährt wird.
(3) Der Sachwalter
kann einer medizinischen Maßnahme, die eine dauernde
Fortpflanzungsunfähigkeit der behinderten Person zum Ziel hat, nicht
zustimmen, es sei denn, dass sonst wegen eines dauerhaften körperlichen
Leidens eine ernste Gefahr für das Leben oder einer schweren Schädigung
der Gesundheit der behinderten Person besteht. Die Zustimmung bedarf in
jedem Fall einer gerichtlichen Genehmigung.
Beendigung der
Sachwalterschaft (Kuratel)
§
283.
(1) Für das
Erlöschen der Sachwalterschaft oder Kuratel gilt der § 249113)
.
(2) Der Sachwalter
oder Kurator ist auf Antrag oder von Amts wegen zu entheben, wenn der
Pflegebefohlene nicht mehr seiner Hilfe bedarf. Die §§ 254114)
und 257115) sind
sinngemäß anzuwenden.
(3) Das Gericht hat
im Rahmen seiner Fürsorgepflicht in angemessenen Zeitabständen zu
überprüfen, ob das Wohl des Pflegebefohlenen die Aufhebung oder Änderung
der Sachwalterschaft (Kuratel) erfordert.
§
284. samt Überschrift
aufgehoben
Zweiter Teil
Von dem Sachenrechte
Von
Sachen und ihrer rechtlichen Einteilung
Begriff von Sachen im
rechtlichen Sinne
§
285. Alles, was von der Person unterschieden ist, und zum
Gebrauche der Menschen dient, wird im rechtlichen Sinne eine Sache
genannt.
§
285a. Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze
geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur
insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen.
Einteilung der Sachen
nach Verschiedenheit des Subjektes, dem sie gehören
§
286. Die Sachen in dem Staatsgebiete sind entweder ein Staats-
oder ein Privatgut. Das letztere gehört einzelnen oder moralischen
Personen, kleinern Gesellschaften, oder ganzen Gemeinden.
Freistehende Sachen;
öffentliches Gut und Staatsvermögen
§
287. Sachen, welche allen Mitgliedern des Staates zur Zueignung
überlassen sind, heißen freistehende Sachen. Jene, die ihnen nur zum
Gebrauche verstattet werden, als: Landstraßen, Ströme, Flüsse, Seehäfen
und Meeresufer, heißen ein allgemeines oder öffentliches Gut. Was zur
Bedeckung der Staatsbedürfnisse bestimmt ist, als: das Münz- oder Post-
und andere Regalien, Kammergüter, Berg- und Salzwerke, Steuern und Zölle,
wird das Staatsvermögen genannt.
Gemeindegut;
Gemeindevermögen;
§
288. Auf gleiche Weise machen die Sachen, welche nach der
Landesverfassung zum Gebrauche eines jeden Mitgliedes einer Gemeinde
dienen, das Gemeindegut; diejenigen aber, deren Einkünfte zur Bestreitung
der Gemeindeauslagen bestimmt sind, das Gemeindevermögen aus.
Privatgut des
[Landesfürsten]
§
289. Auch dasjenige Vermögen des [Landesfürsten], welches er nicht
als Oberhaupt des Staates besitzt, wird als ein Privatgut betrachtet.
Allgemeine Vorschrift
in Rücksicht dieser verschiedenen Arten der Güter
§
290. Die in diesem Privatrechte enthaltenen Vorschriften über die
Art, wie Sachen rechtmäßig erworben, erhalten und auf andere übertragen
werden können, sind in der Regel auch von den Verwaltern der Staats- und
Gemeindegüter, oder des Staats- und Gemeindevermögens zu beobachten. Die
in Hinsicht auf die Verwaltung und den Gebrauch dieser Güter sich
beziehenden Abweichungen und besondern Vorschriften sind in dem
Staatsrechte und in den politischen Verordnungen enthalten.
Einteilung der Sachen
nach dem Unterschiede ihrer Beschaffenheit
§
291. Die Sachen werden nach dem Unterschiede ihrer Beschaffenheit
eingeteilt: in körperliche und unkörperliche; in bewegliche und
unbewegliche; in verbrauchbare und unverbrauchbare; in schätzbare und
unschätzbare.
Körperliche und
unkörperliche Sachen;
§
292. Körperliche Sachen sind diejenigen, welche in die Sinne
fallen; sonst heißen sie unkörperliche; z. B. das Recht zu jagen, zu
fischen und alle anderen Rechte.
bewegliche und
unbewegliche
§
293. Sachen, welche ohne Verletzung ihrer Substanz von einer
Stelle zur andern versetzt werden können, sind beweglich; im
entgegengesetzten Falle sind sie unbeweglich. Sachen, die an sich
beweglich sind, werden im rechtlichen Sinne für unbeweglich gehalten, wenn
sie vermöge des Gesetzes oder der Bestimmung des Eigentümers das Zugehör
einer unbeweglichen Sache ausmachen.
Zugehör überhaupt;
§
294. Unter Zugehör versteht man dasjenige, was mit einer Sache in
fortdauernde Verbindung gesetzt wird. Dahin gehören nicht nur der Zuwachs
einer Sache solange er von derselben nicht abgesondert ist; sondern auch
die Nebensachen, ohne welche die Hauptsache nicht gebraucht werden kann,
oder die das Gesetz, oder der Eigentümer zum fortdauernden Gebrauche der
Hauptsache bestimmt hat.
insbesondere bei
Grundstücken und Teichen;
§
295. Gras, Bäume, Früchte und alle brauchbare Dinge, welche die
Erde auf ihrer Oberfläche hervorbringt, bleiben so lange ein unbewegliches
Vermögen, als sie nicht von Grund und Boden abgesondert worden sind.
Selbst die Fische in einem Teiche, und das Wild in einem Walde werden erst
dann ein bewegliches Gut, wenn der Teich gefischt, und das Wild gefangen
oder erlegt worden ist.
§
296. Auch das Getreide, das Holz, das Viehfutter und alle übrige,
obgleich schon eingebrachte Erzeugnisse, sowie alles Vieh und alle zu
einem liegenden Gute gehörige Werkzeuge und Gerätschaften werden insofern
für unbewegliche Sachen gehalten, als sie zur Fortsetzung des ordentlichen
Wirtschaftsbetriebes erforderlich sind.
und bei Gebäuden;
§
297. Ebenso gehören zu den unbeweglichen Sachen diejenigen, welche
auf Grund und Boden in der Absicht aufgeführt werden, daß sie stets darauf
bleiben sollen, als: Häuser und andere Gebäude mit dem in senkrechter
Linie darüber befindlichen Luftraume; ferner: nicht nur alles, was erd-,
mauer-, niet- und nagelfest ist, als: Braupfannen, Branntweinkessel und
eingezimmerte Schränke, sondern auch diejenigen Dinge, die zum anhaltenden
Gebrauche eines Ganzen bestimmt sind: z. B. Brunneneimer, Seile, Ketten,
Löschgeräte und dergleichen.
Maschinen
§
297a. Werden mit einer unbeweglichen Sache Maschinen in Verbindung
gebracht, so gelten sie nicht als Zugehör, wenn mit Zustimmung des
Eigentümers der Liegenschaft im öffentlichen Buch angemerkt wird, daß die
Maschinen Eigentum eines anderen sind. Werden sie als Ersatz an Stelle
solcher Maschinen angebracht, die als Zugehör anzusehen waren, so ist zu
dieser Anmerkung auch die Zustimmung der früher eingetragenen bücherlich
Berechtigten erforderlich. Die Anmerkung verliert mit Ablauf von fünf
Jahren nach der Eintragung ihre Wirkung; durch das Konkurs- oder
Zwangsversteigerungsverfahren wird der Ablauf der Frist gehemmt.
Rechte sind insgemein
als bewegliche Sachen anzusehen;
§
298. Rechte werden den beweglichen Sachen beigezählt, wenn sie
nicht mit dem Besitze einer unbeweglichen Sache verbunden, oder durch [die
Landesverfassung] für eine unbewegliche Sache erklärt sind.
auch die vorgemerkten
Forderungen
§
299. Schuldforderungen werden durch die Sicherstellung auf ein
unbewegliches Gut nicht in ein unbewegliches Vermögen verwandelt.
[Nach welchen
Gesetzen die unbeweglichen; und nach welchen die beweglichen Sachen zu
beurteilen sind]
§
300. außer Kraft getreten
Verbrauchbare und
unverbrauchbare Sachen
§
301. Sachen, welche ohne ihre Zerstörung oder Verzehrung den
gewöhnlichen Nutzen nicht gewähren, heißen verbrauchbare; die von
entgegengesetzter Beschaffenheit aber, unverbrauchbare Sachen.
Gesamtsache (universitas
rerum)
§
302. Ein Inbegriff von mehreren besondern Sachen, die als eine
Sache angesehen, und mit einem gemeinschaftlichen Namen bezeichnet zu
werden pflegen, macht eine Gesamtsache aus, und wird als ein Ganzes
betrachtet.
Schätzbare und
unschätzbare;
§
303. Schätzbare Sachen sind diejenigen, deren Wert durch
Vergleichung mit andern zum Verkehre bestimmt werden kann; darunter
gehören auch Dienstleistungen, Hand- und Kopfarbeiten. Sachen hingegen,
deren Wert durch keine Vergleichung mit andern im Verkehre befindlichen
Sachen bestimmt werden kann, heißen unschätzbare.
Maßstab der
gerichtlichen Schätzung
§
304. Der bestimmte Wert einer Sache heißt ihr Preis. Wenn eine
Sache vom Gerichte zu schätzen ist, so muß die Schätzung nach einer
bestimmten Summe Geldes geschehen.
Ordentlicher und
außerordentlicher Preis
§
305. Wird eine Sache nach dem Nutzen geschätzt, den sie mit
Rücksicht auf Zeit und Ort gewöhnlich und allgemein leistet, so fällt der
ordentliche und gemeine Preis aus; nimmt man aber auf die besondern
Verhältnisse und auf die in zufälligen Eigenschaften der Sache gegründete
besondere Vorliebe desjenigen, dem der Wert ersetzt werden muß, Rücksicht,
so entsteht ein außerordentlicher Preis.
Welcher bei
gerichtlichen Schätzungen zur Richtschnur zu nehmen
§
306. In allen Fällen, wo nichts anderes entweder bedungen, oder
von dem Gesetze verordnet wird, muß bei der Schätzung einer Sache der
gemeine Preis zur Richtschnur genommen werden.
Begriffe vom
dinglichen und persönlichen Sachenrechte
§
307. Rechte, welche einer Person über eine Sache ohne Rücksicht
auf gewisse Personen zustehen, werden dingliche Rechte genannt. Rechte,
welche zu einer Sache nur gegen gewisse Personen unmittelbar aus einem
Gesetze, oder aus einer verbindlichen Handlung entstehen, heißen
persönliche Sachenrechte.
§
308. Dingliche Sachenrechte sind das Recht des Besitzes, des
Eigentumes, des Pfandes, der Dienstbarkeit und des Erbrechtes.
Erste Abteilung des Sachenrechtes
Von den dinglichen Rechten
Erstes Hauptstück
Von dem Besitzer
Inhaber. Besitzer
§
309. Wer eine Sache in seiner Macht oder Gewahrsame hat, heißt ihr
Inhaber. Hat der Inhaber einer Sache den Willen, sie als die seinige zu
behalten, so ist er ihr Besitzer.
Erwerbung des
Besitzes. Fähigkeit der Person zur Besitzerwerbung
§
310. Kinder unter sieben Jahren und Personen über sieben Jahre,
die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, können – außer in den Fällen
des
§
151 Abs. 3 – Besitz nur durch ihren gesetzlichen Vertreter erwerben.
Im übrigen ist die Fähigkeit zum selbständigen Besitzerwerb gegeben.
Gegenstände des
Besitzes
§
311. Alle körperliche und unkörperliche Sachen, welche ein
Gegenstand des rechtlichen Verkehres sind, können in Besitz genommen
werden.
Arten der
Besitzerwerbung;
§
312. Körperliche, bewegliche Sachen werden durch physische
Ergreifung, Wegführung oder Verwahrung; unbewegliche aber durch Betretung,
Verrainung, Einzäunung, Bezeichnung oder Bearbeitung in Besitz genommen.
In den Besitz unkörperlicher Sachen oder Rechte kommt man durch den
Gebrauch derselben im eigenen Namen.
insbesondere von
einem bejahenden, verneinenden, oder einem Verbotsrechte
§
313. Der Gebrauch eines Rechtes wird gemacht, wenn jemand von
einem andern etwas als eine Schuldigkeit fordert, und dieser es ihm
leistet; ferner, wenn jemand die einem andern gehörige Sache mit dessen
Gestattung zu seinem Nutzen anwendet; endlich, wenn auf fremdes Verbot ein
anderer das, was er sonst zu tun befugt wäre, unterläßt.
Unmittelbare und
mittelbare Erwerbungsart des Besitzes
§
314. Den Besitz sowohl von Rechten, als von körperlichen Sachen
erlangt man entweder unmittelbar, wenn man freistehender Rechte und
Sachen; oder mittelbar, wenn man eines Rechtes, oder einer Sache, die
einem andern gehört, habhaft wird.
Umfang der Erwerbung
§
315. Durch die unmittelbare und durch die mittelbare eigenmächtige
Besitzergreifung erhält man nur so viel in Besitz, als wirklich ergriffen,
betreten, gebraucht, bezeichnet, oder in Verwahrung gebracht worden ist;
bei der mittelbaren, wenn uns der Inhaber in seinem oder eines andern
Namen ein Recht oder eine Sache überläßt, erhält man alles, was der vorige
Inhaber gehabt und durch deutliche Zeichen übergeben hat, ohne daß es
nötig ist, jeden Teil des Ganzen besonders zu übernehmen.
Rechtmäßiger;
unrechtmäßiger Besitz
§
316. Der Besitz einer Sache heißt rechtmäßig, wenn er auf einem
gültigen Titel, das ist, auf einem zur Erwerbung tauglichen Rechtsgrunde
beruht. Im entgegengesetzten Falle heißt er unrechtmäßig.
Haupttitel des
rechtmäßigen Besitzes
§
317. Der Titel liegt bei freistehenden Sachen in der angebornen
Freiheit zu Handlungen, wodurch die Rechte anderer nicht verletzt werden;
bei andern in dem Willen des vorigen Besitzers, oder in dem Ausspruche des
Richters, oder endlich in dem Gesetze, wodurch jemandem das Recht zum
Besitze erteilt wird.
Der Inhaber hat noch
keinen Titel;
§
318. Dem Inhaber, der eine Sache nicht in seinem, sondern im Namen
eines andern innehat, kommt noch kein Rechtsgrund zur Besitznahme dieser
Sache zu.
und kann ihn nicht
eigenmächtig erlangen
§
319. Der Inhaber einer Sache ist nicht berechtigt, den Grund
seiner Gewahrsame eigenmächtig zu verwechseln, und sich dadurch eines
Titels anzumaßen; wohl aber kann derjenige, welcher bisher eine Sache in
eigenem Namen rechtmäßig besaß, das Besitzrecht einem anderen überlassen
und sie künftig in dessen Namen innehaben.
Wirkung des bloßen
Titels
§
320. Durch einen gültigen Titel erhält man nur das Recht zum
Besitze einer Sache, nicht den Besitz selbst. Wer nur das Recht zum
Besitze hat, darf sich im Verweigerungsfalle nicht eigenmächtig in den
Besitz setzen; er muß ihn von dem ordentlichen Richter mit Anführung
seines Titels im Wege Rechtens fordern.
Erforderung zum
wirklichen Besitzrechte
§
321. Wo sogenannte Landtafeln, [Stadt-] oder Grundbücher, oder
andere dergleichen öffentliche Register eingeführt sind, wird der
rechtmäßige Besitz eines dinglichen Rechtes auf unbewegliche Sachen nur
durch die ordentliche Eintragung in diese öffentlichen Bücher erlangt.
§
322. Ist eine bewegliche Sache nach und nach mehreren Personen
übergeben worden; so gebührt das Besitzrecht derjenigen, welche sie in
ihrer Macht hat. Ist aber die Sache unbeweglich, und sind öffentliche
Bücher eingeführt, so steht das Besitzrecht ausschließlich demjenigen zu,
welcher als Besitzer derselben eingeschrieben ist.
Der Besitzer kann zur
Angabe des Rechtsgrundes nicht aufgefordert werden
§
323. Der Besitzer einer Sache hat die rechtliche Vermutung eines
gültigen Titels für sich; er kann also zur Angabe desselben nicht
aufgefordert werden.
§
324. Diese Aufforderung findet auch dann noch nicht statt, wenn
jemand behauptet, daß der Besitz seines Gegners mit andern rechtlichen
Vermutungen, z. B. mit der Freiheit des Eigentumes, sich nicht vereinbaren
lasse. In solchen Fällen muß der behauptende Gegner vor dem ordentlichen
Richter klagen, und sein vermeintliches stärkeres Recht dartun. Im Zweifel
gebührt dem Besitzer der Vorzug.
Ausnahme
§
325. Inwiefern der Besitzer einer Sache, deren Verkehr verboten;
oder die entwendet zu sein scheint, den Titel seines Besitzes anzuzeigen
verbunden sei, darüber entscheiden die Straf- und politischen Gesetze.
Redlicher und
unredlicher Besitzer
§
326. Wer aus wahrscheinlichen Gründen die Sache, die er besitzt,
für die seinige hält, ist ein redlicher Besitzer. Ein unredlicher Besitzer
ist derjenige, welcher weiß oder aus den Umständen vermuten muß, daß die
in seinem Besitze befindliche Sache einem andern zugehöre. Aus Irrtum in
Tatsachen oder aus Unwissenheit der gesetzlichen Vorschriften kann man ein
unrechtmäßiger (§
316) und doch ein redlicher Besitzer sein.
Wie ein Mitbesitzer
zum unredlichen oder unrechtmäßigen Besitzer werde
§
327. Besitzt eine Person die Sache selbst, eine andere aber das
Recht auf alle oder auf einige Nutzungen dieser Sache; so kann eine und
dieselbe Person, wenn sie die Grenzen ihres Rechtes überschreitet, in
verschiedenen Rücksichten ein redlicher und unredlicher, ein rechtmäßiger
und unrechtmäßiger Besitzer sein.
Entscheidung über die
Redlichkeit des Besitzes
§
328. Die Redlichkeit oder Unredlichkeit des Besitzes muß im Falle
eines Rechtsstreites durch richterlichen Ausspruch entschieden werden. Im
Zweifel ist die Vermutung für die Redlichkeit des Besitzes.
Fortdauer des Besitzes. Rechte des redlichen Besitzes:
a) in Rücksicht der
Substanz der Sache;
§
329. Ein redlicher Besitzer kann schon allein aus dem Grunde des
redlichen Besitzes die Sache, die er besitzt, ohne Verantwortung nach
Belieben brauchen, verbrauchen, auch wohl vertilgen.
b) der Nutzungen;
§
330. Dem redlichen Besitzer gehören alle aus der Sache
entspringende Früchte, sobald sie von der Sache abgesondert worden sind;
ihm gehören auch alle andere schon eingehobene Nutzungen, insofern sie
während des ruhigen Besitzes bereits fällig gewesen sind.
c) des Aufwandes
§
331. Hat der redliche Besitzer an die Sache entweder zur
fortwährenden Erhaltung der Substanz einen notwendigen, oder, zur
Vermehrung noch fortdauernder Nutzungen einen nützlichen Aufwand gemacht;
so gebührt ihm der Ersatz nach dem gegenwärtigen Werte, insofern er den
wirklich gemachten Aufwand nicht übersteigt.
§
332. Von dem Aufwande, welcher nur zum Vergnügen und zur
Verschönerung gemacht worden ist, wird nur so viel ersetzt, als die Sache
dem gemeinen Werte nach wirklich dadurch gewonnen hat; doch hat der vorige
Besitzer die Wahl, alles für sich wegzunehmen, was davon ohne Schaden der
Substanz weggenommen werden kann.
Anspruch auf den
Ersatz des Preises
§
333. Selbst der redliche Besitzer kann den Preis, welchen er
seinem Vormanne für die ihm überlassene Sache gegeben hat, nicht fordern.
Wer aber eine fremde Sache, die der Eigentümer sonst schwerlich wieder
erlangt haben würde, redlicher Weise an sich gelöst, und dadurch dem
Eigentümer einen erweislichen Nutzen verschafft hat, kann eine angemessene
Vergütung fordern.
§
334. Ob einem redlichen Inhaber das Recht zustehe, seiner
Forderung wegen die Sache zurückzubehalten, wird in dem
Hauptstücke vom
Pfandrechte bestimmt.
Verbindlichkeit des
unredlichen Besitzers
§
335. Der unredliche Besitzer ist verbunden, nicht nur alle durch
den Besitz einer fremden Sache erlangte Vorteile zurückzustellen; sondern
auch diejenigen, welche der Verkürzte erlangt haben würde, und allen durch
seinen Besitz entstandenen Schaden zu ersetzen. In dem Falle, daß der
unredliche Besitzer durch eine in den Strafgesetzen verbotene Handlung zum
Besitze gelangt ist, erstreckt sich der Ersatz bis zum Werte der besondern
Vorliebe.
§
336. Hat der unredliche Besitzer einen Aufwand auf die Sache
gemacht, so ist dasjenige anzuwenden, was in Rücksicht des von einem
Geschäftsführer ohne Auftrag gemachten Aufwandes in dem
Hauptstücke von
der Bevollmächtigung verordnet ist.
Beurteilung der
Redlichkeit des Besitzes einer Gemeinde
§
337. Der Besitz einer Gemeinde wird nach der Redlichkeit oder
Unredlichkeit der im Namen der Mitglieder handelnden Machthaber beurteilt.
Immer müssen jedoch die unredlichen sowohl den redlichen Mitgliedern, als
dem Eigentümer den Schaden ersetzen.
Inwiefern durch die
Klage der Besitz unredlich werde
§
338. Auch der redliche Besitzer, wenn er durch richterlichen
Ausspruch zur Zurückstellung der Sache verurteilt wird, ist in Rücksicht
des Ersatzes der Nutzungen und des Schadens, wie auch in Rücksicht des
Aufwandes, von dem Zeitpunkte der ihm zugestellten Klage, gleich einem
unredlichen Besitzer zu behandeln; doch haftet er für den Zufall, der die
Sache bei dem Eigentümer nicht getroffen hätte, nur in dem Falle, daß er
die Zurückgabe durch einen mutwilligen Rechtsstreit verzögert hat.
Rechtsmittel des
Besitzers bei einer Störung seines Besitzes;
§
339. Der Besitz mag von was immer für einer Beschaffenheit sein,
so ist niemand befugt, denselben eigenmächtig zu stören. Der Gestörte hat
das Recht, die Untersagung des Eingriffes, und den Ersatz des erweislichen
Schadens gerichtlich zu fordern.
besonders durch eine
Bauführung;
§
340. Wird der Besitzer einer unbeweglichen Sache oder eines
dinglichen Rechtes durch Führung eines neuen Gebäudes, Wasserwerkes, oder
andern Werkes in seinen Rechten gefährdet, ohne daß sich der Bauführer
nach Vorschrift der allgemeinen Gerichtsordnung gegen ihn geschützt hat;
so ist der Gefährdete berechtigt, das Verbot einer solchen Neuerung vor
Gericht zu fordern, und das Gericht ist verbunden, die Sache auf das
schleunigste zu entscheiden.
§
341. Bis zur Entscheidung der Sache ist die Fortsetzung des Baues
von dem Gerichte in der Regel nicht zu gestatten. Nur bei einer nahen,
offenbaren Gefahr, oder, wenn der Bauführer eine angemessene Sicherheit
leistet, daß er die Sache in den vorigen Stand setzen, und den Schaden
vergüten wolle, der Verbotsleger dagegen in dem letztern Falle keine
ähnliche Sicherstellung für die Folgen seines Verbots leistet, ist die
einstweilige Fortsetzung des Baues zu bewilligen.
§
342. Was in den vorhergehenden Paragraphen in Rücksicht einer
neuen Bauführung verordnet wird, ist auch auf die Niederreißung eines
alten Gebäudes, oder andern Werkes anzuwenden.
und bei der Gefahr
eines vorhandenen Baues
§
343. Kann der Besitzer eines dinglichen Rechtes beweisen, daß ein
bereits vorhandener fremder Bau oder eine andere fremde Sache dem
Einsturze nahe sei, und ihm offenbarer Schaden drohe; so ist er befugt,
gerichtlich auf Sicherstellung zu dringen, wenn anders die politische
Behörde nicht bereits hinlänglich für die öffentliche Sicherheit gesorgt
hat.
Rechtsmittel zur Erhaltung des Besitzstandes:
a) bei dringender
Gefahr;
§
344. Zu den Rechten des Besitzes gehört auch das Recht, sich in
seinem Besitze zu schützen, und in dem Falle, daß die richterliche Hilfe
zu spät kommen würde, Gewalt mit angemessener Gewalt abzutreiben (§
19). Übrigens hat die politische Behörde für die Erhaltung der
öffentlichen Ruhe, so wie das Strafgericht für die Bestrafung öffentlicher
Gewalttätigkeiten, zu sorgen.
b) gegen den unechten
Besitzer;
§
345. Wenn sich jemand in den Besitz eindringt, oder durch List
oder Bitte heimlich einschleicht, und das, was man ihm aus Gefälligkeit,
ohne sich einer fortdauernden Verbindlichkeit zu unterziehen gestattet, in
ein fortwährendes Recht zu verwandeln sucht; so wird der an sich
unrechtmäßige und unredliche Besitz noch überdies unecht; in
entgegengesetzten Fällen wird der Besitz für echt angesehen.
§
346. Gegen jeden unechten Besitzer kann sowohl die Zurücksetzung
in die vorige Lage, als auch die Schadloshaltung eingeklagt werden. Beides
muß das Gericht nach rechtlicher Verhandlung, selbst ohne Rücksicht auf
ein stärkeres Recht, welches der Geklagte auf die Sache haben könnte,
verordnen.
c) beim Zweifel über
die Echtheit des Besitzes;
§
347. Zeigt es sich nicht gleich auf der Stelle, wer sich in einem
echten Besitze befinde, und inwiefern der eine oder der andere Teil auf
gerichtliche Unterstützung Anspruch habe; so wird die im Streite
verfangene Sache so lange der Gewahrsame des Gerichtes oder eines Dritten
anvertraut, bis der Streit über den Besitz verhandelt und entschieden
worden ist. Der Sachfällige kann auch nach dieser Entscheidung die Klage
aus einem vermeintlich stärkeren Rechte auf die Sache noch anhängig
machen.
Verwahrungsmittel des
Inhabers gegen mehrere zusammentreffende Besitzwerber
§
348. Wenn der bloße Inhaber von mehreren Besitzwerbern zugleich um
die Übergabe der Sache angegangen wird, und sich einer darunter befindet,
in dessen Namen die Sache aufbewahrt wurde; so wird sie vorzüglich diesem
übergeben, und die Übergabe den übrigen bekanntgemacht. Kommt dieser
Umstand keinem zustatten, so wird die Sache der Gewahrsame des Richters
oder eines Dritten anvertraut. Der Richter hat die Rechtsgründe der
Besitzwerber zu prüfen und darüber zu entscheiden.
Erlöschung des Besitzes:
a) körperlicher
Sachen;
§
349. Der Besitz einer körperlichen Sache geht insgemein verloren,
wenn dieselbe ohne Hoffnung, wieder gefunden zu werden, in Verlust gerät;
wenn sie freiwillig verlassen wird; oder, in fremden Besitz kommt.
b) der in die
öffentlichen Bücher eingetragenen Rechte;
§
350. Der Besitz derjenigen Rechte und unbeweglichen Sachen, welche
einen Gegenstand der öffentlichen Bücher ausmachen, erlischt, wenn sie aus
den landtäflichen, Stadt- oder Grundbüchern gelöscht; oder wenn sie auf
den Namen eines andern eingetragen werden.
c) anderer Rechte
§
351. Bei andern Rechten hört der Besitz auf, wenn der Gegenteil
das, was er sonst geleistet hat, nicht mehr leisten zu wollen erklärt;
wenn er die Ausübung des Rechtes eines andern nicht mehr duldet; oder wenn
er das Verbot, etwas zu unterlassen, nicht mehr achtet, der Besitzer aber
in allen diesen Fällen es dabei bewenden läßt, und die Erhaltung des
Besitzes nicht einklagt. Durch den bloßen Nichtgebrauch eines Rechtes geht
der Besitz, außer den im Gesetze bestimmten Verjährungsfällen, nicht
verloren.
§
352. Solange noch Hoffnung vorhanden ist, eine verlorene Sache zu
erhalten, kann man sich durch den bloßen Willen in ihrem Besitze erhalten.
Die Abwesenheit des Besitzers oder die eintretende Unfähigkeit einen
Besitz zu erwerben, heben den bereits erworbenen Besitz nicht auf.
Zweites Hauptstück
Von dem Eigentumsrechte
Begriff des
Eigentumes. Eigentum im objektiven Sinne;
§
353. Alles, was jemandem zugehört, alle seine körperlichen und
unkörperlichen Sachen, heißen sein Eigentum.
im subjektiven
§
354. Als ein Recht betrachtet, ist Eigentum das Befugnis, mit der
Substanz und den Nutzungen einer Sache nach Willkür zu schalten, und jeden
andern davon auszuschließen.
Objektive und
subjektive Möglichkeit der Erwerbung des Eigentumes
§
355. Alle Sachen sind insgemein Gegenstände des Eigentumsrechtes,
und jedermann, den die Gesetze nicht ausdrücklich ausschließen, ist
befugt, dasselbe durch sich selbst oder durch einen andern in seinem Namen
zu erwerben.
§
356. Wer also behauptet, daß der Person, die etwas erwerben will,
in Rücksicht ihrer persönlichen Fähigkeit, oder in Rücksicht auf die
Sache, die erworben werden soll, ein gesetzliches Hindernis entgegenstehe,
dem liegt der Beweis ob.
Einteilung des
Eigentums in vollständiges und unvollständiges
§
357. Wenn das Recht auf die Substanz einer Sache mit dem Rechte
auf die Nutzungen in einer und derselben Person vereinigt ist, so ist das
Eigentumsrecht vollständig und ungeteilt. Kommt aber einem nur ein Recht
auf die Substanz der Sache; dem andern dagegen nebst einem Rechte auf die
Substanz, das ausschließende Recht auf derselben Nutzungen zu, dann ist
das Eigentumsrecht geteilt und für beide unvollständig. Jener wird
Obereigentümer; dieser Nutzungseigentümer genannt.
§
358. Alle anderen Arten der Beschränkungen durch das Gesetz oder
durch den Willen des Eigentümers heben die Vollständigkeit des Eigentumes
nicht auf.
§
359. Die Absonderung des Rechtes auf die Substanz von dem Rechte
auf die Nutzungen entsteht teils durch Verfügung des Eigentümers; teils
durch gesetzliche Verordnung. Nach Verschiedenheit der zwischen dem Ober-
und Nutzungseigentümer obwaltenden Verhältnisse werden die Güter, worin
das Eigentum geteilt ist, [Lehen-,] Erbpacht- und Erbzinsgüter genannt.
Von [dem Lehen wird in dem besonders bestehenden Lehenrechte; von] den
Erbpacht- und Erbzinsgütern aber in dem
Hauptstücke von
Bestandverträgen gehandelt.
§
360. Aus der bloßen Abführung eines fortdauernden Zinses, oder
jährlicher Renten von einem Grundstücke kann man noch nicht auf die
Teilung des Eigentums folgern. In allen Fällen, in welchen die Trennung
des Rechtes auf die Substanz von dem Rechte auf die Nutzungen nicht
ausdrücklich erhellt, ist jeder redliche Besitzer als vollständiger
Eigentümer anzusehen.
Miteigentum
§
361. Wenn eine noch ungeteilte Sache mehrern Personen zugleich
zugehört; so entsteht ein gemeinschaftliches Eigentum. In Beziehung auf
das Ganze werden die Miteigentümer für eine einzige Person angesehen;
insoweit ihnen aber gewisse, obgleich unabgesonderte Teile angewiesen
sind, hat jeder Miteigentümer das vollständige Eigentum des ihm gehörigen
Teiles.
Rechte des
Eigentümers
§
362. Kraft des Rechtes, frei über sein Eigentum zu verfügen, kann
der vollständige Eigentümer in der Regel seine Sache nach Willkür benützen
oder unbenützt lassen; er kann sie vertilgen, ganz oder zum Teile auf
andere übertragen, oder unbedingt sich derselben begeben, das ist, sie
verlassen.
Beschränkungen
derselben
§
363. Eben diese Rechte genießen auch unvollständige, sowohl Ober-
als Nutzungseigentümer; nur darf der eine nichts vornehmen, was mit dem
Rechte des andern im Widerspruche steht.
§
364.
(1) Überhaupt
findet die Ausübung des Eigentumsrechtes nur insofern statt, als dadurch
weder in die Rechte eines Dritten ein Eingriff geschieht, noch die in den
Gesetzen zur Erhaltung und Beförderung des allgemeinen Wohles
vorgeschriebenen Einschränkungen übertreten werden.
(2) Der Eigentümer
eines Grundstückes kann dem Nachbarn die von dessen Grund ausgehenden
Einwirkungen durch Abwässer, Rauch, Gase, Wärme, Geruch, Geräusch,
Erschütterung und ähnliche insoweit untersagen, als sie das nach den
örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten und die ortsübliche
Benutzung des Grundstückes wesentlich beeinträchtigen. Unmittelbare
Zuleitung ist ohne besonderen Rechtstitel unter allen Umständen
unzulässig.
§
364a. Wird jedoch die Beeinträchtigung durch eine Bergwerksanlage
oder eine behördlich genehmigte Anlage auf dem nachbarlichen Grund in
einer dieses Maß überschreitenden Weise verursacht, so ist der
Grundbesitzer nur berechtigt, den Ersatz des zugefügten Schadens
gerichtlich zu verlangen, auch wenn der Schaden durch Umstände verursacht
wird, auf die bei der behördlichen Verhandlung keine Rücksicht genommen
wurde.
§
364b. Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, daß
der Boden oder das Gebäude des Nachbars die erforderliche Stütze verliert,
es sei denn, daß der Besitzer des Grundstückes für eine genügende
anderweitige Befestigung Vorsorge trifft.
§
364c. Ein vertragsmäßiges oder letztwilliges Veräußerungs- oder
Belastungsverbot hinsichtlich einer Sache oder eines dinglichen Rechtes
verpflichtet nur den ersten Eigentümer, nicht aber seine Erben oder
sonstigen Rechtsnachfolger. Gegen Dritte wirkt es dann, wenn es zwischen
Ehegatten, Eltern und Kindern, Wahl- oder Pflegekindern oder deren
Ehegatten begründet und im öffentlichen Buche eingetragen wurde.
§
365. Wenn es das allgemeine Beste erheischt, muß ein Mitglied des
Staates gegen eine angemessene Schadloshaltung selbst das vollständige
Eigentum einer Sache abtreten.
Klagen aus dem Eigentumsrechte:
a) Eigentliche
Eigentumsklage: wem und gegen wen sie gebühre?
§
366. Mit dem Rechte des Eigentümers, jeden andern von dem Besitze
seiner Sache auszuschließen, ist auch das Recht verbunden, seine ihm
vorenthaltene Sache von jedem Inhaber durch die Eigentumsklage gerichtlich
zu fordern. Doch steht dieses Recht demjenigen nicht zu, welcher eine
Sache zur Zeit, da er noch nicht Eigentümer war, in seinem eigenen Namen
veräußert, in der Folge aber das Eigentum derselben erlangt hat.
§
367. Die Eigentumsklage findet gegen den redlichen Besitzer einer
beweglichen Sache nicht statt, wenn er beweist, daß er diese Sache
entweder in einer öffentlichen Versteigerung, oder von einem zu diesem
Verkehre befugten Gewerbsmanne, oder gegen Entgelt von jemandem an sich
gebracht hat, dem sie der Kläger selbst zum Gebrauche, zur Verwahrung,
oder in was immer für einer andern Absicht anvertraut hatte. In diesen
Fällen wird von den redlichen Besitzern das Eigentum erworben, und dem
vorigen Eigentümer steht nur gegen jene, die ihm dafür verantwortlich
sind, das Recht der Schadloshaltung zu.
§
368. Wird aber bewiesen, daß der Besitzer entweder schon aus der
Natur der an sich gebrachten Sache, oder aus dem auffallend zu geringen
Preise derselben, oder aus den bekannten persönlichen Eigenschaften seines
Vormannes, aus dessen Gewerbe oder andern Verhältnissen einen gegründeten
Verdacht gegen die Redlichkeit seines Besitzes hätte schöpfen können; so
muß er als ein unredlicher Besitzer die Sache dem Eigentümer abtreten.
Was dem Kläger zu
beweisen obliege?
§
369. Wer die Eigentumsklage übernimmt, muß den Beweis führen, daß
der Geklagte die eingeklagte Sache in seiner Macht habe, und daß diese
Sache sein Eigentum sei.
§
370. Wer eine bewegliche Sache gerichtlich zurückfordert, muß sie
durch Merkmale beschreiben, wodurch sie von allen ähnlichen Sachen
gleicher Gattung ausgezeichnet wird.
§
371. Sachen, die sich auf diese Art nicht unterscheiden lassen,
wie bares Geld mit anderm baren Gelde vermengt, oder auf den Überbringer
lautende Schuldbriefe, sind also in der Regel kein Gegenstand der
Eigentumsklage; wenn nicht solche Umstände eintreten, aus denen der Kläger
sein Eigentumsrecht beweisen kann, und aus denen der Geklagte wissen mußte,
daß er die Sache sich zuzuwenden nicht berechtigt sei.
b)
Eigentumsklage aus dem rechtlich vermuteten Eigentume des Klägers
Gegen welchen
Besitzer diese Vermutung eintrete?
§
372. Wenn der Kläger mit dem Beweise des erworbenen Eigentumes
einer ihm vorenthaltenen Sache zwar nicht ausreicht, aber den gültigen
Titel, und die echte Art, wodurch er zu ihrem Besitze gelangt ist,
dargetan hat; so wird er doch in Rücksicht eines jeden Besitzers, der
keinen, oder nur einen schwächern Titel seines Besitzes anzugeben vermag,
für den wahren Eigentümer gehalten.
§
373. Wenn also der Geklagte die Sache auf eine unredliche oder
unrechtmäßige Weise besitzt; wenn er keinen oder nur einen verdächtigen
Vormann anzugeben vermag; oder, wenn er die Sache ohne Entgelt, der Kläger
aber gegen Entgelt erhalten hat; so muß er dem Kläger weichen.
§
374. Haben der Geklagte und der Kläger einen gleichen Titel ihres
echten Besitzes, so gebührt dem Geklagten kraft des Besitzes der Vorzug.
§
375. Wer eine Sache in fremdem Namen besitzt, kann sich gegen die
Eigentumsklage dadurch schützen, daß er seinen Vormann namhaft macht, und
sich darüber ausweist.
Gesetzliche Folge:
a) der Ableugnung des
Besitzes;
§
376. Wer den Besitz einer Sache vor Gericht leugnet und dessen
überwiesen wird, muß dem Kläger deswegen allein schon den Besitz abtreten;
doch behält er das Recht, in der Folge seine Eigentumsklage anzustellen.
b) des vorgegebenen
Besitzes;
§
377. Wer eine Sache, die er nicht besitzt, zu besitzen vorgibt,
und den Kläger dadurch irreführt, haftet für allen daraus entstehenden
Schaden.
c) des aufgegebenen
Besitzes der streitigen Sache
§
378. Wer eine Sache im Besitze hatte, und nach zugestellter Klage
fahren ließ, muß sie dem Kläger, wenn dieser sich nicht an den wirklichen
Inhaber halten will, auf seine Kosten zurückverschaffen, oder den
außerordentlichen Wert derselben ersetzen.
Was der Besitzer dem
Eigentümer erstatte
§
379. Was sowohl der redliche als unredliche Besitzer dem
Eigentümer in Ansehung des entgangenen Nutzens, oder des erlittenen
Schadens zu ersetzen habe, ist in dem vorigen Hauptstücke bestimmt worden.
Drittes Hauptstück
Von der Erwerbung des Eigentumes durch Zueignung
Rechtliche
Erfordernisse der Erwerbung
§
380. Ohne Titel und ohne rechtliche Erwerbungsart kann kein
Eigentum erlangt werden.
Titel und Art der
unmittelbaren Erwerbung: Die Zueignung
§
381. Bei freistehenden Sachen besteht der Titel in der angebornen
Freiheit, sie in Besitz zu nehmen. Die Erwerbungsart ist die Zueignung,
wodurch man sich einer freistehenden Sache bemächtigt, in der Absicht, sie
als die seinige zu behandeln.
§
382. Freistehende Sachen können von allen Mitgliedern des Staates
durch die Zueignung erworben werden, insofern diese Befugnis nicht durch
politische Gesetze eingeschränkt ist, oder einigen Mitgliedern das
Vorrecht der Zueignung zusteht.
1. durch den
Tierfang;
§
383. Dieses gilt insbesondere von dem Tierfange. Wem das Recht zu
jagen oder zu fischen gebühre; wie der übermäßige Anwachs des Wildes
gehemmt, und der vom Wilde verursachte Schaden ersetzt werde; wie der
Honigraub, der durch fremde Bienen geschieht, zu verhindern sei; ist in
den politischen Gesetzen festgesetzt. Wie Wilddiebe zu bestrafen seien,
wird in den Strafgesetzen bestimmt.
§
384. Häusliche Bienenschwärme und andere zahme oder zahm gemachte
Tiere sind kein Gegenstand des freien Tierfanges, vielmehr hat der
Eigentümer das Recht, sie auf fremdem Grunde zu verfolgen; doch soll er
dem Grundbesitzer den ihm etwa verursachten Schaden ersetzen. Im Falle,
daß der Eigentümer des Mutterstockes den Schwarm durch zwei Tage nicht
verfolgt hat; oder, daß ein zahm gemachtes Tier durch zweiundvierzig Tage
von selbst ausgeblieben ist, kann sie auf gemeinem Grunde jedermann; auf
dem seinigen der Grundeigentümer für sich nehmen, und behalten.
2. durch das Finden
freistehender Sachen
§
385. Keine Privatperson ist berechtigt, die dem Staate durch die
politischen Verordnungen vorbehaltenen Erzeugnisse sich zuzueignen.
§
386. Bewegliche Sachen, welche der Eigentümer nicht mehr als die
seinigen behalten will, und daher verläßt, kann sich jedes Mitglied des
Staates eigen machen. Im Zweifel ist nicht zu vermuten, dass jemand sein
Eigentum aufgeben wolle; daher darf kein Finder eine gefundene Sache für
verlassen ansehen und sich diese zueignen.116)
§
387. Inwiefern Grundstücke wegen gänzlicher Unterlassung ihres
Anbaues, oder Gebäude wegen der unterlassenen Herstellung für verlassen
anzusehen, oder einzuziehen seien, bestimmen die politischen Gesetze.
Vorschriften über das Finden:
a) verlorener und
vergessener Sachen
§
388.
(1) Verloren sind
bewegliche, in niemandes Gewahrsame stehende Sachen, die ohne den Willen
des Inhabers aus seiner Gewalt gekommen sind.
(2) Vergessen sind
bewegliche Sachen, die ohne den Willen des Inhabers an einem fremden,
unter der Aufsicht eines anderen stehenden Ort zurückgelassen worden und
dadurch in fremde Gewahrsame gekommen sind.117)
§
389.
(1) Finder ist, wer
eine verlorene oder vergessene Sache entdeckt und an sich nimmt.
(2) Verlustträger
sind der Eigentümer und andere zur Innehabung der verlorenen oder
vergessenen Sache berechtigte Personen.118)
§
390. Der Finder hat den Fund unverzüglich der zuständigen
Fundbehörde (§
14 Abs. 5 SPG) unter Abgabe der gefundenen Sache anzuzeigen und über
alle für die Ausforschung eines Verlustträgers maßgeblichen Umstände
Auskunft zu geben.119)
§
391. Die Pflichten nach
§ 390
bestehen nicht, wenn
1. der Finder die
gefundene Sache einem Verlustträger vor der Anzeigeerstattung ausfolgt
oder
2. der gemeine Wert
der gefundenen Sache 10 Euro nicht übersteigt, es sei denn erkennbar, dass
die Wiedererlangung der Sache für einen Verlustträger von erheblicher
Bedeutung ist.120)
§
392. Der Finder hat gegen den, dem der Fundgegenstand ausgefolgt
wird, Anspruch auf Finderlohn und auf Ersatz des notwendig und zweckmäßig
gemachten Aufwandes.121)
§
393.
(1) Der Finderlohn
beträgt bei verlorenen Sachen 10 vH, bei vergessenen Sachen 5 vH des
gemeinen Wertes. Übersteigt der gemeine Wert 2 000 Euro, so beträgt der
Finderlohn in Rücksicht des Übermaßes die Hälfte dieser Hundertersätze.
(2) Bei
unschätzbaren Sachen und solchen, deren Wiedererlangung für den
Verlustträger von erheblicher Bedeutung ist, ist der Finderlohn nach
billigem Ermessen festzulegen; hierbei ist auf die Grundsätze des
Abs. 1, auf die dem Finder entstandene Mühe und auf den dem
Verlustträger durch die Wiedererlangung der gefundenen Sache verschafften
Vorteil Bedacht zu nehmen.122)
§
394. Ein Anspruch auf Finderlohn besteht nicht, wenn
1. die Sache von
einer Person im Rahmen ihrer privat- oder öffentlich-rechtlichen, die
Rettung der Sache umfassenden Pflicht gefunden worden ist oder
2. der Finder die
in den
§§ 390 und
391
enthaltenen Anordnungen schuldhaft verletzt hat oder
3. die vergessene
Sache auch sonst ohne deren Gefährdung wiedererlangt worden wäre.123)
§
395. Wird die Sache innerhalb eines Jahres von keinem
Verlustträger angesprochen, so erwirbt der Finder das Eigentum an der in
seiner Gewahrsame befindlichen Sache mit Ablauf der Frist, an der
abgegebenen Sache mit ihrer Ausfolgung an ihn. Die Frist beginnt im Fall
des
§ 391 Z 2 mit dem Zeitpunkt des Findens, sonst mit der Erstattung der
Anzeige (§
390).124)
§
396. Wer eine verlorene oder vergessene Sache entdeckt, sie aber
nicht an sich nehmen kann, hat Anspruch auf die Hälfte des im
§ 393
bestimmten Finderlohnes, wenn er die Entdeckung einer im
§ 390
bezeichneten Stelle anzeigt und der Verlustträger die Sache dadurch
wiedererlangt, es sei denn, dass dieser die Sache auch sonst ohne deren
Gefährdung wiedererlangt hätte.
§
394 Z 1 ist anzuwenden.125)
b) verborgener
Gegenstände
§
397.
(1) Werden
vergrabene, eingemauerte oder sonst verborgene Sachen eines unbekannten
Eigentümers entdeckt, so gilt sinngemäß das, was für die verlorenen Sachen
bestimmt ist.
(2) Der Finderlohn
ist auch dann nicht zu entrichten, wenn die Sache auch sonst ohne deren
Gefährdung wiedererlangt worden wäre.126)
c) eines Schatzes
§
398. Bestehen die entdeckten Sachen in Geld, Schmuck oder andern
Kostbarkeiten, die so lange im Verborgenen gelegen haben, daß man ihren
vorigen Eigentümer nicht mehr erfahren kann, dann heißen sie ein Schatz.
Die Entdeckung eines Schatzes ist von der Obrigkeit der Landesstelle
[nunmehr: dem Bundesdenkmalamt]
anzuzeigen.
§
399. Von einem Schatz erhalten der Finder und der Eigentümer des
Grundes je die Hälfte.127)
§
400. Wer sich dabei einer unerlaubten Handlung schuldig gemacht;
wer ohne Wissen und Willen des Nutzungseigentümers den Schatz aufgesucht;
oder den Fund verheimlicht hat; dessen Anteil soll dem Angeber; oder, wenn
kein Angeber vorhanden ist, dem Staate zufallen.
§
401. Finden Arbeitsleute zufälliger Weise einen Schatz, so gebührt
ihnen als Findern ein [Dritt]teil davon. Sind sie aber von dem Eigentümer
ausdrücklich zur Aufsuchung eines Schatzes gedungen worden, so müssen sie
sich mit ihrem ordentlichen Lohne begnügen.
3. von der Beute
§
402. Über das Recht der Beute und der von dem Feinde
zurückerbeuteten Sachen, sind die Vorschriften in den Kriegsgesetzen
enthalten.
Von dem Rechte aus
der Rettung einer fremden beweglichen Sache
§
403. Wer eine fremde bewegliche Sache von dem unvermeidlichen
Verluste oder Untergange rettet, ist berechtigt, von dem rückfordernden
Eigentümer den Ersatz seines Aufwandes, und eine verhältnismäßige
Belohnung von höchstens zehn von Hundert zu fordern.
Viertes Hauptstück
Von Erwerbung des Eigentumes durch Zuwachs
Zuwachs
§
404. Zuwachs heißt alles, was aus einer Sache entsteht, oder neu
zu derselben kommt, ohne daß es dem Eigentümer von jemand andern übergeben
worden ist. Der Zuwachs wird durch Natur, durch Kunst, oder durch beide
zugleich bewirkt.
I.
Natürlicher Zuwachs:
a) an Naturprodukten;
b) Werfen der Tiere;
§
405. Die natürlichen Früchte eines Grundes, nämlich solche
Nutzungen, die er, ohne bearbeitet zu werden, hervorbringt, als: Kräuter,
Schwämme und dergleichen, wachsen dem Eigentümer des Grundes, sowie alle
Nutzungen, welche aus einem Tiere entstehen, dem Eigentümer des Tieres zu.
§
406. Der Eigentümer eines Tieres, welches durch das Tier eines
andern befruchtet wird, ist diesem keinen Lohn schuldig, wenn er nicht
bedungen worden ist.
c) Inseln;
§
407. gegenstandslos
§
408. Werden bloß durch die Austrocknung des Gewässers, oder durch
desselben Teilung in mehrere Arme, Inseln gebildet, oder Grundstücke
überschwemmt; so bleiben die Rechte des vorigen Eigentumes unverletzt.
d) vom verlassenen
Wasserbette;
§
409. Wenn ein Gewässer sein Bett verläßt, so haben vor allem die
Grundbesitzer, welche durch den neuen Lauf des Gewässers Schaden leiden,
das Recht, aus dem verlassenen Bette oder dessen Werte entschädigt zu
werden.
§
410. gegenstandslos
e) vom Anspülen;
§
411. Das Erdreich, welches ein Gewässer unmerklich an ein Ufer
anspült, gehört dem Eigentümer des Ufers.
f) vom abgerissenen
Lande
§
412. Wird aber ein merklicher Erdteil durch die Gewalt des Flusses
an ein fremdes Ufer gelegt; so verliert der vorige Besitzer sein
Eigentumsrecht darauf nur in dem Falle, wenn er es in einer Jahresfrist
nicht ausübt.
§
413. Jeder Grundbesitzer ist befugt, sein Ufer gegen das Ausreißen
des Flusses zu befestigen. Allein niemand darf solche Werke oder
Pflanzungen anlegen, die den ordentlichen Lauf des Flusses verändern, oder
die der Schiffahrt, den Mühlen, der Fischerei oder andern fremden Rechten
nachteilig werden könnten. Überhaupt können ähnliche Anlagen nur mit
Erlaubnis der politischen Behörde gemacht werden.
II.
Künstlicher Zuwachs durch Verarbeitung oder Vereinigung überhaupt;
§
414. Wer fremde Sachen verarbeitet; wer sie mit den seinigen
vereinigt, vermengt, oder vermischt, erhält dadurch noch keinen Anspruch
auf das fremde Eigentum.
§
415. Können dergleichen verarbeitete Sachen in ihren vorigen Stand
zurückgebracht; vereinigte, vermengte oder vermischte Sachen wieder
abgesondert werden; so wird einem jeden Eigentümer das Seinige
zurückgestellt, und demjenigen Schadloshaltung geleistet, dem sie gebührt.
Ist die Zurücksetzung in den vorigen Stand, oder die Absonderung nicht
möglich, so wird die Sache den Teilnehmern gemein; doch steht demjenigen,
mit dessen Sache der andere durch Verschulden die Vereinigung vorgenommen
hat, die Wahl frei, ob er den ganzen Gegenstand gegen Ersatz der
Verbesserung behalten, oder ihn dem andern ebenfalls gegen Vergütung
überlassen wolle. Der Schuld tragende Teilnehmer wird nach Beschaffenheit
seiner redlichen oder unredlichen Absicht behandelt. Kann aber keinem
Teile ein Verschulden beigemessen werden, so bleibt dem, dessen Anteil
mehr wert ist, die Auswahl vorbehalten.
§
416. Werden fremde Materialien nur zur Ausbesserung einer Sache
verwendet, so fällt die fremde Materie dem Eigentümer der Hauptsache zu,
und dieser ist verbunden, nach Beschaffenheit seines redlichen oder
unredlichen Verfahrens, dem vorigen Eigentümer der verbrauchten
Materialien den Wert derselben zu bezahlen.
insbesondere bei
einem Baue
§
417. Wenn jemand auf eigenem Boden ein Gebäude aufführt, und
fremde Materialien dazu verwendet hat, so bleibt das Gebäude zwar sein
Eigentum; doch muß selbst ein redlicher Bauführer dem Beschädigten die
Materialien, wenn er sie außer den im
§ 367
angeführten Verhältnissen an sich gebracht hat, nach dem gemeinen; ein
unredlicher aber muß sie nach dem höchsten Preise, und überdies noch allen
anderweitigen Schaden ersetzen.
§
418. Hat im entgegengesetzten Falle jemand mit eigenen
Materialien, ohne Wissen und Willen des Eigentümers auf fremdem Grunde
gebaut, so fällt das Gebäude dem Grundeigentümer zu. Der redliche
Bauführer kann den Ersatz der notwendigen und nützlichen Kosten fordern;
der unredliche wird gleich einem Geschäftsführer ohne Auftrag behandelt.
Hat der Eigentümer des Grundes die Bauführung gewußt, und sie nicht
sogleich dem redlichen Bauführer untersagt, so kann er nur den gemeinen
Wert für den Grund fordern.
§
419. Ist das Gebäude auf fremdem Grunde, und aus fremden
Materialien entstanden, so wächst auch in diesem Falle das Eigentum
desselben dem Grundeigentümer zu. Zwischen dem Grundeigentümer und dem
Bauführer treten die nämlichen Rechte und Verbindlichkeiten, wie in dem
vorstehenden Paragraphen, ein, und der Bauführer muß dem vorigen
Eigentümer der Materialien, nach Beschaffenheit seiner redlichen oder
unredlichen Absicht, den gemeinen oder den höchsten Wert ersetzen.
III.
Vermischter Zuwachs
§
420. Was bisher wegen der mit fremden Materialien aufgeführten
Gebäude bestimmt worden ist, gilt auch für die Fälle, wenn ein Feld mit
fremden Samen besät, oder mit fremden Pflanzen besetzt worden ist. Ein
solcher Zuwachs gehört dem Eigentümer des Grundes, wenn anders die
Pflanzen schon Wurzel geschlagen haben.
§
421. Das Eigentum eines Baumes wird nicht nach den Wurzeln, die
sich in einem angrenzenden Grunde verbreiten, sondern nach dem Stamme
bestimmt, der aus dem Grunde hervorragt. Steht der Stamm auf den Grenzen
mehrerer Eigentümer so ist ihnen der Baum gemein.
§
422. Jeder Grundeigentümer kann die Wurzeln eines fremden Baumes
aus seinem Boden reißen, und die über seinem Luftraume hängenden Äste
abschneiden oder sonst benützen.
Fünftes Hauptstück
Von Erwerbung des Eigentumes durch Übergabe
Mittelbare Erwerbung
§
423. Sachen, die schon einen Eigentümer haben, werden mittelbar
erworben, indem sie auf eine rechtliche Art von dem Eigentümer auf einen
andern übergehen.
Titel derselben
§
424. Der Titel der mittelbaren Erwerbung liegt in einem Vertrage;
in einer Verfügung auf den Todesfall; in dem richterlichen Ausspruche;
oder, in der Anordnung des Gesetzes.
Mittelbare
Erwerbungsart
§
425. Der bloße Titel gibt noch kein Eigentum. Das Eigentum und
alle dingliche Rechte überhaupt können, außer den in dem Gesetze
bestimmten Fällen, nur durch die rechtliche Übergabe und Übernahme
erworben werden.
Arten der Übergabe:
1.
bei beweglichen Sachen:
a) körperliche
Übergabe;
§
426. Bewegliche Sachen können in der Regel nur durch körperliche
Übergabe von Hand zu Hand an einen andern übertragen werden.
b) Übergabe durch
Zeichen;
§
427. Bei solchen beweglichen Sachen aber, welche ihrer
Beschaffenheit nach keine körperliche Übergabe zulassen, wie bei
Schuldforderungen, Frachtgütern, bei einem Warenlager oder einer andern
Gesamtsache, gestattet das Gesetz die Übergabe durch Zeichen; indem der
Eigentümer dem Übernehmer die Urkunden, wodurch das Eigentum dargetan
wird, oder die Werkzeuge übergibt, durch die der Übernehmer in den Stand
gesetzt wird, ausschließend den Besitz der Sache zu ergreifen; oder, indem
man mit der Sache ein Merkmal verbindet, woraus jedermann deutlich
erkennen kann, daß die Sache einem andern überlassen worden ist.
c) durch Erklärung
§
428. Durch Erklärung wird die Sache übergeben, wenn der Veräußerer
auf eine erweisliche Art seinen Willen an den Tag legt, daß er die Sache
künftig im Namen des Übernehmers innehabe; oder, daß der Übernehmer die
Sache, welche er bisher ohne ein dingliches Recht innehatte, künftig aus
einem dinglichen Rechte besitzen solle.
Folge in Rücksicht
der übersendeten,
§
429. In der Regel werden überschickte Sachen erst dann für
übergeben gehalten, wenn sie der Übernehmer erhält; es wäre denn, daß
dieser die Überschickungsart selbst bestimmt oder genehmigt hätte.
oder, an mehrere
veräußerten Sachen
§
430. Hat ein Eigentümer eben dieselbe bewegliche Sache an zwei
verschiedene Personen, an eine mit, an die andere ohne Übergabe veräußert;
so gebührt sie derjenigen, welcher sie zuerst übergeben worden ist; doch
hat der Eigentümer dem verletzten Teile zu haften.
2.
Bei unbeweglichen Sachen und Bauwerken
§
431. Zur Übertragung des Eigentumes unbeweglicher Sachen muß das
Erwerbungsgeschäft in die dazu bestimmten öffentlichen Bücher eingetragen
werden. Diese Eintragung nennt man Einverleibung (Intabulation).
Insbesondere bei Erwerbung
a) durch Vertrag;
§
432. Zu diesem Zwecke muß über das Erwerbungsgeschäft eine
beglaubigte Urkunde in der zur Gültigkeit des Geschäftes vorgeschriebenen
Form oder eine öffentliche Urkunde ausgefertigt werden.
§
433. Die Urkunde muß die genaue Angabe der Personen, die das
Eigentum übergeben und übernehmen; der Liegenschaft, die übergeben werden
soll, mit ihren Bestandteilen; des Rechtsgrundes der Übergabe; ferner des
Ortes und der Zeit des Vertragsschlusses enthalten; und es muß von dem
Übergeber in dieser oder in einer besonderen Urkunde die ausdrückliche
Erklärung abgegeben werden, daß er in die Einverleibung einwillige.
§
434. Zur Übertragung des Eigentums an Liegenschaften, die in
keinem Grundbuche eingetragen sind, muß eine mit den Erfordernissen der
§§ 432
und 433
versehene Urkunde bei Gericht hinterlegt werden. An die Stelle der
Bewilligung der Einverleibung tritt die Erklärung der Einwilligung zur
Hinterlegung der Urkunde.
§
435. Dasselbe gilt auch für die Übertragung des Eigentums an
Bauwerken, die auf fremdem Grund in der Absicht aufgeführt sind, daß sie
nicht stets darauf bleiben sollen, soferne sie nicht Zugehör eines
Baurechtes sind.
b) durch Urteil und
andere gerichtliche Urkunden;
§
436. Wenn das Eigentum unbeweglicher Sachen oder eines Bauwerkes
zufolge rechtskräftigen Urteils, gerichtlicher Teilung oder Einantwortung
einer Erbschaft übertragen werden soll, ist ebenfalls die Einverleibung (§§
431 bis 433) oder die Hinterlegung der Urkunde (§§
434,
435) erforderlich.
oder c) durch
Vermächtnis
§
437. Ebenso ist es, um das Eigentum eines vermachten unbeweglichen
Gutes oder eines Bauwerkes zu erwerben, notwendig, daß die Sache dem
Vermächtnisnehmer gemäß
§§ 431
bis 435 übergeben werde.
Bedingte Aufzeichnung
in das öffentliche Buch; oder Vormerkung
§
438. Wenn derjenige, welcher das Eigentum einer unbeweglichen
Sache anspricht, darüber zwar eine glaubwürdige, aber nicht mit allen in
den §§ 434 und 435 [nunmehr:
§§ 432
und 433]
zur Einverleibung vorgeschriebenen Erfordernissen versehene Urkunde
besitzt; so kann er doch, damit ihm niemand ein Vorrecht abgewinne, die
bedingte Eintragung in das öffentliche Buch bewirken, welche Vormerkung
(Pränotation) genannt wird. Dadurch erhält er ein bedingtes
Eigentumsrecht, und er wird, sobald er zu Folge richterlichen Ausspruches
die Vormerkung gerechtfertigt hat, von der Zeit des nach gesetzlicher
Ordnung eingereichten Vormerkungsgesuches, für den wahren Eigentümer
gehalten.
§
439. [Die geschehene Vormerkung muß sowohl demjenigen, der sie
bewirkt hat, als auch seinem Gegner durch Zustellung zu eigenen Handen
bekannt gemacht werden.] Der Vormerkungswerber muß binnen vierzehn Tagen,
vom Tage der erhaltenen Zustellung, die ordentliche Klage zum Erweise des
Eigentumsrechtes einreichen; widrigenfalls soll die bewirkte Vormerkung
auf Ansuchen des Gegners gelöscht werden.
Vorschrift über die
Kollision der Einverleibungen
§
440. Hat der Eigentümer eben dieselbe unbewegliche Sache zwei
verschiedenen Personen überlassen; so fällt sie derjenigen zu, welche
früher die Einverleibung angesucht hat.
Folge der Erwerbung:
a) in Rücksicht des
Besitzes;
§
441. Sobald die Urkunde über das Eigentumsrecht in das öffentliche
Buch eingetragen ist, tritt der neue Eigentümer in den rechtmäßigen
Besitz.
b) der damit
verbundenen Rechte;
§
442. Wer das Eigentum einer Sache erwirbt, erlangt auch die damit
verbundenen Rechte. Rechte, die auf die Person des Übergebers
eingeschränkt sind, kann er nicht übergeben. Überhaupt kann niemand einem
andern mehr Recht abtreten, als er selbst hat.
c) Lasten
§
443. Mit dem Eigentume unbeweglicher Sachen werden auch die darauf
haftenden, in den öffentlichen Büchern angemerkten Lasten übernommen. Wer
diese Bücher nicht einsieht, leidet in allen Fällen für seine
Nachlässigkeit. Andere Forderungen und Ansprüche, die jemand an den
vorigen Eigentümer hat, gehen nicht auf den neuen Erwerber über.
Erlöschung des
Eigentumsrechtes
§
444. Das Eigentum überhaupt kann durch den Willen des Eigentümers;
durch das Gesetz, und durch richterlichen Ausspruch verloren gehen. Das
Eigentum der unbeweglichen Sachen aber wird nur durch die Löschung aus den
öffentlichen Büchern aufgehoben.
Ausdehnung dieser
Vorschriften auf andere dingliche Rechte
§
445. Nach den in diesem Hauptstücke über die Erwerbungs- und
Erlöschungsart des Eigentumsrechtes unbeweglicher Sachen gegebenen
Vorschriften hat man sich auch bei den übrigen, auf unbewegliche Sachen
sich beziehenden, dinglichen Rechten zu verhalten.
Form und Vorsichten
der Einverleibungen
§
446. Auf was Art und mit welchen Vorsichten überhaupt bei
Einverleibung dinglicher Rechte vorzugehen sei, ist in den über die
Einrichtung der Landtafeln und Grundbücher bestehenden besondern
Anordnungen enthalten.
Sechstes Hauptstück
Von dem Pfandrechte
Begriff von dem
Pfandrechte und Pfande
§
447. Das Pfandrecht ist das dingliche Recht, welches dem Gläubiger
eingeräumt wird, aus einer Sache, wenn die Verbindlichkeit zur bestimmten
Zeit nicht erfüllt wird, die Befriedigung zu erlangen. Die Sache, worauf
dem Gläubiger dieses Recht zusteht, heißt überhaupt ein Pfand.
Arten des Pfandes
§
448. Als Pfand kann jede Sache dienen, die im Verkehre steht. Ist
sie beweglich, so wird sie Handpfand, oder ein Pfand in enger Bedeutung
genannt; ist sie unbeweglich, so heißt sie eine Hypothek oder ein
Grundpfand.
Titel des
Pfandrechtes
§
449. Das Pfandrecht bezieht sich zwar immer auf eine gültige
Forderung, aber nicht jede Forderung gibt einen Titel zur Erwerbung des
Pfandrechtes. Dieser gründet sich auf das Gesetz; auf einen richterlichen
Ausspruch; auf einen Vertrag; oder den letzten Willen des Eigentümers.
§
450. Die Fälle, in welchen das Gesetz jemandem das Pfandrecht
einräumt, sind am gehörigen Orte dieses Gesetzbuches und bei dem Verfahren
in Konkursfällen angegeben. Inwiefern das Gericht ein Pfandrecht einräumen
könne, bestimmt die Gerichtsordnung. Soll durch die Einwilligung des
Schuldners oder eines Dritten, der seine Sache für ihn verhaftet, das
Pfandrecht erworben werden; so dienen die Vorschriften von Verträgen und
Vermächtnissen zur Richtschnur.
Erwerbungsart des Pfandrechtes:
a) durch körperliche
Übergabe;
b) durch Einverleibung oder gerichtliche Urkundenhinterlegung;
§
451.
(1) Um das
Pfandrecht wirklich zu erwerben, muß der mit einem Titel versehene
Gläubiger die verpfändete Sache, wenn sie beweglich ist, in Verwahrung
nehmen; und, wenn sie unbeweglich ist, seine Forderung auf die zur
Erwerbung des Eigentumes liegender Güter vorgeschriebene Art einverleiben
lassen. Der Titel allein gibt nur ein persönliches Recht zu der Sache,
aber kein dingliches Recht auf die Sache.
(2) Das Pfandrecht
an bücherlich nicht eingetragenen Liegenschaften (§
434) oder an Bauwerken (§
435) wird durch die gerichtliche Hinterlegung einer beglaubigten
Pfandbestellungsurkunde erworben. Die Urkunde muß die genaue Angabe des
Pfandgegenstandes und der Forderung mit einer ziffermäßig bestimmten
Geldsumme, bei einer verzinslichen Forderung auch die Höhe der Zinsen;
ferner die ausdrückliche Zustimmung des Verpfänders zu der gerichtlichen
Hinterlegung enthalten.
c) durch symbolische
Übergabe;
§
452. Bei Verpfändung derjenigen beweglichen Sachen, welche keine
körperliche Übergabe von Hand zu Hand zulassen, muß man sich, wie bei der
Übertragung des Eigentumes (§
427), solcher Zeichen bedienen, woraus jedermann die Verpfändung
leicht erfahren kann. Wer diese Vorsicht unterläßt, haftet für die
nachteiligen Folgen.
d) durch die
Vormerkung
§
453. Findet die Einverleibung einer Forderung in die öffentlichen
Bücher wegen Mangels gesetzmäßiger Förmlichkeit in der Urkunde nicht
statt; so kann sich der Gläubiger vormerken (pränotieren) lassen. Durch
diese Vormerkung erhält er ein bedingtes Pfandrecht, welches, wenn die
Forderung auf die oben
§§ 438
und 439
angeführte Art gerechtfertigt worden ist, von dem Zeitpunkte des nach
gesetzlicher Ordnung eingereichten Vormerkungsgesuches in ein unbedingtes
übergeht.
Erwerbung eines
Afterpfandes
§
454. Der Pfandinhaber kann sein Pfand, insoweit er ein Recht
darauf hat, einem Dritten wieder verpfänden, und insofern wird es zum
Afterpfande, wenn zugleich letzterer sich dasselbe übergeben, oder die
Afterverpfändung auf das Pfandrecht in die öffentlichen Bücher eintragen
läßt.
§
455. Wird der Eigentümer von der weiteren Verpfändung
benachrichtigt; so kann er seine Schuld nur mit Willen dessen, der das
Afterpfand hat, dem Gläubiger abführen, oder er muß sie gerichtlich
hinterlegen, sonst bleibt das Pfand dem Inhaber des Afterpfandes
verhaftet.
Verpfändung einer
fremden Sache
§
456. Wird eine fremde bewegliche Sache ohne Einwilligung des
Eigentümers verpfändet, so hat dieser in der Regel zwar das Recht, sie
zurückzufordern; aber in solchen Fällen, in welchen die Eigentumsklage
gegen einen redlichen Besitzer nicht statt hat (§
367), ist er verbunden, entweder den redlichen Pfandinhaber schadlos
zu halten, oder das Pfand fahren zu lassen, und sich mit dem Ersatzrechte
gegen den Verpfänder zu begnügen.
Objektiver Umfang des
Pfandrechtes
§
457. Das Pfandrecht erstreckt sich auf alle zu dem freien
Eigentume des Verpfänders gehörige Teile, auf Zuwachs und Zugehör des
Pfandes, folglich auch auf die Früchte, insolange sie noch nicht
abgesondert oder bezogen sind. Wenn also ein Schuldner einem Gläubiger
sein Gut, und einem andern später die Früchte desselben verpfändet; so ist
die spätere Verpfändung nur in Rücksicht auf die schon abgesonderten und
bezogenen Früchte wirksam.
Rechte und Verbindlichkeiten des Pfandgläubigers:
a) bei Entdeckung
eines unzureichenden Pfandes;
§
458. Wenn der Wert eines Pfandes durch Verschulden des
Pfandgebers, oder wegen eines erst offenbar gewordenen Mangels der Sache
zur Bedeckung der Schuld nicht mehr zureichend gefunden wird; so ist der
Gläubiger berechtigt, von dem Pfandgeber ein anderes angemessenes Pfand zu
fordern.
b) vor dem Verfalle;
§
459. Ohne Bewilligung des Pfandgebers darf der Gläubiger das
Pfandstück nicht benützen; er muß es vielmehr genau bewahren, und, wenn es
durch sein Verschulden in Verlust gerät, dafür haften. Geht es ohne sein
Verschulden verloren, so verliert er deswegen seine Forderung nicht.
§
460. Hat der Gläubiger das Pfand weiter verpfändet; so haftet er
selbst für einen solchen Zufall, wodurch das Pfand bei ihm nicht zu Grunde
gegangen oder verschlimmert worden wäre.
c) nach dem Verfalle
der Forderung
§
461. Wird der Pfandgläubiger nach Verlauf der bestimmten Zeit
nicht befriedigt; so ist er befugt, die Feilbietung des Pfandes
gerichtlich zu verlangen. Das Gericht hat dabei nach Vorschrift der
Gerichtsordnung zu verfahren.
§
462. Vor der Feilbietung des Gutes ist jedem darauf eingetragenen
Pfandgläubiger die Einlösung der Forderung, wegen welcher die Feilbietung
angesucht worden, zu gestatten.
§
463. Schuldner haben kein Recht, bei Versteigerung einer von ihnen
verpfändeten Sache mitzubieten.
§
464. Wird der Schuldbetrag aus dem Pfande nicht gelöst, so ersetzt
der Schuldner das Fehlende; ihm fällt aber auch das zu, was über den
Schuldbetrag gelöst wird.
§
465. Inwiefern ein Pfandgläubiger sich an sein Pfand zu halten
schuldig; oder, auf ein anderes Vermögen seines Schuldners zu greifen
berechtigt sei, bestimmt die Gerichtsordnung.
§
466. Hat der Schuldner während der Verpfändungszeit das Eigentum
der verpfändeten Sache auf einen andern übertragen; so steht dem Gläubiger
frei, erst sein persönliches Recht gegen den Schuldner, und dann seine
volle Befriedigung an der verpfändeten Sache zu suchen.
Erlöschung des
Pfandrechtes
§
467. Wenn die verpfändete Sache zerstört wird; wenn sich der
Gläubiger seines Rechtes darauf gesetzmäßig begibt; oder, wenn er sie dem
Schuldner ohne Vorbehalt zurückstellt; so erlischt zwar das Pfandrecht,
aber die Schuldforderung besteht noch.
§
468. Das Pfandrecht erlischt ferner mit der Zeit, auf welche es
eingeschränkt war, folglich auch mit dem zeitlichen Rechte des Pfandgebers
auf die verpfändete Sache; wenn anders dieser Umstand dem Gläubiger
bekannt war, oder aus den öffentlichen Büchern bekannt sein konnte.
§
469. Durch Tilgung der Schuld hört das Pfandrecht auf. Der
Pfandgeber ist aber die Schuld nur gegen dem zu tilgen verbunden, daß ihm
das Pfand zugleich zurückgestellt werde. Zur Aufhebung einer Hypothek ist
die Tilgung der Schuld allein nicht hinreichend. Ein Hypothekargut bleibt
so lange verhaftet, bis die Schuld aus den öffentlichen Büchern gelöscht
ist. Bis dahin kann der Eigentümer des Gutes auf Grund einer Quittung oder
einer anderen, das Erlöschen der Pfandschuld dartuenden Urkunde das
Pfandrecht auf eine neue Forderung übertragen, die den Betrag der
eingetragenen Pfandforderung nicht übersteigt.
§
469a. Bei Bestellung des Pfandrechtes kann auf dieses
Verfügungsrecht nicht verzichtet werden. Ist jedoch im öffentlichen Buch
ein der Hypothek im Rang nachfolgendes oder ihr gleichrangiges,
rechtsgeschäftlich bestelltes Recht eingetragen, so kann der Eigentümer
über die Hypothek nur dann verfügen, wenn er sich das Verfügungsrecht
gegenüber dem Buchberechtigten vertraglich vorbehalten hat und dieser
Vorbehalt im öffentlichen Buch bei der Hypothek angemerkt ist.
§
470. Wird nach Tilgung der Schuld (§
469) oder eingetretener Vereinigung (§
1446), bevor das Pfandrecht bücherlich gelöscht oder die Liegenschaft
oder das Pfandrecht übertragen worden ist, das Hypothekargut zwangsweise
versteigert oder dessen Zwangsverwaltung bewilligt, so ist bei Verteilung
des Erlöses auf dieses Pfandrecht keine Rücksicht zu nehmen. Nur insoweit
die durch das Pfandrecht gesicherte Forderung gegen einen Dritten noch
fortbesteht oder dem Eigentümer der Ersatz für deren Tilgung gebührt (§
1358), wird der darauf entfallende Teil dem Eigentümer zugewiesen.
Von dem
Retentionsrechte
§
471.
(1) Wer zur
Herausgabe einer Sache verpflichtet ist, kann sie zur Sicherung seiner
fälligen Forderungen wegen des für die Sache gemachten Aufwandes oder des
durch die Sache ihm verursachten Schadens mit der Wirkung zurückbehalten,
daß er zur Herausgabe nur gegen die Zug um Zug zu bewirkende Gegenleistung
verurteilt werden kann.
(2) Die Ausübung
des Zurückbehaltungsrechtes kann durch Sicherheitsleistung abgewendet
werden; Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen.
Siebentes Hauptstück
Von Dienstbarkeiten (Servituten)
Begriff des Rechtes
der Dienstbarkeit
§
472. Durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein Eigentümer
verbunden, zum Vorteile eines andern in Rücksicht seiner Sache etwas zu
dulden oder zu unterlassen. Es ist ein dingliches, gegen jeden Besitzer
der dienstbaren Sache wirksames, Recht.
Einteilung der
Dienstbarkeiten in Grunddienstbarkeiten und persönliche;
§
473. Wird das Recht der Dienstbarkeit mit dem Besitze eines
Grundstückes zu dessen vorteilhafteren oder bequemeren Benützung
verknüpft; so entsteht eine Grunddienstbarkeit; außer dem ist die
Dienstbarkeit persönlich.
in Feld- und
Haus-Servituten
§
474. Grunddienstbarkeiten setzen zwei Grundbesitzer voraus, deren
einem als Verpflichteten das dienstbare; dem andern als Berechtigten das
herrschende Gut gehört. Das herrschende Grundstück ist entweder zur
Landwirtschaft oder zu einem andern Gebrauche bestimmt; daher
unterscheidet man auch die Feld- und Haus-Servituten.
Gewöhnlichere Arten:
a) der
Haus-Servituten;
§
475.
(1) Die
Haus-Servituten sind gewöhnlich: 1. das Recht, eine Last seines Gebäudes
auf ein fremdes Gebäude zu setzen; 2. einen Balken oder Sparren in eine
fremde Wand einzufügen; 3. ein Fenster in der fremden Wand zu öffnen; es
sei des Lichtes oder der Aussicht wegen; 4. ein Dach oder einen Erker über
des Nachbars Luftraum zu bauen; 5. den Rauch durch des Nachbars
Schornstein zu führen; 6. die Dachtraufe auf fremden Grund zu leiten; 7.
Flüssigkeiten auf des Nachbars Grund zu gießen oder durchzuführen.
(2) Durch diese und
ähnliche Haus-Servituten wird ein Hausbesitzer befugt, etwas auf dem
Grunde seines Nachbars vorzunehmen, was dieser dulden muß.
§
476. Durch andere Haus-Servituten wird der Besitzer des
dienstbaren Grundes verpflichtet, etwas zu unterlassen, was ihm sonst zu
tun frei stand. Dergleichen sind: 8. sein Haus nicht zu erhöhen; 9. es
nicht niedriger zu machen; 10. dem herrschenden Gebäude Licht und Luft;
11. oder Aussicht nicht zu benehmen; 12. die Dachtraufe seines Hauses von
dem Grunde des Nachbars, dem sie zur Bewässerung seines Gartens oder zur
Füllung seiner Zisterne, oder auf eine andere Art nützlich sein kann,
nicht abzuleiten.
b) der
Feld-Servituten
§
477. Die vorzüglichen Feld-Servituten sind: 1. das Recht, einen
Fußsteig, Viehtrieb oder Fahrweg auf fremdem Grund und Boden zu halten; 2.
das Wasser zu schöpfen, das Vieh zu tränken, das Wasser ab- und
herzuleiten; 3. das Vieh zu hüten und zu weiden; 4. Holz zu fällen,
verdorrte Äste und Reiser zu sammeln, Eicheln zu lesen, Laub zu rechen; 5.
zu jagen, zu fischen, Vögel zu fangen; 6. Steine zu brechen, Sand zu
graben, Kalk zu brennen.
Arten der
persönlichen Dienstbarkeiten
§
478. Die persönlichen Servituten sind: der nötige Gebrauch einer
Sache; die Fruchtnießung; und die Wohnung.
Unregelmäßige und
Schein-Servituten
§
479. Es können aber auch Dienstbarkeiten, welche an sich
Grunddienstbarkeiten sind, der Person allein; oder, es können
Begünstigungen, die ordentlicher Weise Servituten sind, nur bloß auf
Widerrufen zugestanden werden. Die Abweichungen von der Natur einer
Servitut werden jedoch nicht vermutet; wer sie behauptet, dem liegt der
Beweis ob.
Erwerbung des Rechtes
der Dienstbarkeit.
Titel zur Erwerbung
§
480. Der Titel zu einer Servitut ist auf einem Vertrage; auf einer
letzten Willenserklärung; auf einem bei der Teilung gemeinschaftlicher
Grundstücke erfolgten Rechtsspruche; oder endlich, auf Verjährung
gegründet.
Erwerbungsart
§
481.
(1) Das dingliche
Recht der Dienstbarkeit kann an Gegenständen, die in den öffentlichen
Büchern eingetragen sind, nur durch die Eintragung in diese erworben
werden.
(2) An bücherlich
nicht eingetragenen Liegenschaften (§
434) oder an Bauwerken (§
435) wird das dingliche Recht durch die gerichtliche Hinterlegung
einer über die Einräumung der Dienstbarkeit errichteten beglaubigten
Urkunde; auf andere Sachen aber durch die oben (§§
426 bis 428) angegebenen Arten der Übergabe erworben.
Rechtsverhältnis bei
den Dienstbarkeiten.
Allgemeine Vorschriften über das Recht der Dienstbarkeit
§
482. Alle Servituten kommen darin überein, daß der Besitzer der
dienstbaren Sache in der Regel nicht verbunden ist, etwas zu tun; sondern
nur einem andern die Ausübung eines Rechtes zu gestatten, oder das zu
unterlassen, was er als Eigentümer sonst zu tun berechtigt wäre.
§
483. Daher muß auch der Aufwand zur Erhaltung und Herstellung der
Sache, welche zur Dienstbarkeit bestimmt ist, in der Regel von dem
Berechtigten getragen werden. Wenn aber diese Sache auch von dem
Verpflichteten benützt wird; so muß er verhältnismäßig zu dem Aufwande
beitragen, und nur durch die Abtretung derselben an den Berechtigten kann
er sich, auch ohne dessen Beistimmung, von dem Beitrage befreien.
§
484. Der Besitzer des herrschenden Gutes kann zwar sein Recht auf
die ihm gefällige Art ausüben; doch dürfen Servituten nicht erweitert, sie
müssen vielmehr, insoweit es ihre Natur und der Zweck der Bestellung
gestattet, eingeschränkt werden.
§
485. Keine Servitut läßt sich eigenmächtig von der dienstbaren
Sache absondern, noch auf eine andere Sache oder Person übertragen. Auch
wird jede Servitut insofern für unteilbar gehalten, als das auf dem
Grundstücke haftende Recht durch Vergrößerung, Verkleinerung oder
Zerstücklung desselben, abgesehen von dem im
§ 847
bezeichneten Falle, weder verändert noch geteilt werden kann.
§
486. Ein Grundstück kann mehrern Personen zugleich dienstbar sein,
wenn anders die ältern Rechte eines Dritten nicht darunter leiden.
Anwendung auf die
Grunddienstbarkeiten; insbesondere auf das Recht, eine Last, einen
Balken auf fremdem Gebäude zu haben, oder den Rauch durchzuführen
§
487. Nach den hier aufgestellten Grundsätzen sind die
Rechtsverhältnisse bei den besondern Arten der Servituten zu bestimmen.
Wer also die Last des benachbarten Gebäudes zu tragen; die Einfügung des
fremden Balkens an seiner Wand; oder, den Durchzug des fremden Rauches in
seinem Schornsteine zu dulden hat; der muß verhältnismäßig zur Erhaltung
der dazu bestimmten Mauer, Säule, Wand oder des Schornsteines beitragen.
Es kann ihm aber nicht zugemutet werden, daß er das herrschende Gut
unterstützen oder den Schornstein des Nachbars ausbessern lasse.
Fensterrecht
§
488. Das Fensterrecht gibt nur auf Licht und Luft Anspruch; die
Aussicht muß besonders bewilligt werden. Wer kein Recht zur Aussicht hat,
kann angehalten werden, das Fenster zu vergittern. Mit dem Fensterrechte
ist die Schuldigkeit verbunden, die Öffnung zu verwahren; wer diese
Verwahrung vernachlässigt, haftet für den daraus entstehenden Schaden.
Recht der Dachtraufe
§
489. Wer das Recht der Dachtraufe besitzt, kann das Regenwasser
auf das fremde Dach frei oder durch Rinnen abfließen lassen; er kann auch
sein Dach erhöhen; doch muß er solche Vorkehrungen treffen, daß dadurch
die Dienstbarkeit nicht lästiger werde. Ebenso muß er häufig gefallenen
Schnee zeitig hinwegräumen, wie auch die zum Abflusse bestimmten Rinnen
unterhalten.
Recht der Ableitung
des Regenwassers
§
490. Wer das Recht hat, das Regenwasser von dem benachbarten Dache
auf seinen Grund zu leiten, hat die Obliegenheit, für Rinnen, Wasserkästen
und andere dazu gehörige Anstalten die Auslagen allein zu bestreiten.
§
491. Erfordern die abzuführenden Flüssigkeiten Gräben und Kanäle;
so muß sie der Eigentümer des herrschenden Grundes errichten; er muß sie
auch ordentlich decken und reinigen, und dadurch die Last des dienstbaren
Grundes erleichtern.
Recht des Fußsteiges,
Viehtriebes und Fahrweges
§
492. Das Recht des Fußsteiges begreift das Recht in sich, auf
diesem Steige zu gehen, sich von Menschen tragen, oder andere Menschen zu
sich kommen zu lassen. Mit dem Viehtriebe ist das Recht, einen
Schiebkarren zu gebrauchen; und, mit dem Fahrwege das Recht, mit einem
oder mehreren Zügen zu fahren, verbunden.
§
493. Hingegen kann, ohne besondere Bewilligung, das Recht zu
gehen, nicht auf das Recht, zu reiten, oder sich durch Tiere tragen zu
lassen; weder das Recht des Viehtriebes auf das Recht, schwere Lasten über
den dienstbaren Grund zu schleifen; noch das Recht zu fahren, auf das
Recht, frei gelassenes Vieh darüber zu treiben, ausgedehnt werden.
§
494. Zur Erhaltung des Weges, der Brücken und Stege tragen
verhältnismäßig alle Personen oder Grundbesitzer, denen der Gebrauch
derselben zusteht, folglich auch der Besitzer des dienstbaren Grundes, so
weit bei, als er davon Nutzen zieht.
Raum hierzu
§
495. Der Raum für diese drei Servituten muß dem nötigen Gebrauche
und den Umständen des Ortes angemessen sein. Werden Wege und Steige durch
Überschwemmung oder durch einen andern Zufall unbrauchbar; so muß, bis zu
der Herstellung in den vorigen Stand, wenn nicht schon die politische
Behörde eine Vorkehrung getroffen hat, ein neuer Raum angewiesen werden.
Recht, Wasser zu
schöpfen
§
496. Mit dem Rechte, fremdes Wasser zu schöpfen, wird auch der
Zugang zu demselben gestattet.
Recht der
Wasserleitung
§
497. Wer das Recht hat, Wasser von fremdem Grunde auf den
seinigen; oder, von seinem Grunde auf fremden zu leiten, ist auch
berechtigt, die dazu nötigen Röhren, Rinnen und Schleusen auf eigene
Kosten anzulegen. Das nicht zu überschreitende Maß dieser Anlagen wird
durch das Bedürfnis des herrschenden Grundes festgesetzt.
Weiderecht
§
498. Ist bei Erwerbung des Weiderechtes die Gattung und die Anzahl
des Triebviehes; ferner die Zeit und das Maß des Genusses nicht bestimmt
worden; so ist der ruhige dreißigjährige Besitz zu schützen. In
zweifelhaften Fällen dienen folgende Vorschriften zur Richtschnur.
Gesetzliche Bestimmung:
a) über die Gattung
des Triebviehes;
§
499. Das Weiderecht erstreckt sich, insoweit die politischen, und
im Forstwesen gegebenen Verordnungen nicht entgegenstehen, auf jede
Gattung von Zug-, Rind- und Schafvieh, aber nicht auf Schweine und
Federvieh; ebensowenig in waldigen Gegenden auf Ziegen. Unreines,
ungesundes und fremdes Vieh ist stets von der Weide ausgeschlossen.
b) dessen Anzahl;
§
500. Hat die Anzahl des Triebviehes während der letzten dreißig
Jahre abgewechselt; so muß aus dem Triebe der drei ersten Jahre die
Mittelzahl angenommen werden. Erhellt auch diese nicht; so ist teils auf
den Umfang, teils auf die Beschaffenheit der Weide billige Rücksicht zu
nehmen, und dem Berechtigten wenigstens nicht gestattet, daß er mehr Vieh
auf der fremden Weide halte, als er mit dem auf dem herrschenden Grunde
erzeugten Futter durchwintern kann. Säugevieh wird nicht zur bestimmten
Anzahl gerechnet.
c) Triftzeit;
§
501. Die Triftzeit wird zwar überhaupt durch den in jeder
Feldmarke eingeführten unangefochtenen Gebrauch bestimmt: allein in keinem
Falle darf der vermöge politischer Bestimmungen geordnete
Wirtschaftsbetrieb durch die Behütung verhindert, oder erschwert werden.
d) Maß des Genusses
§
502. Der Genuß des Weiderechtes erstreckt sich auf keine andere
Benutzung. Der Berechtigte darf weder Gras mähen, noch in der Regel den
Eigentümer des Grundstückes von der Mitweide ausschließen, am wenigsten
aber die Substanz der Weide verletzen. Wenn ein Schade zu befürchten ist,
muß er sein Vieh von einem Hirten hüten lassen.
Anwendung dieser
Bestimmungen auf andere Servituten
§
503. Was bisher in Rücksicht auf das Weiderecht vorgeschrieben
worden, ist verhältnismäßig auch auf die Rechte des Tierfanges, des
Holzschlages, des Steinbrechens und die übrigen Servituten anzuwenden.
Glaubt jemand diese Rechte auf das Miteigentum gründen zu können; so sind
die darüber entstehenden Streitigkeiten nach den, in dem
Hauptstücke von
der Gemeinschaft des Eigentumes, enthaltenen Grundsätzen zu
entscheiden.
Persönliche Dienstbarkeiten; insbesondere:
1. das Recht des
Gebrauches;
§
504. Die Ausübung persönlicher Servituten wird, wenn nichts
anderes verabredet worden ist, nach folgenden Grundsätzen bestimmt: Die
Servitut des Gebrauches besteht darin, daß jemand befugt ist, eine fremde
Sache, ohne Verletzung der Substanz, bloß zu seinem Bedürfnisse zu
benützen.
Bestimmung in
Rücksicht der Nutzungen;
§
505. Wer also das Gebrauchsrecht einer Sache hat, der darf, ohne
Rücksicht auf sein übriges Vermögen, den seinem Stande, seinem Gewerbe,
und seinem Hauswesen angemessenen Nutzen davon ziehen.
§
506. Das Bedürfnis ist nach dem Zeitpunkte der Bewilligung des
Gebrauches zu bestimmen. Nachfolgende Veränderungen in dem Stande oder
Gewerbe des Berechtigten geben keinen Anspruch auf einen ausgedehnteren
Gebrauch.
der Substanz;
§
507. Der Berechtigte darf die Substanz der ihm zum Gebrauche
bewilligten Sache nicht verändern; er darf auch das Recht an keinen andern
übertragen.
und der Lasten;
§
508. Alle Benützungen, die sich ohne Störung des
Gebrauchsberechtigten aus der Sache schöpfen lassen, kommen dem Eigentümer
zustatten. Dieser ist aber verbunden, alle ordentlichen und
außerordentlichen, auf der Sache haftenden Lasten zu tragen, und sie auf
seine Kosten in gutem Stande zu erhalten. Nur wenn die Kosten denjenigen
Nutzen übersteigen, der dem Eigentümer übrig bleibt, muß der Berechtigte
den Überschuß tragen, oder vom Gebrauche abstehen.
2. der Fruchtnießung
§
509. Die Fruchtnießung ist das Recht eine fremde Sache, mit
Schonung der Substanz ohne alle Einschränkung zu genießen.
Inwiefern sie sich
auf verbrauchbare Sachen erstrecken könne
§
510. Verbrauchbare Sachen sind an sich selbst kein Gegenstand des
Gebrauches oder der Fruchtnießung, sondern nur ihr Wert. Mit dem baren
Gelde kann der Berechtigte nach Belieben verfügen. Wird aber ein bereits
anliegendes Kapital zum Fruchtgenusse oder Gebrauche bewilligt; so kann
der Berechtigte nur die Zinsen fordern.
Rechte und
Verbindlichkeiten des Fruchtnießers
§
511. Der Fruchtnießer hat ein Recht auf den vollen, sowohl
gewöhnlichen als ungewöhnlichen Ertrag; ihm gehört daher auch die mit
Beobachtung der bestehenden Bergwerks[ordnung] erhaltene reine Ausbeute
von Bergwerksanteilen, und das forstmäßig geschlagene Holz. Auf einen
Schatz, welcher in dem zur Fruchtnießung bestimmten Grunde gefunden wird,
hat er keinen Anspruch.
Insbesondere:
a) in Rücksicht der
auf der Sache haftenden Lasten;
§
512. Als ein reiner Ertrag kann aber nur das angesehen werden, was
nach Abzug aller nötigen Auslagen übrig bleibt. Der Fruchtnießer übernimmt
also alle Lasten, welche zur Zeit der bewilligten Fruchtnießung mit der
dienstbaren Sache verbunden waren, mithin auch die Zinsen der darauf
eingetragenen Kapitalien. Auf ihn fallen alle ordentlichen und
außerordentlichen, von der Sache zu leistenden Schuldigkeiten, insofern
sie aus den während der Dauer der Fruchtnießung gezogenen Nutzungen
bestritten werden können; er trägt auch die Kosten, ohne welche die
Früchte nicht erzielt werden.
b) der Erhaltung der
Sache;
§
513. Der Fruchtnießer ist verbunden, die dienstbare Sache als ein
guter Haushälter in dem Stande, in welchem er sie übernommen hat, zu
erhalten, und aus dem Ertrage die Ausbesserungen, Ergänzungen und
Herstellungen zu besorgen. Wird dessen ungeachtet der Wert der dienstbaren
Sache bloß durch den rechtmäßigen Genuß ohne Verschulden des Fruchtnießers
verringert; so ist er dafür nicht verantwortlich.
c) der Bauführungen;
§
514. Wenn der Eigentümer Bauführungen, die durch das Alter des
Gebäudes, oder durch einen Zufall notwendig gemacht werden, auf Anzeige
des Fruchtnießers auf seine Kosten besorgt; ist ihm der Fruchtnießer, nach
Maß der dadurch verbesserten Fruchtnießung, die Zinsen des verwendeten
Kapitals zu vergüten schuldig.
§
515. Kann oder will der Eigentümer dazu sich nicht verstehen; so
ist der Fruchtnießer berechtigt, entweder den Bau zu führen, und nach
geendigter Fruchtnießung, gleich einem redlichen Besitzer, den Ersatz zu
fordern; oder, für die durch Unterbleibung des Baues vermißte
Fruchtnießung, eine angemessene Vergütung zu verlangen.
§
516. Bauführungen, welche nicht notwendig, obgleich sonst zur
Vermehrung des Ertrages gedeihlich sind, ist der Fruchtnießer nicht
verbunden, ohne vollständige Entschädigung, zu gestatten.
d) der
Meliorationskosten
§
517. Was der Fruchtnießer ohne Einwilligung des Eigentümers zur
Vermehrung fortdauernder Nutzungen verwendet hat, kann er zurücknehmen;
eine Vergütung der aus der Verbesserung noch bestehenden Nutzungen aber
kann er nur fordern; insofern sie ein Geschäftsführer ohne Auftrag zu
fordern berechtigt ist.
Beweismittel darüber
§
518. Zur Erleichterung des Beweises der gegenseitigen Forderungen,
sollen der Eigentümer und der Fruchtnießer eine beglaubte Beschreibung
aller dienstbaren Sachen aufnehmen lassen. Ist sie unterlassen worden; so
wird vermutet, daß der Fruchtnießer die Sache samt allen zur ordentlichen
Benützung derselben erforderlichen Stücken in brauchbarem Zustande von
mittlerer Beschaffenheit erhalten habe.
Zuteilung der
Nutzungen bei Erlöschung der Fruchtnießung
§
519. Nach geendigter Fruchtnießung gehören die noch stehenden
Früchte dem Eigentümer; doch muß er die auf deren Erzielung verwendeten
Kosten dem Fruchtnießer oder dessen Erben, gleich einem redlichen
Besitzer, ersetzen. Auf andere Nutzungen haben der Fruchtnießer oder
dessen Erben den Anspruch nach Maß der Dauer der Fruchtnießung.
Inwiefern der
Gebrauchsberechtigte oder der Fruchtnießer zur Sicherstellung verbunden
sei
§
520. In der Regel kann der Eigentümer von dem
Gebrauchsberechtigten oder Fruchtnießer nur bei einer sich äußernden
Gefahr die Sicherstellung der Substanz verlangen. Wird sie nicht
geleistet; so soll die Sache entweder dem Eigentümer gegen eine billige
Abfindung überlassen, oder nach Umständen in gerichtliche Verwaltung
gegeben werden.
3. Dienstbarkeit der
Wohnung
§
521. Die Servitut der Wohnung ist das Recht, die bewohnbaren Teile
eines Hauses zu seinem Bedürfnisse zu benützen. Sie ist also eine Servitut
des Gebrauches von dem Wohngebäude. Werden aber jemandem alle bewohnbaren
Teile des Hauses, mit Schonung der Substanz, ohne Einschränkung zu
genießen überlassen; so ist es eine Fruchtnießung des Wohngebäudes.
Hiernach sind die oben gegebenen Vorschriften auf das rechtliche
Verhältnis zwischen dem Berechtigten und dem Eigentümer anzuwenden.
§
522. In jedem Falle behält der Eigentümer das Recht, über alle
Teile des Hauses, die nicht zur eigentlichen Wohnung gehören, zu verfügen;
auch darf ihm die nötige Aufsicht über sein Haus nicht erschwert werden.
Klagerecht in
Rücksicht der Servituten
§
523. In Ansehung der Servituten findet ein doppeltes Klagerecht
statt. Man kann gegen den Eigentümer das Recht der Servitut behaupten;
oder, der Eigentümer kann sich über die Anmaßung einer Servitut
beschweren. Im ersten Falle muß der Kläger die Erwerbung der Servitut oder
wenigstens den Besitz derselben als eines dinglichen Rechtes, im zweiten
Falle muß er die Anmaßung der Servitut in seiner Sache beweisen.
Erlöschung der Dienstbarkeiten.
Im
allgemeinen
§
524. Die Servituten erlöschen im allgemeinen auf diejenigen Arten,
wodurch nach dem
dritten und
vierten Hauptstücke des dritten Teiles Rechte und Verbindlichkeiten
überhaupt aufgehoben werden.
Besondere Anordnung bei deren Erlöschung:
a) durch den
Untergang des dienstbaren oder herrschenden Grundes;
§
525. Der Untergang des dienstbaren oder des herrschenden Grundes
stellt zwar die Dienstbarkeit ein; sobald aber der Grund, oder das Gebäude
wieder in den vorigen Stand gesetzt ist, erhält die Servitut wieder ihre
vorige Kraft.
b) durch Vereinigung;
§
526. Wenn das Eigentum des dienstbaren und des herrschenden
Grundes in einer Person vereinigt wird, hört die Dienstbarkeit von selbst
auf. Wird aber in der Folge einer dieser vereinigten Gründe wieder
veräußert, ohne daß inzwischen in den öffentlichen Büchern die
Dienstbarkeit gelöscht worden; so ist der neue Besitzer des herrschenden
Grundes befugt, die Servitut auszuüben.
c) durch Zeitverlauf
§
527. Hat das bloß zeitliche Recht desjenigen, der die Servitut
bestellt hat, oder die Zeit, auf welche sie beschränkt worden ist, dem
Servitutsinhaber aus öffentlichen Büchern, oder auf eine andere Art
bekannt sein können; so hört nach Verlauf dieser Zeit die Servitut von
selbst auf.
§
528. Eine Servitut, welche jemandem bis zur Zeit, da ein Dritter
ein bestimmtes Alter erreicht, verliehen wird, erlischt erst zu der
bestimmten Zeit, obschon der Dritte vor diesem Alter verstorben ist.
Erlöschung der
persönlichen Servituten insbesondere
§
529. Persönliche Servituten hören mit dem Tode auf. Werden sie
ausdrücklich auf die Erben ausgedehnt; so sind im Zweifel nur die ersten
gesetzlichen Erben darunter verstanden. Das einer Familie verliehene Recht
aber geht auf alle Mitglieder derselben über. Die von einer Gemeinde oder
einer andern moralischen Person erworbene persönliche Servitut dauert so
lange, als die moralische Person besteht.
Unanwendbarkeit auf
beständige Renten
§
530. Beständige jährliche Renten sind keine persönliche Servitut,
und können also ihrer Natur nach auf alle Nachfolger übertragen werden.
Achtes Hauptstück
Von dem Erbrechte
Verlassenschaft
§
531. Der Inbegriff der Rechte und Verbindlichkeiten eines
Verstorbenen, insofern sie nicht in bloß persönlichen Verhältnissen
gegründet sind, heißt desselben Verlassenschaft oder Nachlaß.
Erbrecht und
Erbschaft
§
532. Das ausschließende Recht, die ganze Verlassenschaft, oder
einen in Beziehung auf das Ganze bestimmten Teil derselben (z. B. die
Hälfte, ein Dritteil) in Besitz zu nehmen, heißt Erbrecht. Es ist ein
dingliches Recht, welches gegen einen jeden, der sich der Verlassenschaft
anmaßen will, wirksam ist. Derjenige, dem das Erbrecht gebührt, wird Erbe,
und die Verlassenschaft, in Beziehung auf den Erben, Erbschaft genannt.
Titel zu dem
Erbrechte
§
533. Das Erbrecht gründet sich auf den nach gesetzlicher
Vorschrift erklärten Willen des Erblassers; auf einen nach dem Gesetze
zulässigen Erbvertrag (§
602), oder auf das Gesetz.
§
534. Die erwähnten drei Arten des Erbrechtes können auch
nebeneinander bestehen, so daß einem Erben ein in Beziehung auf das Ganze
bestimmter Teil aus dem letzten Willen, dem andern aus dem Vertrage, und
einem dritten aus dem Gesetze gebührt.
Unterschied zwischen
Erbschaft und Vermächtnis
§
535. Wird jemanden kein solcher Erbteil, der sich auf den ganzen
Nachlaß bezieht; sondern nur eine einzelne Sache, eine oder mehrere Sachen
von gewisser Gattung; eine Summe; oder ein Recht zugedacht; so heißt das
Zugedachte, obschon dessen Wert den größten Teil der Verlassenschaft
ausmacht, ein Vermächtnis (Legat), und derjenige, dem es hinterlassen
worden, ist nicht als ein Erbe, sondern nur als ein Vermächtnisnehmer
(Legatar) zu betrachten.
Zeitpunkt des
Erbanfalles
§
536. Das Erbrecht tritt erst nach dem Tode des Erblassers ein.
Stirbt ein vermeintlicher Erbe vor dem Erblasser; so hat er das noch nicht
erlangte Erbrecht auch nicht auf seine Erben übertragen können.
§
537. Hat der Erbe den Erblasser überlebt; so geht das Erbrecht
auch vor Übernahme der Erbschaft, wie andere frei vererbliche Rechte, auf
seine Erben über; wenn es anders durch Entsagung, oder auf eine andere Art
noch nicht erloschen war.
Fähigkeit zu erben
§
538. Wer ein Vermögen zu erwerben berechtigt ist, kann in der
Regel auch erben. Hat jemand dem Rechte etwas zu erwerben überhaupt
entsagt, oder auf eine bestimmte Erbschaft gültig Verzicht getan; so ist
er dadurch des Erbrechtes überhaupt, oder des Rechtes auf eine bestimmte
Erbschaft verlustig geworden.
§
539. Inwiefern geistliche Gemeinden, oder deren Glieder erbfähig
sind, bestimmen die politischen Vorschriften.
Ursachen der
Unfähigkeit
§
540. Wer gegen den Erblasser eine gerichtlich strafbare Handlung,
die nur vorsätzlich begangen werden kann und mit mehr als einjähriger
Freiheitsstrafe bedroht ist, begangen oder seine aus dem Rechtsverhältnis
zwischen Eltern und Kindern sich ergebenden Pflichten dem Erblasser
gegenüber gröblich vernachlässigt hat, ist so lange des Erbrechts
unwürdig, als sich nicht aus den Umständen entnehmen läßt, daß ihm der
Erblasser vergeben habe.
§
541. Bei gesetzlicher Erbfolge sind die Nachkommen desjenigen,
welcher sich des Erbrechtes unwürdig gemacht hat, an dessen Stelle zur
Erbfolge berufen, wenngleich er den Erblasser überlebt hat.
§
542. Wer den Erblasser zur Erklärung des letzten Willens
gezwungen, oder betrüglicher Weise verleitet, an der Erklärung, oder
Abänderung des letzten Willens gehindert, oder einen von ihm bereits
errichteten letzten Willen unterdrückt hat, ist von dem Erbrechte
ausgeschlossen, und bleibt für allen einem Dritten dadurch zugefügten
Schaden verantwortlich.
§
543. Personen, welche des Ehebruches, oder der Blutschande
gerichtlich geständig, oder überwiesen sind, werden unter sich von dem
Erbrechte aus einer Erklärung des letzten Willens ausgeschlossen.
§
544. Inwiefern Landeseingeborene, die ihr Vaterland oder die
Kriegsdienste ohne ordentliche Erlaubnis verlassen haben, des Erbrechtes
verlustig werden, bestimmen die politischen Verordnungen.
Nach welchem
Zeitpunkte die Fähigkeit zu beurteilen
§
545. Die Erbfähigkeit kann nur nach dem Zeitpunkte des wirklichen
Erbanfalles bestimmt werden. Dieser Zeitpunkt ist in der Regel der Tod des
Erblassers (§
703).
§
546. Eine später erlangte Erbfähigkeit gibt kein Recht, andern das
zu entziehen, was ihnen bereits rechtmäßig angefallen ist.
Wirkung der Annahme
der Erbschaft
§
547. Der Erbe stellt, sobald er die Erbschaft angenommen hat, in
Rücksicht auf dieselbe den Erblasser vor. Beide werden in Beziehung auf
einen Dritten für eine Person gehalten. Vor der Annahme des Erben wird die
Verlassenschaft so betrachtet, als wenn sie noch von dem Verstorbenen
besessen würde.
§
548. Verbindlichkeiten, die der Erblasser aus seinem Vermögen zu
leisten gehabt hätte, übernimmt sein Erbe. Die von dem Gesetze verhängten
Geldstrafen, wozu der Verstorbene noch nicht verurteilt war, gehen nicht
auf den Erben über.
§
549. Zu den auf einer Erbschaft haftenden Lasten gehören auch die
Kosten für das dem Gebrauche des Ortes, dem Stande und dem Vermögen des
Verstorbenen angemessene Begräbnis.
§
550. Mehrere Erben werden in Ansehung ihres gemeinschaftlichen
Erbrechtes für eine Person angesehen. Sie stehen in dieser Eigenschaft vor
der gerichtlichen Übergabe (Einantwortung) der Erbschaft alle für einen
und einer für alle. Inwiefern sie nach der erfolgten Übergabe zu haften
haben, wird in dem
Hauptstücke von
der Besitznehmung der Erbschaft bestimmt.
Verzicht auf das
Erbrecht
§
551. Wer über sein Erbrecht gültig verfügen kann, ist auch befugt,
durch Vertrag mit dem Erblasser im voraus darauf Verzicht zu tun. Der
Vertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der Aufnahme eines Notariatsaktes oder
der Beurkundung durch gerichtliches Protokoll. Eine solche
Verzichtleistung wirkt, wenn nichts anderes vereinbart ist, auch auf die
Nachkommen.
Neuntes Hauptstück
Von der Erklärung des letzten Willens überhaupt und den Testamenten
insbesondere
Erklärung des letzten
Willens
§
552. Die Anordnung, wodurch ein Erblasser sein Vermögen, oder
einen Teil desselben einer oder mehrern Personen widerruflich auf den
Todesfall überläßt, heißt eine Erklärung des letzten Willens.
Erfordernisse: I.
Innere Form
§
553. Wird in einer letzten Anordnung ein Erbe eingesetzt, so heißt
sie Testament; enthält sie aber nur andere Verfügungen, so heißt sie
Kodizill.
Zuteilung der Erbschaft:
a) wenn nur ein Erbe;
§
554. Hat der Erblasser einen einzigen Erben, ohne ihn auf einen
Teil der Verlassenschaft zu beschränken, unbestimmt eingesetzt; so erhält
er den ganzen Nachlaß. Ist aber dem einzigen Erben nur ein in Beziehung
auf das Ganze bestimmter Erbteil ausgemessen worden; so fallen die übrigen
Teile den gesetzlichen Erben zu.
b) wenn mehrere ohne
Teilung;
§
555. Sind ohne Vorschrift einer Teilung mehrere Erben eingesetzt
worden, so teilen sie zu gleichen Teilen.
c) wenn alle in
bestimmten Teilen;
§
556. Sind mehrere Erben und zwar alle in bestimmten Erbteilen, die
aber das Ganze nicht erschöpfen, eingesetzt worden, so fallen die übrigen
Teile den gesetzlichen Erben zu. Hat aber der Erblasser die Erben zum
ganzen Nachlasse berufen; so haben die gesetzlichen Erben keinen Anspruch,
obschon er in der Berechnung der Beträge, oder in der Aufzählung der
Erbstücke etwas übergangen hätte.
d) wenn einige mit
Teilen, andere ohne Teile eingesetzt sind
§
557. Wird unter mehrern eingesetzten Erben einigen ein bestimmter
Teil (z. B. ein Dritteil, ein Sechsteil), andern aber nichts Bestimmtes
ausgemessen; so erhalten diese den übrigen Nachlaß zu gleichen Teilen.
§
558. Bleibt nichts übrig, so muß von sämtlichen bestimmten Teilen
für den unbestimmt eingesetzten Erben verhältnismäßig so viel abgezogen
werden, daß er einen gleichen Anteil mit demjenigen erhalte, der am
geringsten bedacht worden ist. Sind die Teile der Erben gleich groß, so
haben sie an den unbestimmt eingesetzten Erben so viel abzugeben, daß er
einen gleichen Anteil mit ihnen empfange. In allen andern Fällen, wo ein
Erblasser sich verrechnet hat, ist die Teilung auf eine Art vorzunehmen,
wodurch der Wille des Erblassers nach den über das Ganze erklärten
Verhältnissen auf das möglichste erfüllt wird.
Welche Erben als eine
Person betrachtet werden
§
559. Treffen unter den eingesetzten Erben solche Personen
zusammen, wovon einige bei der gesetzlichen Erbfolge gegen die übrigen als
eine Person angesehen werden müssen (z. B. die Bruderskinder gegen den
Bruder des Erblassers); so werden sie auch bei der Teilung aus dem
Testamente nur als eine Person betrachtet. Ein Körper, eine Gemeinde, eine
Versammlung (z. B. die Armen) werden immer nur für eine Person gerechnet.
Recht des Zuwachses
§
560. Wenn alle Erben ohne Bestimmung der Teile, oder in dem
allgemeinen Ausdrucke einer gleichen Teilung zur Erbschaft berufen werden,
und es kann, oder will einer der Erben von seinem Erbrechte keinen
Gebrauch machen; so wächst der erledigte Teil den übrigen eingesetzten
Erben zu.
§
561. Sind ein oder mehrere Erben mit, ein anderer oder mehrere
ohne Bestimmung des Erbteiles eingesetzt; so wächst der erledigte Teil nur
dem einzelnen, oder den mehrern noch übrigen, unbestimmt eingesetzten
Erben zu.
§
562. Einem bestimmt eingesetzten Erben gebührt in keinem Falle das
Zuwachsrecht. Wenn also kein unbestimmt eingesetzter Erbe übrig ist; so
fällt ein erledigter Erbteil nicht einem noch übrigen, für einen
bestimmten Teil eingesetzten, sondern dem gesetzlichen Erben zu.
§
563. Wer den erledigten Erbteil erhält, übernimmt auch die damit
verknüpften Lasten, insofern sie nicht auf persönliche Handlungen des
eingesetzten Erben eingeschränkt sind.
§
564. Der Erblasser muß den Erben selbst einsetzen; er kann dessen
Ernennung nicht dem Ausspruche eines Dritten überlassen.
Die Erklärung muß
überlegt, bestimmt und frei sein
§
565. Der Wille des Erblassers muß bestimmt, nicht durch bloße
Bejahung eines ihm gemachten Vorschlages; er muß im Zustande der vollen
Besonnenheit, mit Überlegung und Ernst, frei von Zwang, Betrug, und
wesentlichem Irrtume erklärt werden.
Ursachen der Unfähigkeit zu testieren;
1. Mangel der
Besonnenheit
§
566. Wird bewiesen, daß die Erklärung in einem die hiefür
erforderliche Besonnenheit ausschließenden Zustand, wie dem einer
psychischen Krankheit, einer geistigen Behinderung oder der Trunkenheit,
geschehen sei, so ist sie ungültig.
§
567. Wenn behauptet wird, daß der Erblasser, welcher den Gebrauch
des Verstandes verloren hatte, zur Zeit der letzten Anordnung bei voller
Besonnenheit gewesen sei; so muß die Behauptung durch Kunstverständige,
oder durch obrigkeitliche Personen, die den Gemütszustand des Erblassers
genau erforschten, oder durch andere zuverlässige Beweise außer Zweifel
gesetzt werden.
§
568. 128)
Personen, denen ein Sachwalter nach
§ 273
bestellt ist, können nur mündlich vor Gericht oder mündlich notariell
testieren. Das Gericht muss sich durch eine angemessene Erforschung zu
überzeugen suchen, dass die Erklärung des letzten Willens frei und mit
Überlegung geschehe. Die Erklärung muss in ein Protokoll aufgenommen, und
dasjenige, was sich aus der Erforschung ergeben hat, beigerückt werden.
3. unreifes Alter;
§
569. 129)
Unmündige sind zu testieren unfähig. Minderjährige können nur mündlich vor
Gericht oder mündlich notariell testieren.
§ 568
zweiter und dritter Satz gelten entsprechend.
4. wesentlicher
Irrtum;
§
570. Ein wesentlicher Irrtum des Erblassers macht die Anordnung
ungültig. Der Irrtum ist wesentlich, wenn der Erblasser die Person, welche
er bedenken, oder den Gegenstand, welchen er vermachen wollte, verfehlt
hat.
§
571. Zeigt sich, daß die bedachte Person, oder die vermachte Sache
nur unrichtig benannt, oder beschrieben worden, so ist die Verfügung
gültig.
§
572. Auch wenn der von dem Erblasser angegebene Beweggrund falsch
befunden wird, bleibt die Verfügung gültig; es wäre denn erweislich, daß
der Wille des Erblassers einzig und allein auf diesem irrigen Beweggrunde
beruht habe.
5. Ordensgelübde;
§
573. Ordenspersonen sind in der Regel nicht befugt, zu testieren:
allein, wenn der Orden eine besondere Begünstigung, daß seine Glieder
testieren können, erlangt hat; wenn Ordenspersonen die Auflösung von den
Gelübden erhalten haben; wenn sie durch Aufhebung ihres Ordens, Stiftes
oder Klosters aus ihrem Stande getreten sind; oder, wenn sie in einem
solchen Verhältnisse angestellt sind, daß sie vermöge der politischen
Verordnungen nicht mehr als Angehörige des Ordens, Stiftes oder Klosters
angesehen werden, sondern vollständiges Eigentum erwerben können; so ist
es ihnen erlaubt, durch Erklärung des letzten Willens darüber zu verfügen.
6. schwere
Kriminalstrafe;
§
574. aufgehoben
Zeitpunkt der
Gültigkeit der Anordnung
§
575. Ein rechtsgültig erklärter letzter Wille kann durch später
eintretende Hindernisse seine Gültigkeit nicht verlieren.
§
576. Einen anfänglich ungültigen letzten Willen macht die später
erfolgte Aufhebung des Hindernisses nicht gültig. Wird in diesem Falle
keine neue Verfügung getroffen; so tritt das gesetzliche Erbrecht ein.
II. Äußere Form der
Erklärungen des letzten Willens;
§
577. Man kann außergerichtlich oder gerichtlich, schriftlich oder
mündlich; schriftlich aber mit, oder ohne Zeugen testieren.
1. der
außergerichtlichen schriftlichen;
§
578. Wer schriftlich, und ohne Zeugen testieren will, der muß das
Testament oder Kodizill eigenhändig schreiben, und eigenhändig mit seinem
Namen unterfertigen. Die Beisetzung des Tages, des Jahres, und des Ortes,
wo der letzte Wille errichtet wird, ist zwar nicht notwendig, aber zur
Vermeidung der Streitigkeiten rätlich.
§
579. Einen letzten Willen, welchen der Erblasser von einer anderen
Person niederschreiben ließ, muß er eigenhändig unterfertigen. Er muß
ferner vor drei fähigen Zeugen, wovon wenigstens zwei zugleich gegenwärtig
sein müssen, ausdrücklich erklären, daß der Aufsatz seinen letzten Willen
enthalte. Endlich müssen sich auch die Zeugen, entweder inwendig oder von
außen, immer aber auf der Urkunde selbst, und nicht etwa auf einem
Umschlag, mit einem auf ihre Eigenschaft als Zeugen hinweisenden Zusatz
unterschreiben. Den Inhalt des Testaments hat der Zeuge zu wissen nicht
nötig.
§
580. Ein Erblasser, welcher nicht schreiben kann, muß nebst
Beobachtung der in dem vorigen Paragraphen vorgeschriebenen
Förmlichkeiten, anstatt der Unterschrift sein Handzeichen, und zwar in
Gegenwart aller drei Zeugen, eigenhändig beisetzen. Zur Erleichterung
eines bleibenden Beweises, wer der Erblasser sei, ist es auch vorsichtig,
daß einer der Zeugen den Namen des Erblassers als Namensunterfertiger
beisetze.
§
581. Wenn der Erblasser nicht lesen kann, so muß er den Aufsatz
von einem Zeugen in Gegenwart der anderen zwei Zeugen, die den Inhalt
eingesehen haben, sich vorlesen lassen, und bekräftigen, daß derselbe
seinem Willen gemäß sei. Der Schreiber des letzten Willens kann in allen
Fällen zugleich Zeuge sein, ist aber, wenn der Erblasser nicht lesen kann,
von der Vorlesung des Aufsatzes ausgeschlossen.
§
582. Eine Verfügung des Erblassers durch Beziehung auf einen
Zettel oder auf einen Aufsatz, ist nur dann von Wirkung, wenn ein solcher
Aufsatz mit allen zur Gültigkeit einer letzten Willenserklärung nötigen
Erfordernissen versehen ist. Außerdem können dergleichen von dem Erblasser
angezeigte schriftliche Bemerkungen nur zur Erläuterung seines Willens
angewendet werden.
§
583. In der Regel gilt ein und derselbe Aufsatz nur für einen
Erblasser. Die Ausnahme in Rücksicht der Ehegatten ist in dem
Hauptstücke von
den Ehepakten enthalten.
§
584. Einem Erblasser, welcher die zu einem schriftlichen
Testamente erforderlichen Förmlichkeiten nicht beobachten kann, oder will,
steht frei, ein mündliches Testament zu errichten.
2. der
außergerichtlichen mündlichen;
§
585. Wer mündlich testiert, muß vor drei fähigen Zeugen, welche
zugleich gegenwärtig, und zu bestätigen fähig sind, daß in der Person des
Erblassers kein Betrug oder Irrtum unterlaufen sei, ernstlich seinen
letzten Willen erklären. Es ist zwar nicht notwendig, aber vorsichtig, daß
die Zeugen entweder alle gemeinschaftlich, oder ein jeder für sich zur
Erleichterung des Gedächtnisses, die Erklärung des Erblassers entweder
selbst aufzeichnen, oder, sobald als möglich, aufzeichnen lassen.
§
586. Eine mündliche letzte Anordnung muß auf Verlangen eines
jeden, dem daran gelegen ist, durch die übereinstimmende eidliche Aussage
der drei Zeugen oder, wofern einer aus ihnen nicht eidlich vernommen
werden kann, wenigstens der zwei übrigen bestätigt werden, widrigens diese
Erklärung des letzten Willens unwirksam ist (§
601).
3. der gerichtlichen
§
587. Der Erblasser kann auch vor einem Gerichte schriftlich oder
mündlich testieren. Die schriftliche Anordnung muß von dem Erblasser
wenigstens eigenhändig unterschrieben sein, und dem Gerichte persönlich
übergeben werden. Das Gericht hat den Erblasser auf den Umstand, daß seine
eigenhändige Unterschrift beigerückt sein müsse, aufmerksam zu machen,
dann den Aufsatz gerichtlich zu versiegeln, und auf dem Umschlage
anzumerken, wessen letzter Wille darin enthalten sei. Über das Geschäft
ist ein Protokoll aufzunehmen, und der Aufsatz gegen Ausstellung eines
Empfangscheines gerichtlich zu hinterlegen.
§
588. Will der Erblasser seinen Willen mündlich erklären; so ist
die Erklärung in ein Protokoll aufzunehmen, und dasselbe ebenso, wie in
dem vorhergehenden Paragraphen von dem schriftlichen Aufsatze gemeldet
worden ist, versiegelt zu hinterlegen.
§
589. Das Gericht, welches die schriftliche oder mündliche
Erklärung des letzten Willens aufnimmt, muß wenigstens aus zwei eidlich
verpflichteten Gerichtspersonen bestehen, deren einer in dem Orte, wo die
Erklärung aufgenommen wird, das Richteramt zusteht. Die Zeugenschaft der
zweiten Gerichtsperson, außer dem Richter, können auch zwei andere Zeugen
vertreten.
§
590. Im Notfalle können die erst bestimmten Personen sich in die
Wohnung des Erblassers begeben, seinen letzten Willen schriftlich oder
mündlich aufnehmen, und dann das Geschäft mit Beisetzung des Tages, Jahres
und Ortes zu Protokoll bringen.
Unfähige Zeugen bei
letzten Anordnungen
§
591. Personen unter achtzehn Jahren, Personen, denen auf Grund
einer Behinderung die Fähigkeit fehlt, entsprechend der jeweiligen
Testamentsform den letzten Willen des Erblassers zu bezeugen, sowie
diejenigen, welche die Sprache des Erblassers nicht verstehen, können bei
letzten Anordnungen nicht Zeugen sein.
§
592. aufgehoben
§
593. aufgehoben
§
594. Ein Erbe oder Legatar ist in Rücksicht des ihm zugedachten
Nachlasses kein fähiger Zeuge, und ebensowenig dessen Gatte, Eltern,
Kinder, Geschwister, oder in eben dem Grade verschwägerte Personen und die
besoldeten Hausgenossen. Die Verfügung muß, um gültig zu sein, von dem
Erblasser eigenhändig geschrieben; oder, durch drei von den gedachten
Personen verschiedene Zeugen bestätigt werden.
§
595. Wenn der Erblasser demjenigen, welcher den letzten Willen
schreibt, oder dessen Ehegatten, Kindern, Eltern, Geschwistern, oder in
eben dem Grade verschwägerten Personen einen Nachlaß bestimmt; so muß die
Anordnung auf die im vorhergehenden Paragraphen erwähnte Art außer Zweifel
gesetzt sein.
§
596. Was von der Unbefangenheit und Fähigkeit des Zeugen, die
Person des Erblassers außer Zweifel zu setzen, verordnet wird, ist auch
auf die gerichtlichen Personen, die einen letzten Willen aufnehmen,
anzuwenden.
Von den begünstigten
letzten Anordnungen
§
597. Bei letzten Anordnungen, welche auf Schiffahrten und in
Orten, wo die Pest oder ähnliche ansteckende Seuchen herrschen, errichtet
werden, sind auch Personen, die das vierzehnte Jahr zurückgelegt haben,
gültige Zeugen.
§
598. Zu diesen begünstigten letzten Anordnungen werden nur zwei
Zeugen erfordert, wovon einer das Testament schreiben kann. Bei Gefahr
einer Ansteckung ist auch nicht nötig, daß beide zugleich gegenwärtig
seien.
§
599. Sechs Monate nach geendigter Schiffahrt oder Seuche verlieren
die begünstigten letzten Willenserklärungen ihre Kraft.
§
600. [Die Begünstigungen der Militär-Testamente sind in den
Militär-Gesetzen enthalten.]
Ungültigkeit der
unförmlichen letzten Anordnungen
§
601. Wenn der Erblasser eines der hier vorgeschriebenen, und nicht
ausdrücklich der bloßen Vorsicht überlassenen Erfordernisse nicht
beobachtet hat; so ist die letzte Willenserklärung ungültig.
Erbverträge sind nur
unter Ehegatten gültig
§
602. Erbverträge über die ganze Verlassenschaft, oder einen in
Beziehung auf das Ganze bestimmten Teil derselben, können nur unter
Ehegatten gültig geschlossen werden. Die Vorschriften hierüber sind in dem
Hauptstücke von
den Ehepakten enthalten.
Von Schenkungen auf
den Todesfall. Beziehung
§
603. Inwiefern eine Schenkung auf den Todesfall als ein Vertrag,
oder als ein letzter Wille zu betrachten sei, wird in dem
Hauptstücke von
den Schenkungen bestimmt.
Zehntes Hauptstück
Von Nacherben [und Fideikommissen]
Gemeine Substitution
§
604. Jeder Erblasser kann für den Fall, daß der eingesetzte Erbe
die Erbschaft nicht erlangt, einen; und wenn auch dieser sie nicht
erlangt, einen zweiten, und im gleichen Falle einen dritten, oder auch
noch mehrere Nacherben berufen. Diese Anordnung heißt eine gemeine
Substitution. Der in der Reihe zunächst Berufene wird Erbe.
§
605. Hat der Erblasser aus den bestimmten Fällen, daß der ernannte
Erbe nicht Erbe sein kann, oder, daß er nicht Erbe sein will, nur einen
ausgedrückt; so ist der andere Fall ausgeschlossen.
Rechte aus derselben
§
606. Die dem Erben aufgelegten Lasten werden auch auf den an seine
Stelle tretenden Nacherben ausgedehnt, wofern sie nicht durch den
ausdrücklichen Willen, oder die Beschaffenheit der Umstände, auf die
Person des Erben eingeschränkt sind.
§
607. Sind die Miterben allein wechselseitig zu Nacherben berufen
worden; so wird angenommen, daß der Erblasser die in der Einsetzung
ausgemessenen Teile auch auf die Substitution ausdehnen wollte. Wird aber
in der Substitution, außer den Miterben, noch sonst jemand berufen, so
fällt der erledigte Erbteil allen zu gleichen Teilen zu.
Fideikommissarische
§
608. Der Erblasser kann seinen Erben verpflichten, daß er die
angetretene Erbschaft nach seinem Tode, oder in andern bestimmten Fällen,
einem zweiten ernannten Erben überlasse. Diese Anordnung wird eine
fideikommissarische Substitution genannt. Die fideikommissarische
Substitution begreift stillschweigend die gemeine in sich.
Inwiefern die Eltern
ihren Kindern substituieren dürfen
§
609. Auch die Eltern können ihren Kindern, selbst in dem Falle,
daß diese zu testieren unfähig sind, nur in Rücksicht des Vermögens, das
sie ihnen hinterlassen, einen Erben oder Nacherben ernennen.
Stillschweigende
fideikommissarische Substitution
§
610. Hat der Erblasser dem Erben verboten, über den Nachlaß zu
testieren; so ist es eine fideikommissarische Substitution, und der Erbe
muß den Nachlaß für seine gesetzlichen Erben aufbewahren. Das Verbot, die
Sache zu veräußern, schließt das Recht, darüber zu testieren, nicht aus.
Einschränkung der
fideikommissarischen Substitution
§
611. Die Reihe, in welcher die fideikommissarischen Erben
aufeinander folgen sollen, wird, wenn sie alle Zeitgenossen des Erblassers
sind, gar nicht beschränkt, sie kann sich auf den Dritten, Vierten und
noch weiter ausdehnen.
§
612. Sind es nicht Zeitgenossen, sondern solche Nacherben, die zur
Zeit des errichteten Testamentes noch nicht geboren sind; so kann sich die
fideikommissarische Substitution in Rücksicht auf Geldsummen, und andere
bewegliche Sachen bis auf den zweiten Grad erstrecken. In Ansehung
unbeweglicher Güter gilt sie nur auf den ersten Grad; doch wird bei
Bestimmung der Grade nur derjenige Nacherbe gezählt, welcher zum Besitze
der Erbschaft gelangt ist.
Rechte des Erben bei
einer fideikommissarischen Substitution
§
613. Bis der Fall der fideikommissarischen Substitution eintritt,
kommt dem eingesetzten Erben das eingeschränkte Eigentumsrecht, mit den
Rechten und Verbindlichkeiten eines Fruchtnießers zu.
Auslegung der
Substitutionen
§
614. Ist eine Substitution zweifelhaft ausgedrückt; so ist sie auf
eine solche Art auszulegen, wodurch die Freiheit des Erben, über das
Eigentum zu verfügen, am mindesten eingeschränkt wird.
Erlöschungsarten der
gemeinen und fideikommissarischen Substitution
§
615.
(1) Die gemeine
Substitution erlischt, sobald der eingesetzte Erbe die Erbschaft
angetreten hat; die fideikommissarische, wenn keiner von den berufenen
Nacherben mehr übrig ist; oder wenn der Fall, für den sie errichtet
worden, aufhört.
(2) Sofern nicht
ein anderer Wille des Erblassers anzunehmen ist, geht das Recht des
fideikommissarischen Erben auch dann auf dessen Erben über (§
537), wenn er den Eintritt des Substitutionsfalles nicht erlebt.
§
616. Insbesondere verliert die einem Testierunfähigen gemachte
fideikommissarische Substitution (§§
608,
609) ihre Kraft, wenn bewiesen wird, daß er zur Zeit seiner letzten
Anordnung bei voller Besonnenheit war; oder, wenn ihm das Gericht wegen
erlangten Verstandgebrauches die freie Verwaltung des Vermögens eingeräumt
hat; und die Substitution lebt nicht wieder auf, ob er gleich wegen
Rückfalls wieder unter einen Kurator gesetzt worden ist, und in der
Zwischenzeit keine letzte Anordnung errichtet hat.
§
617. Die von einem Erblasser seinem Kinde zur Zeit, da es noch
keine Nachkommenschaft hatte, gemachte Substitution erlischt, wenn
dasselbe erbfähige Nachkommen hinterlassen hat.
§
618. aufgehoben
§
619. aufgehoben
§
620. aufgehoben
§
621. aufgehoben
§
622. aufgehoben
§
623. aufgehoben
§
624. aufgehoben
§
625. aufgehoben
§
626. aufgehoben
§
627. aufgehoben
§
628. aufgehoben
§
629. aufgehoben
§
630. aufgehoben
§
631. aufgehoben
§
632. aufgehoben
§
633. aufgehoben
§
634. aufgehoben
§
635. aufgehoben
§
636. aufgehoben
§
637. aufgehoben
§
638. aufgehoben
§
639. aufgehoben
§
640. aufgehoben
§
641. aufgehoben
§
642. aufgehoben
§
643. aufgehoben
§
644. aufgehoben
§
645. aufgehoben
Unterschied eines
Fideikommisses von Stiftungen
§
646. Von den Substitutionen und Fideikommissen unterscheiden sich
die Stiftungen, wodurch die Einkünfte von Kapitalien, Grundstücken oder
Rechten zu gemeinnützigen Anstalten, als: für geistliche Pfründen,
Schulen, Kranken- oder Armenhäuser; oder, zum Unterhalte gewisser Personen
auf alle folgende Zeiten bestimmt werden. Die Vorschriften über Stiftungen
sind in den politischen Verordnungen enthalten.
Elftes Hauptstück
Von Vermächtnissen
Von wem, wie und wem
legiert;
§
647. Zur Gültigkeit eines Vermächtnisses (§
535) ist notwendig, daß es von einem fähigen Erblasser, einer Person,
die zu erben fähig ist, durch eine gültige letzte Willenserklärung
hinterlassen werde.
§
648. Der Erblasser kann auch einem oder mehrern Miterben ein
Vermächtnis vorausbestimmen, in Rücksicht desselben sind sie nur als
Legatare zu betrachten.
und wer mit der
Entrichtung des Vermächtnisses beschwert werden könne
§
649. Die Vermächtnisse fallen in der Regel allen Erben, selbst in
dem Falle, daß die einem Miterben gehörige Sache vermacht worden ist, nach
Maß ihres Erbteiles zur Last. Es hängt jedoch von dem Erblasser ab, ob er
die Abführung des Legats einem Miterben, oder auch einem Legatar besonders
auftragen wolle.
§
650. Ein Legatar kann sich von der vollständigen Erfüllung des ihm
aufgetragenen weitern Vermächtnisses aus dem Grunde, daß es den Wert des
ihm zugedachten Legats übersteige, nicht entschlagen. Nimmt er aber das
Legat nicht an; so muß derjenige, dem es zufällt, den Auftrag übernehmen,
oder das ihm zugefallene Vermächtnis dem darauf gewiesenen
Vermächtnisnehmer überlassen.
§
651. Ein Erblasser, welcher ein Legat einer gewissen Klasse von
Personen, als: Verwandten, Dienstpersonen oder Armen zugedacht hat, kann
die Verteilung, welchen aus diesen Personen, und, was jeder zukommen soll,
dem Erben oder einem Dritten überlassen. Hat der Erblasser hierüber nichts
bestimmt; so bleibt die Wahl dem Erben vorbehalten.
Substitutionen bei
Vermächtnissen
§
652. Der Erblasser kann bei einem Vermächtnisse eine gemeine, oder
fideikommissarische Substitution anordnen; dabei sind die in dem vorigen
Hauptstücke gegebenen Vorschriften anzuwenden.
Gegenstände eines
Vermächtnisses
§
653. Alles, was im gemeinen Verkehre steht: Sachen, Rechte,
Arbeiten und andere Handlungen, die einen Wert haben, können vermacht
werden.
§
654. Werden Sachen vermacht, die zwar im gemeinen Verkehre stehen,
die aber der Legatar zu besitzen für seine Person unfähig ist, so wird ihm
der ordentliche Wert vergütet.
Allgemeine
Auslegungsregel bei Vermächtnissen
§
655. Worte werden auch bei Vermächtnissen in ihrer gewöhnlichen
Bedeutung genommen; es müßte denn bewiesen werden, daß der Erblasser mit
gewissen Ausdrücken einen ihm eigenen besondern Sinn zu verbinden gewohnt
gewesen ist; oder, daß das Vermächtnis sonst ohne Wirkung wäre.
Besondere Vorschriften über das Vermächtnis:
a) von Sachen einer
gewissen Gattung;
§
656. Hat der Erblasser eine oder mehrere Sachen von gewisser
Gattung, aber ohne eine nähere Bestimmung, vermacht, und sind mehrere
solche Sachen in der Verlassenschaft vorhanden; so steht dem Erben die
Wahl zu. Er muß aber ein Stück wählen, wovon der Legatar Gebrauch machen
kann. Wird dem Legatar überlassen, eine von den mehrern Sachen zu nehmen
oder zu wählen; so kann er auch die beste wählen.
§
657. Wenn der Erblasser eine oder mehrere Sachen von gewisser
Gattung ausdrücklich nur aus seinem Eigentume vermacht hat, und es finden
sich dergleichen gar nicht in der Verlassenschaft; so verliert das
Vermächtnis seine Wirkung. Finden sie sich nicht in der verordneten Menge;
so muß sich der Legatar mit den vorhandenen begnügen.
§
658. Vermacht der Erblasser eine oder mehrere Sachen von gewisser
Gattung nicht ausdrücklich aus seinem Eigentume, und es finden sich
dergleichen nicht in der Verlassenschaft; so muß der Erbe sie dem Legatar
in einer, dessen Stande und Bedürfnissen angemessenen Eigenschaft
verschaffen. Das Legat einer Summe Geldes verbindet den Erben zur Zahlung
derselben, ohne Rücksicht, ob bares Geld in der Verlassenschaft vorhanden
sei oder nicht.
§
659. Der Erblasser kann die Auswahl, welche Sache aus mehrern der
Legatar haben soll, auch einem Dritten überlassen. Schlägt sie dieser aus
oder ist er vor getroffener Auswahl gestorben; so bestimmt die
Gerichtsbehörde das Legat mit Rücksicht auf den Stand und das Bedürfnis
des Legatars. Diese gerichtliche Bestimmung tritt auch in dem Falle ein,
daß der Legatar vor der ihm überlassenen Auswahl verstorben ist.
b) das Vermächtnis
einer bestimmten Sache;
§
660. Das Vermächtnis einer bestimmten Sache kann von dem Legatar,
wenn es in einer oder in verschiedenen Anordnungen wiederholt wird, nicht
zugleich in Natur, und dem Werte nach verlangt werden. Andere
Vermächtnisse, ob sie gleich eine Sache der nämlichen Art oder den
nämlichen Betrag enthalten, gebühren dem Legatar so oft, als sie
wiederholt worden sind.
§
661. Das Vermächtnis ist ohne Wirkung, wenn das vermachte Stück
zur Zeit der letzten Anordnung schon ein Eigentum des Legatars war. Hat er
es später an sich gebracht; so wird ihm der ordentliche Wert bezahlt. Wenn
er es aber von dem Erblasser selbst und zwar unentgeltlich erhalten hat,
ist das Vermächtnis für aufgehoben zu halten.
c) einer fremden
Sache;
§
662. Das Vermächtnis einer fremden Sache, die weder dem Erblasser,
noch dem Erben oder Legatar, welcher sie einem Dritten leisten soll,
gehört, ist wirkungslos. Gebührt den erwähnten Personen ein Anteil oder
Anspruch an der Sache; so ist das Vermächtnis nur von diesem Anspruche
oder Anteile zu verstehen. Ist die vermachte Sache verpfändet oder
belastet; so übernimmt der Empfänger auch die darauf haftenden Lasten.
Wenn aber der Erblasser ausdrücklich verordnet, daß eine bestimmte fremde
Sache gekauft, und dem Legatar geleistet werden solle, der Eigentümer
hingegen sie um den Schätzungspreis nicht veräußern will; so ist dem
Legatar dieser Wert zu entrichten.
d) einer Forderung;
§
663. Das Vermächtnis einer Forderung, die der Erblasser an den
Legatar zu machen hat, verpflichtet den Erben, den Schuldschein
zurückzustellen; oder, dem Legatar die Befreiung von der Schuld und den
rückständigen Zinsen auszufertigen.
§
664. Vermacht der Erblasser jemandem eine Forderung, die er an
einen Dritten zu stellen hat; so muß der Erbe die Forderung samt den
rückständigen und weiter laufenden Zinsen dem Legatar überlassen.
§
665. Das Vermächtnis der Schuld, die der Erblasser dem Legatar zu
entrichten hat, hat die Wirkung, daß der Erbe die von dem Erblasser
bestimmt ausgedrückte, oder von dem Legatar ausgewiesene Schuld
anerkennen, und sie, ohne Rücksicht auf die in der Schuldverschreibung
enthaltenen Bedingungen oder Fristen, längstens in der zur Abführung der
übrigen Legate bestimmten Zeitfrist berichtigen muß. Den gefährdeten
Gläubigern des Erblassers aber kann dessen Anerkennung nicht zum Nachteile
gereichen.
§
666. Die Erlassung der Schuld ist nur von den gegenwärtigen, nicht
auch von den erst nach dem errichteten Vermächtnisse entstandenen Schulden
zu verstehen. Wird durch ein Vermächtnis das Pfandrecht, oder die
Bürgschaft erlassen; so folgt daraus nicht, daß auch die Schuld erlassen
worden sei. Werden die Zahlungsfristen verlängert; so müssen doch die
Zinsen fort bezahlt werden.
§
667. Wenn der Erblasser einer Person eine Summe schuldig ist, und
ihr eine gleiche Summe vermacht; so wird nicht vermutet, daß er die Schuld
mit dem Vermächtnisse habe tilgen wollen. Der Erbe bezahlt in diesem Falle
die Summe doppelt; einmal als Schuld, und dann als Vermächtnis.
§
668. Unter dem Vermächtnisse aller ausstehenden Forderungen sind
doch weder die Forderungen aus öffentlichen Kreditpapieren, noch auch die
auf einem unbeweglichen Gute haftenden Kapitalien, oder die aus einem
dinglichen Rechte entstehenden Forderungen begriffen.
e) des Heiratsgutes;
§
669. Das Heiratsgut kann vermacht werden, entweder um den Gatten
von der Zurückzahlung desselben zu befreien; oder, um den Erben zu
verpflichten, daß er der Gattin die als Heiratsgut eingebrachte Summe oder
Sache ohne Beweis, und ohne Abzug der darauf verwendeten Kosten abführe.
Hier gelten die für andere vermachte Forderungen gegebenen Vorschriften.
§
670. Vermacht der Erblasser einer dritten Person ein unbestimmtes
Heiratsgut, so versteht man darunter, ohne Rücksicht auf ihr eigenes
Vermögen, ein solches Heiratsgut, das die Eltern dieser Person zu geben
schuldig wären, wenn sie ein ihren Lebensverhältnissen entsprechendes
durchschnittliches Vermögen hätten.
§
671. Vermachen Eltern den Töchtern ein Heiratsgut; so wird
dasselbe, wofern es nicht ausdrücklich als ein Vorausvermächtnis erklärt
worden, in den gesetzlichen [oder letztwilligen] Erbteil eingerechnet.
f) des Unterhalts;
der Erziehung; oder Kost;
§
672. Das Vermächtnis des Unterhaltes begreift Nahrung, Kleidung,
Wohnung und die übrigen Bedürfnisse, und zwar auf lebenslang, wie auch den
nötigen Unterricht in sich. Alles dieses wird auch unter Erziehung
verstanden. Die Erziehung endigt sich mit der Volljährigkeit. Unter Kost
wird Speise und Trank auf lebenslang begriffen.
§
673. Das Maß der im vorstehenden Paragraphen angeführten
Vermächtnisse, wenn es weder aus dem ausdrücklichen, noch aus dem
stillschweigenden, durch die bisherige Unterstützung erklärten, Willen des
Erblassers erhellt, muß nach dem Stande bestimmt werden, welcher dem
Legatar eigen ist, oder, wozu er durch die genossene Verpflegung
vorbereitet worden ist.
g) der Mobilien; des
Hausrates;
§
674. Unter Mobilien (Meublen) werden nur die zum anständigen
Gebrauche der Wohnung; unter Hausrat oder Einrichtung zugleich die zur
Führung der Haushaltung erforderlichen Gerätschaften verstanden. Die
Werkzeuge zum Betriebe des Gewerbes sind, ohne eine deutlichere Erklärung,
darunter nicht begriffen.
h) eines
Behältnisses;
§
675. Ist jemandem ein Behältnis vermacht worden, welches nicht für
sich selbst besteht; sondern nur ein Teil eines Ganzen ist; so wird in der
Regel vermutet, daß nur diejenigen Stücke zugedacht worden sind, welche
sich bei dem Ableben des Erblassers darin vorfinden, und zu deren
Aufbewahrung das Behältnis seiner Natur nach bestimmt, oder von dem
Erblasser gewöhnlich verwendet worden ist.
§
676. Ist hingegen das Behältnis beweglich, oder doch eine für sich
bestehende Sache; so hat der Legatar nur auf das Behältnis, nicht auch auf
die darin befindlichen Sachen Anspruch.
§
677. Wird ein Schrank, ein Kasten oder eine Lade mit allen darin
befindlichen Sachen vermacht; so rechnet man dazu auch Gold und Silber,
Schmuck und bares Geld, selbst die vom Legatar dem Erblasser ausgestellten
Schuldscheine. Andere Schuldscheine oder Urkunden, worauf sich Forderungen
und Rechte des Erblassers gründen, werden nur dann dazu gerechnet, wenn
sich außer denselben nichts in dem Behältnisse befindet. Zu einem
Vermächtnisse flüssiger Sachen gehören auch die zu ihrer Verführung
bestimmten Gefäße.
i) der Juwelen, des
Schmuckes und Putzes;
§
678. Unter Juwelen werden in der Regel nur Edelsteine und gute
Perlen; unter Schmuck auch die unechten Steine, und das aus Gold oder
Silber verfertigte oder damit überzogene Geschmeide, welches zur Zierde
der Person dient; und unter Putz dasjenige verstanden, was außer Schmuck,
Geschmeide und Kleidungsstücken zur Verzierung der Person gebraucht wird.
k) des Goldes oder
Silbers; der Wäsche; Equipage;
§
679. Das Vermächtnis des Goldes oder Silbers begreift das
verarbeitete und unverarbeitete, doch nicht das gemünzte, noch auch
dasjenige in sich, was nur ein Teil oder eine Verzierung eines andern
Verlassenschaftsstückes, z. B. einer Uhr oder Dose, ausmacht. Die Wäsche
wird nicht zur Kleidung, und Spitzen werden nicht zur Wäsche, sondern zum
Putze gerechnet. Unter Equipage werden die zur Bequemlichkeit des
Erblassers bestimmten Zugpferde und Wagen samt dem dazu gehörigen
Geschirre; nicht auch Reitpferde und Reitzeug verstanden.
l) der Barschaft;
§
680. Zur Barschaft gehören auch jene öffentlichen Kreditpapiere,
welche im ordentlichen Umlaufe die Stelle des baren Geldes vertreten.
m) über die
Benennung: Kinder;
§
681. Unter dem Worte: Kinder, werden, wenn der Erblasser die
Kinder eines andern bedenkt, nur die Söhne und Töchter; wenn er aber seine
eigenen Kinder bedenkt, auch die an deren Stelle tretenden Nachkömmlinge
begriffen, welche bei dem Ableben des Erblassers schon erzeugt waren.
n) Verwandte;
§
682. Ein ohne nähere Bestimmung für die Verwandten ausgesetztes
Vermächtnis wird denjenigen, welche nach der gesetzlichen Erbfolge die
nächsten sind, zugewendet, und die oben in dem
§ 559
über die Verteilung einer Erbschaft unter solchen Personen, welche für
eine Person angesehen werden, aufgestellte Regel ist auch auf
Vermächtnisse anzuwenden.
o) Dienstpersonen
§
683. Hat der Erblasser seinen Dienstpersonen ein Vermächtnis
hinterlassen, und sie bloß durch das Dienstverhältnis bezeichnet; so wird
vermutet, daß es diejenigen erhalten sollen, welche zur Zeit seines
Ablebens in dem Dienstverhältnisse stehen. Doch kann in diesem, sowie in
den übrigen Fällen, die Vermutung durch entgegengesetzte stärkere
Vermutungsgründe aufgehoben werden.
Anfallstag bei den
Vermächtnissen
§
684. Der Legatar erwirbt in der Regel (§
699) gleich nach dem Tode des Erblassers für sich und seine Nachfolger
ein Recht auf das Vermächtnis. Das Eigentumsrecht auf die vermachte Sache
aber kann nur nach den für die Erwerbung des Eigentumes in dem
fünften
Hauptstücke aufgestellten Vorschriften erlangt werden.
Zahlungstag
§
685. Das Vermächtnis einzelner Verlassenschaftsstücke und darauf
sich beziehender Rechte, kleine Belohnungen des Dienstgesindes, und fromme
Vermächtnisse können sogleich; andere aber erst nach einem Jahre, von dem
Tode des Erblassers, gefordert werden.
§
686. Bei dem Vermächtnisse eines einzelnen Verlassenschaftsstückes
kommen dem Legatar auch die seit dem Tode des Erblassers laufenden Zinsen,
entstandenen Nutzungen, und jeder andere Zuwachs zustatten. Er trägt
hingegen auch alle auf dem Legate haftende Lasten und selbst den Verlust,
wenn es ohne Verschulden eines andern vermindert wird, oder gänzlich zu
Grunde geht.
§
687. Wird jemandem ein in wiederkehrenden Fristen, als: alle
Jahre, Monate und dergleichen zu leistender Betrag vermacht; so erhält der
Legatar ein Recht auf den ganzen Betrag dieser Frist, wenn er auch nur den
Anfang der Frist erlebt hat. Doch kann der Betrag erst mit Ablauf der
Frist gefordert werden. Die erste Frist fängt mit dem Sterbetage des
Erblassers zu laufen an.
Recht des Legatars
zur Sicherstellung
§
688. In allen Fällen, in welchen ein Gläubiger von einem Schuldner
Sicherstellung zu fordern berechtigt ist; kann auch ein Legatar die
Sicherstellung seines Legates verlangen. Wie die Einverleibung eines
Vermächtnisses, zur Begründung eines dinglichen Rechtes, geschehen müsse,
ist oben
§ 437 vorgeschrieben worden.
Wem ein erledigtes
Vermächtnis zufalle?
§
689. Ein Vermächtnis, welches der Legatar nicht annehmen kann oder
will, fällt auf den Nachberufenen (§
652). Ist kein Nachberufener vorhanden, und ist das ganze Vermächtnis
mehrern Personen ungeteilt oder ausdrücklich zu gleichen Teilen zugedacht;
so wächst der Anteil, den einer von ihnen nicht erhält, den übrigen
ebenso, wie den Miterben die Erbschaft, zu. Außer den gedachten zwei
Fällen bleibt das erledigte Vermächtnis in der Erbschaftsmasse.
Recht des Erben, wenn
die Lasten die Masse erschöpfen;
§
690. Wenn die ganze Erbschaft durch Vermächtnisse erschöpft ist;
so hat der Erbe nichts weiter, als die Vergütung seiner zum Besten der
Masse gemachten Auslagen und eine seinen Bemühungen angemessene Belohnung
zu fordern. Will er den Nachlaß nicht selbst verwalten; so muß er um die
Aufstellung eines Kurators anlangen.
§
691. Können nicht alle Legatare aus der Verlassenschaftsmasse
befriedigt werden; so wird das Legat des Unterhaltes vor allen andern
entrichtet, und dem Legatar gebührt der Unterhalt von dem Tage des
Erbanfalles.
oder gar übersteigen
§
692. Reicht die Verlassenschaft zur Bezahlung der Schulden,
anderer pflichtmäßigen Auslagen, und zur Berichtigung aller Vermächtnisse
nicht zu; so leiden die Legatare einen verhältnismäßigen Abzug. Daher ist
der Erbe, solange eine solche Gefahr obwaltet, die Vermächtnisse ohne
Sicherstellung zu berichtigen nicht schuldig.
§
693. Im Falle aber, daß die Legatare die Vermächtnisse bereits
empfangen haben, wird der Abzug nach dem Werte, den das Vermächtnis zur
Zeit des Empfanges hatte, und den daraus gezogenen Nutzungen bestimmt.
Doch steht dem Legatar auch nach empfangenem Vermächtnisse noch immer
frei, zur Vermeidung des Beitrages, das Vermächtnis, oder den oben
erwähnten Wert und die bezogenen Nutzungen in die Masse zurückzustellen;
in Rücksicht der Verbesserungen und Verschlimmerungen wird er als ein
redlicher Besitzer behandelt.
Von den gesetzlichen
Beiträgen zu öffentlichen Anstalten
§
694. [Die Beiträge, welche ein Erblasser nach den politischen
Vorschriften zur Unterstützung der Armen-, Invaliden- und Krankenhäuser
und des öffentlichen Unterrichtes in dem Testamente ausgesetzt hat, sind
nicht als Vermächtnisse anzusehen; sie sind eine Staatsauflage, müssen
selbst von den gesetzlichen Erben entrichtet, und können nicht nach den
Grundsätzen des Privatrechts, sondern nur nach den politischen
Verordnungen beurteilt werden.]
Zwölftes Hauptstück
Von Einschränkung und Aufhebung des letzten Willens
Recht des Erblassers
zur Einschränkung oder Änderung seines letzten Willens
§
695. Der Erblasser kann seine Anordnung auf eine Bedingung; auf
einen Zeitpunkt; durch einen Auftrag; oder, eine erklärte Absicht
einschränken. Er kann auch sein Testament oder Kodizill abändern, oder es
ganz aufheben.
Arten der Einschränkung des letzten Willens:
1. Bedingung
§
696. Eine Bedingung heißt eine Ereignung, wovon ein Recht abhängig
gemacht wird. Die Bedingung ist bejahend oder verneinend, je nachdem sie
sich auf den Erfolg, oder Nichterfolg der Ereignung bezieht. Sie ist
aufschiebend, wenn das zugedachte Recht erst nach ihrer Erfüllung zu
seiner Kraft gelangt; sie ist auflösend, wenn das zugedachte Recht bei
ihrem Eintritte verlorengeht.
Vorschriften:
a) über
unverständliche;
§
697. Ganz unverständliche Bedingungen sind für nicht beigesetzt zu
achten.
b) unmögliche oder
unerlaubte;
§
698. Die Anordnung, wodurch jemandem unter einer aufschiebenden
unmöglichen Bedingung ein Recht erteilt wird, ist ungültig, obschon die
Erfüllung der Bedingung erst in der Folge unmöglich, und die Unmöglichkeit
dem Erblasser bekannt geworden wäre. Eine auflösende unmögliche Bedingung
wird als nicht beigesetzt angesehen. Alles dieses gilt auch von den
unerlaubten Bedingungen.
c) mögliche und
erlaubte Bedingungen;
§
699. Sind die Bedingungen möglich und erlaubt; so kann das davon
abhängende Recht nur durch ihre genaue Erfüllung erworben werden; sie
mögen vom Zufalle, von dem Willen des bedachten Erben, Legatars, oder
eines Dritten abhängen.
d) Bedingung der
Nichtverehelichung;
§
700. Die Bedingung, daß der Erbe oder der Legatar sich, selbst
nach erreichter Volljährigkeit, nicht verehelichen solle, ist als nicht
beigesetzt anzusehen. Nur eine verwitwete Person muß, wenn sie ein oder
mehrere Kinder hat, die Bedingung erfüllen. Die Bedingung, daß der Erbe
oder Legatar eine bestimmte Person nicht heirate, kann gültig auferlegt
werden.
e) wenn die Bedingung
bei dem Leben des Erblassers erfüllt worden
§
701. Ist die in der letzten Willenserklärung vorgeschriebene
Bedingung schon bei dem Leben des Erblassers eingetroffen; so muß die
Erfüllung derselben nach dem Tode des Erblassers nur dann wiederholt
werden, wenn die Bedingung in einer Handlung des Erben oder Legatars
besteht, welche von ihm wiederholt werden kann.
Ob die Bedingung auch
auf die Nachberufenen auszudehnen sei
§
702. Eine dem Erben oder Legatar beigerückte Bedingung ist, ohne
ausdrückliche Erklärung des Erblassers, auf den von dem Erblasser
nachberufenen Erben oder Legatar nicht auszudehnen.
Wirkung einer
möglichen aufschiebenden Bedingung
§
703. Zur Erwerbung eines unter einer aufschiebenden Bedingung
zugedachten Nachlasses ist notwendig, daß die bedachte Person die
Erfüllung der Bedingung überlebe, und bei dem Eintritte derselben erbfähig
sei.
2. Zeitpunkt
§
704. Ist es ungewiß, ob der Zeitpunkt, auf welchen der Erblasser
das zugedachte Recht einschränkt, kommen oder nicht kommen werde; so wird
diese Einschränkung als eine Bedingung angesehen.
§
705. Ist der Zeitpunkt von der Art, daß er kommen muß; so wird das
zugedachte Recht, wie andere unbedingte Rechte, auch auf die Erben der
bedachten Person übertragen, und nur die Übergabe bis zum gesetzten
Termine verschoben.
§
706. Wäre es offenbar, daß die in der letzten Anordnung
ausgemessene Zeit nie kommen könne; so wird die Bestimmung dieser Zeit wie
die Beisetzung einer unmöglichen Bedingung angesehen. Nur in dem Falle,
daß der Erblasser wahrscheinlich bloß in der Berechnung der Zeit sich
geirrt hat, wird der Zeitpunkt nach dem wahrscheinlichen Willen des
Erblassers zu bestimmen sein.
Rechtsverhältnis bei
einer Bedingung oder einem Zeitpunkte zwischen der bedachten und ihr
nachfolgenden Person
§
707. So lange das Recht des Erben oder des Legatars wegen einer
noch nicht erfüllten Bedingung, oder wegen des noch nicht gekommenen
Zeitpunktes verschoben bleibt; so lange finden im ersten Falle zwischen
dem gesetzlichen und eingesetzten Erben; und im zweiten Falle zwischen dem
Erben und Legatar, in Hinsicht auf den einstweiligen Besitz und Genuß des
Nachlasses oder Legats, die nämlichen Rechte und Verbindlichkeiten, wie
bei einer fideikommissarischen Substitution, statt.
§
708. Wer eine Erbschaft oder ein Vermächtnis unter einer
verneinenden oder auflösenden Bedingung; oder, nur auf eine gewisse Zeit
erhält, hat gegen den, welchem die Erbschaft, oder das Vermächtnis, beim
Eintritte der Bedingung, oder des bestimmten Zeitpunktes zufällt, die
nämlichen Rechte und Verbindlichkeiten, welche einem Erben oder Legatar
gegen den fideikommissarischen Substituten zukommen (§
613).
3. Auftrag
§
709. Hat der Erblasser jemandem einen Nachlaß unter einem Auftrage
zugewendet; so ist dieser Auftrag als eine auflösende Bedingung anzusehen,
daß durch die Nichterfüllung des Auftrages der Nachlaß verwirkt werden
solle (§
696).
§
710. In dem Falle, daß der Auftrag nicht genau erfüllt werden
kann, muß man demselben wenigstens nach Möglichkeit nahe zu kommen suchen.
Kann auch dieses nicht geschehen; so behält doch der Belastete, wofern aus
dem Willen des Erblassers nicht das Gegenteil erhellt, den zugedachten
Nachlaß. Wer sich zur Erfüllung des Auftrages selbst unfähig gemacht hat,
wird des ihm zugedachten Nachlasses verlustig.
§
711. Wenn der Erblasser die Absicht, wozu er den Nachlaß bestimmt,
zwar ausgedrückt, aber nicht zur Pflicht gemacht hat, so kann die bedachte
Person nicht angehalten werden, den Nachlaß zu dieser Absicht zu
verwenden.
§
712. Die Anordnung, wodurch der Erblasser seinem Erben eine
unmögliche oder unerlaubte Handlung mit dem Beisatze aufträgt, daß er,
wofern er den Auftrag nicht befolgte, einem Dritten ein Legat entrichten
soll, ist ungültig.
Von
Aufhebung der Anordnungen, und zwar:
1. durch Errichtung
einer neuen Anordnung; eines Testamentes;
§
713. Ein früheres Testament wird durch ein späteres gültiges
Testament nicht nur in Rücksicht der Erbseinsetzung, sondern auch in
Rücksicht der übrigen Anordnungen aufgehoben; dafern der Erblasser in dem
letztern nicht deutlich zu erkennen gibt, daß das frühere ganz oder zum
Teil bestehen solle. Diese Vorschrift gilt auch dann, wenn in dem spätern
Testamente der Erbe nur zu einem Teile der Erbschaft berufen wird. Der
übrig bleibende Teil fällt nicht den in dem frühern Testamente
eingesetzten, sondern den gesetzlichen Erben zu.
oder Kodizills;
§
714. Durch ein späteres Kodizill, deren mehrere nebeneinander
bestehen können, werden frühere Vermächtnisse oder Kodizille nur insofern
aufgehoben, als sie mit demselben im Widerspruche stehen.
§
715. Kann man nicht entscheiden, welches Testament oder Kodizill
das spätere sei; so gelten, insofern sie nebeneinander bestehen können,
beide, und es kommen die im
Hauptstücke von
der Gemeinschaft des Eigentums aufgestellten Vorschriften zur
Anwendung.
ungeachtet der früher
erklärten Unabänderlichkeit
§
716. Der in einem Testament oder Kodizill angehängte Beisatz: daß
jede spätere Anordnung überhaupt, oder, wenn sie nicht mit einem
bestimmten Merkmale bezeichnet ist, null und nichtig sein solle, ist als
nicht beigesetzt anzusehen.
2. durch Widerruf;
§
717. Will der Erblasser seine Anordnung aufheben, ohne eine neue
zu errichten; so muß er sie ausdrücklich entweder mündlich, oder
schriftlich widerrufen, oder die Urkunde vertilgen.
§
718. Der Widerruf kann nur in einem solchen Zustande gültig
geschehen, worin man einen letzten Willen zu erklären fähig ist.
a) einen
ausdrücklichen;
§
719. Ein mündlicher Widerruf einer gerichtlichen oder
außergerichtlichen letzten Anordnung erfordert so viele und solche Zeugen,
als zur Gültigkeit eines mündlichen Testamentes nötig sind; ein
schriftlicher aber, eine von dem Erblasser eigenhändig geschriebene und
unterschriebene, oder wenigstens von ihm und den zu einem schriftlichen
Testamente erforderlichen Zeugen unterfertigte Erklärung.
§
720. Eine Anordnung des Erblassers, wodurch er dem Erben oder
Legatar unter angedrohter Entziehung eines Vorteiles verbietet, den
letzten Willen zu bestreiten, soll für den Fall, daß nur die Echtheit oder
der Sinn der Erklärung angefochten wird, nie von einer Wirkung sein.
b) stillschweigenden;
§
721. Wer in seinem Testamente oder Kodizille die Unterschrift
durchschneidet; sie durchstreicht; oder, den ganzen Inhalt auslöscht,
vertilgt es. Wenn von mehreren gleichlautenden Urkunden nur eine vertilgt
worden; so kann man daraus auf keinen Widerruf schließen.
§
722. Sind die gedachten Verletzungen der Urkunde nur zufällig
geschehen; oder, ist die Urkunde in Verlust geraten; so verliert der
letzte Wille seine Wirkung nicht; wenn anders der Zufall und der Inhalt
der Urkunde erwiesen wird.
§
723. Hat ein Erblasser eine spätere Anordnung vernichtet, die
frühere schriftliche Anordnung aber unversehrt gelassen; so kommt die
frühere schriftliche wieder zur Kraft. Eine mündliche frühere Anordnung
lebt dadurch nicht wieder auf.
oder c) vermuteten
§
724. Ein Legat wird für widerrufen angesehen, wenn der Erblasser
die vermachte Forderung eingetrieben und erhoben; wenn er die jemandem
zugedachte Sache veräußert, und nicht wieder zurückerhalten; oder, wenn er
sie auf eine solche Art in eine andere verwandelt hat, daß die Sache ihre
vorige Gestalt und ihren vorigen Namen verliert.
§
725. Wenn aber der Schuldner die Forderung aus eigenem Antriebe
berichtigt hat; wenn die Veräußerung des Legats auf gerichtliche Anordnung
geschehen; wenn die Sache ohne Einwilligung des Erblassers verwandelt
worden ist; so besteht das Legat.
3. durch Entsagung
der Erben
§
726. Will oder kann weder ein Erbe, noch ein Nacherbe die
Verlassenschaft annehmen; so fällt das Erbrecht auf die gesetzlichen
Erben. Diese sind aber verpflichtet, die übrigen Verfügungen des
Erblassers zu befolgen. Entsagen auch sie der Erbschaft; so werden die
Legatare verhältnismäßig als Erben betrachtet.
Dreizehntes Hauptstück
Von der gesetzlichen Erbfolge
Fälle der
gesetzlichen Erbfolge
§
727. Wenn der Verstorbene keine gültige Erklärung des letzten
Willens hinterlassen; wenn er in derselben nicht über sein ganzes Vermögen
verfügt; wenn er die Personen, denen er kraft des Gesetzes einen Erbteil
zu hinterlassen schuldig war, nicht gehörig bedacht hat; oder, wenn die
eingesetzten Erben die Erbschaft nicht annehmen können oder wollen; so
findet die gesetzliche Erbfolge ganz oder zum Teile statt.
§
728. In Ermangelung einer gültigen Erklärung des letzten Willens
fällt die ganze Verlassenschaft des Verstorbenen den gesetzlichen Erben
zu. Ist aber eine gültige Erklärung des letzten Willens vorhanden; so
kommt ihnen derjenige Erbteil zu, welcher in derselben niemandem zugedacht
ist.
Vorschrift für den
Fall des verkürzten Pflichtteiles
§
729. Ist eine Person, welcher der Erblasser kraft der Gesetze
einen Erbteil zu hinterlassen schuldig war, durch eine letzte
Willenserklärung verkürzt worden; so kann sie sich auf die Vorschrift des
Gesetzes berufen, und den nach Maßgabe des
folgenden
Hauptstückes ihr gebührenden Erbteil gerichtlich fordern.
Gesetzliche Erben
§
730.
(1) Gesetzliche
Erben sind der Ehegatte und diejenigen Personen, die mit dem Erblasser in
nächster Linie verwandt sind.
(2) Die Abstammung
muß zu Lebzeiten des Erblassers und der die Verwandtschaft vermittelnden
Personen feststehen oder zumindest gerichtlich geltend gemacht worden
sein. Bei Ungeborenen genügt es, daß die Abstammung binnen Jahresfrist
nach ihrer Geburt feststeht oder gerichtlich geltend gemacht wird.
I. Gesetzliches
Erbrecht der Verwandten
§
731.
(1) Zur ersten
Linie gehören diejenigen, welche sich unter dem Erblasser, als ihrem
Stamme, vereinigen, nämlich: seine Kinder und ihre Nachkömmlinge.
(2) Zur zweiten
Linie gehören des Erblassers Vater und Mutter samt denjenigen, die sich
mit ihm unter Vater und Mutter vereinigen, nämlich: seine Geschwister und
ihre Nachkömmlinge.
(3) Zur dritten
Linie gehören die Großeltern samt den Geschwistern der Eltern und ihren
Nachkömmlingen.
(4) Von der vierten
Linie sind nur des Erblassers erste Urgroßeltern zur Erbfolge berufen.
1. Linie: Die Kinder;
§
732. Wenn der Erblasser Kinder des erstes Grades hat, so fällt
ihnen die ganze Erbschaft zu; sie mögen männlichen oder weiblichen
Geschlechtes; sie mögen bei Lebzeiten des Erblassers oder nach seinem Tode
geboren sein. Mehrere Kinder teilen die Erbschaft nach ihrer Zahl in
gleiche Teile. Enkel von noch lebenden Kindern, und Urenkel von noch
lebenden Enkeln haben kein Recht zur Erbfolge.
§
733. Ist ein Kind des Erblassers vor ihm gestorben, und sind von
demselben ein oder mehrere Enkel vorhanden; so fällt der Anteil, welcher
dem verstorbenen Kinde gebührt hätte, diesem nachgelassenen Enkel ganz,
oder den mehrern Enkeln zu gleichen Teilen zu. Ist von diesen Enkeln
ebenfalls einer gestorben und hat Urenkel nachgelassen; so wird auf die
nämliche Art der Anteil des verstorbenen Enkels unter die Urenkel gleich
geteilt. Sind von einem Erblasser noch entferntere Nachkömmlinge
vorhanden; so wird die Teilung verhältnismäßig nach der eben gegebenen
Vorschrift vorgenommen.
§
734. Auf diese Art wird eine Erbschaft nicht nur dann geteilt,
wenn Enkel von verstorbenen Kindern mit noch lebenden Kindern, oder
entferntere Nachkömmlinge mit nähern Nachkömmlingen des Erblassers
zusammentreffen; sondern auch dann, wenn die Erbschaft bloß zwischen
Enkeln von verschiedenen Kindern; oder zwischen Urenkeln von verschiedenen
Enkeln zu teilen ist. Es können also die von jedem Kinde nachgelassenen
Enkel, und die von jedem Enkel nachgelassenen Urenkel, ihrer seien viele
oder wenige, nie mehr und nie weniger erhalten, als das verstorbene Kind
oder der verstorbene Enkel erhalten hätten, wenn sie am Leben geblieben
wären.
2. Linie: Die Eltern
und ihre Nachkömmlinge;
§
735. Ist niemand vorhanden, der von dem Erblasser selbst abstammt;
so fällt die Erbschaft auf diejenigen, die mit ihm durch die zweite Linie
verwandt sind, nämlich: auf seine Eltern und ihre Nachkömmlinge. Leben
noch beide Eltern; so gebührt ihnen die ganze Erbschaft zu gleichen
Teilen. Ist eines dieser Eltern verstorben; so treten dessen nachgelassene
Kinder oder Nachkömmlinge in sein Recht ein, und es wird die Hälfte, die
dem Verstorbenen gebührt hätte, unter sie nach jenen Grundsätzen geteilt,
welche in den
§§ 732 -
734 wegen Teilung der Erbschaft zwischen Kindern und entfernteren
Nachkömmlingen des Erblassers festgesetzt worden sind.
§
736. Wenn beide Eltern des Erblassers verstorben sind, so wird
jene Hälfte der Erbschaft, welche dem Vater zugefallen wäre, unter seine
hinterlassenen Kinder und derselben Nachkömmlinge; die andere Hälfte aber,
welche der Mutter gebührt hätte, unter ihre Kinder und derselben
Nachkömmlinge nach den
§§ 732 -
734 geteilt. Sind von diesen Eltern keine andern als von ihnen
gemeinschaftlich erzeugte Kinder, oder derselben Nachkömmlinge vorhanden;
so teilen sie die beiden Hälften unter sich gleich. Sind aber außer diesen
noch Kinder vorhanden, die von dem Vater oder von der Mutter, oder von
einem und der andern in einer andern Ehe erzeugt worden sind; so erhalten
die von dem Vater und der Mutter gemeinschaftlich erzeugten Kinder oder
ihre Nachkömmlinge sowohl an der väterlichen, als an der mütterlichen
Hälfte ihren gebührenden, mit den einseitigen Geschwistern gleichen
Anteil.
§
737. Wenn eines der verstorbenen Eltern des Erblassers weder
Kinder noch Nachkömmlinge hinterlassen hat; so fällt die ganze Erbschaft
dem andern noch lebenden Elternteile zu. Ist dieser Teil auch nicht mehr
am Leben; so wird die ganze Erbschaft unter seinen Kindern und
Nachkömmlingen nach den bereits angeführten Grundsätzen verteilt.
3. Linie: Die
Großeltern und ihre Nachkommenschaft;
§
738. Sind die Eltern des Erblassers ohne Nachkömmlinge verstorben;
so kommt die Erbschaft auf die dritte Linie, nämlich: auf des Erblassers
Großeltern und ihre Nachkommenschaft. Die Erbschaft wird dann in zwei
gleiche Teile geteilt. Eine Hälfte gehört den Eltern des Vaters und ihren
Nachkömmlingen; die andere den Eltern der Mutter und ihren Nachkömmlingen.
§
739. Jede dieser Hälften wird unter den Großeltern der einen und
der andern Seite, wenn sie beide noch leben, gleich geteilt. Ist eines der
Großeltern; oder sind beide von der einen oder andern Seite gestorben; so
wird die dieser Seite zugefallene Hälfte zwischen den Kindern und
Nachkömmlingen dieser Großeltern nach jenen Grundsätzen geteilt, nach
welchen in der zweiten Linie die ganze Erbschaft zwischen den Kindern und
Nachkömmlingen der Eltern des Erblassers geteilt werden muß (§§
735 - 737).
§
740. Sind von der väterlichen oder von der mütterlichen Seite
beide Großeltern verstorben, und weder von dem Großvater, noch von der
Großmutter dieser Seite Nachkömmlinge vorhanden; dann fällt den von der
andern Seite noch lebenden Großeltern; oder, nach derselben Tode, ihren
hinterlassenen Kindern und Nachkömmlingen die ganze Erbschaft zu.
4. Linie: Die
Urgroßeltern
§
741.
(1) Nach gänzlicher
Erlöschung der dritten Linie sind die Urgroßeltern des Erblassers zur
gesetzlichen Erbfolge berufen. Auf die Großeltern des Vaters des
Erblassers entfällt die eine Hälfte der Erbschaft, auf die Großeltern der
Mutter die andere Hälfte. In jede Hälfte der Erbschaft teilen sich die
beiden Großelternpaare zu gleichen Teilen. Ist ein Teil eines
Großelternpaares nicht vorhanden, so fällt das auf diesen Teil entfallende
Achtel der Erbschaft an den überlebenden Teil dieses Großelternpaares.
Fehlt ein Großelternpaar, so ist zu seinem Viertel das andere
Großelternpaar desselben Elternteiles des Erblassers berufen.
(2) Fehlen die
Großelternpaare des einen Elternteiles des Erblassers, so sind zu der auf
sie entfallenden Nachlaßhälfte die Großelternpaare des anderen
Elternteiles in demselben Ausmaß wie zu der ihnen unmittelbar zufallenden
Nachlaßhälfte berufen.
§
742. aufgehoben
§
743. aufgehoben
§
744. aufgehoben
§
745. aufgehoben
§
746. aufgehoben
§
747. aufgehoben
§
748. aufgehoben
§
749. aufgehoben
§
750. Wenn jemand mit dem Erblasser von mehr als einer Seite
verwandt ist; so genießt er von jeder Seite dasjenige Erbrecht, welches
ihm, als einem Verwandten von dieser Seite insbesondere betrachtet,
gebührt (§
736).
Ausschließung der
entferntern Verwandten
§
751. Auf diese vier Linien der Verwandtschaft wird das Recht der
Erbfolge in Ansehung eines frei vererblichen Vermögens eingeschränkt.
§
752. aufgehoben
§
753. aufgehoben
§
754. aufgehoben
§
755. aufgehoben
§
756. aufgehoben
II. Gesetzliches
Erbrecht des Ehegatten
§
757.
(1) Der Ehegatte
des Erblassers ist neben Kindern des Erblassers und deren Nachkommen zu
einem Drittel des Nachlasses, neben Eltern des Erblassers und deren
Nachkommen oder neben Großeltern zu zwei Dritteln des Nachlasses
gesetzlicher Erbe. Sind neben Großeltern Nachkommen verstorbener
Großeltern vorhanden, so erhält überdies der Ehegatte von dem restlichen
Drittel des Nachlasses den Teil, der nach den
§§ 739
und 740
den Nachkommen der verstorbenen Großeltern zufallen würde. Sind weder
gesetzliche Erben der ersten oder der zweiten Linie noch Großeltern
vorhanden, so erhält der Ehegatte den ganzen Nachlaß.
(2) In den Erbteil
des Ehegatten ist alles einzurechnen, was dieser durch Ehepakt oder
Erbvertrag aus dem Vermögen des Erblassers erhält.
§
758. Sofern der Ehegatte nicht rechtmäßig enterbt worden ist,
gebühren ihm als gesetzliches Vorausvermächtnis das Recht, in der
Ehewohnung weiter zu wohnen, und die zum ehelichen Haushalt gehörenden
beweglichen Sachen, soweit sie zu dessen Fortführung entsprechend den
bisherigen Lebensverhältnissen erforderlich sind.
§
759.
(1) Ein aus seinem
Verschulden geschiedener Ehegatte hat kein gesetzliches Erbrecht und
keinen Anspruch auf das gesetzliche Vorausvermächtnis.
(2) Das gesetzliche
Erbrecht und der Anspruch auf das gesetzliche Vorausvermächtnis ist dem
überlebenden Ehegatten auch dann versagt, wenn der Erblasser zur Zeit
seines Todes auf Scheidung oder Aufhebung der Ehe gemäß dem Ehegesetz vom
6. Juli 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 807) zu klagen berechtigt war und die
Klage erhoben hatte, sofern im Falle der Scheidung oder Aufhebung der
Ehegatte als schuldig anzusehen wäre.
Erblose
Verlassenschaft
§
760. Wenn kein zur Erbfolge Berechtigter vorhanden ist oder wenn
niemand die Erbschaft erwirbt, fällt die Verlassenschaft als ein erbloses
Gut dem Staate anheim.
Abweichungen von der
allgemeinen Erbfolgeordnung
§
761. Die Abweichungen von der in diesem Hauptstücke bestimmten
gesetzlichen Erbfolge in Rücksicht auf Bauerngüter, und die
Verlassenschaft geistlicher Personen sind in den politischen Gesetzen
enthalten.
Vierzehntes Hauptstück
Von dem Pflichtteile und der Anrechnung in den Pflicht- oder Erbteil
Welchen Personen als
Noterben ein Pflichtteil gebühre
§
762. Die Personen, die der Erblasser in der letzten Anordnung
bedenken muß, sind seine Kinder, in Ermangelung solcher seine Eltern, und
der Ehegatte.
§
763. Unter dem Namen Kinder werden nach der allgemeinen Regel (§
42) auch Enkel und Urenkel; und unter dem Namen Eltern alle Großeltern
begriffen. Es findet hier zwischen dem männlichen und weiblichen
Geschlechte; zwischen ehelicher und unehelicher Geburt kein Unterschied
statt, sobald für diese Personen das Recht und die Ordnung der
gesetzlichen Erbfolge eintreten würde.
§
764. Der Erbteil, welchen diese Personen zu fordern berechtigt
sind, heißt: Pflichtteil; sie selbst werden in dieser Rücksicht Noterben
genannt.
In welchem Betrage,
§
765. Als Pflichtteil gebührt jedem Kind und dem Ehegatten die
Hälfte dessen, was ihm nach der gesetzlichen Erbfolge zugefallen wäre.
§
766. In der aufsteigenden Linie gebührt jedem Noterben als
Pflichtteil ein Dritteil dessen, was er nach der gesetzlichen Erbfolge
erhalten haben würde.
und unter was für
Beschränkungen
§
767.
(1) Wer auf das
Erbrecht Verzicht geleistet hat; wer nach den in dem
achten Hauptstücke
enthaltenen Vorschriften von dem Erbrechte ausgeschlossen wird; oder von
dem Erblasser rechtmäßig enterbt worden ist; hat auf einen Pflichtteil
keinen Anspruch, und wird bei der Ausmessung desselben so betrachtet, als
wenn er gar nicht vorhanden wäre.
(2) Eine
Pflichtteilsminderung nach
§ 773a
erhöht den Pflichtteil der übrigen Noterben nicht.
Erfordernisse einer
rechtmäßigen Enterbung
§
768. Ein Kind kann enterbt werden
1.
aufgehoben
2. wenn es den
Erblasser im Notstande hilflos gelassen hat;
3. wenn es wegen
einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer
lebenslangen oder zwanzigjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist;
4. wenn es eine
gegen die öffentliche Sittlichkeit anstößige Lebensart beharrlich führt.
§
769. Aus den gleichen Gründen können auch der Ehegatte und die
Eltern enterbt werden; der Ehegatte außerdem dann, wenn er seine
Beistandspflicht gröblich vernachlässigt hat.
§
770. Überhaupt kann einem Noterben auch solcher Handlungen wegen,
die einen Erben nach den
§§ 540 -
542 des Erbrechtes unwürdig machen, durch die letzte Willenserklärung
der Pflichtteil entzogen werden.
§
771. Die Enterbungsursache muß immer, sie mag von dem Erblasser
ausgedrückt sein oder nicht, von dem Erben erwiesen werden, und in den
Worten, und dem Sinne des Gesetzes gegründet sein.
§
772. Die Enterbung wird nur durch einen ausdrücklichen in der
gesetzlichen Form erklärten Widerruf aufgehoben.
§
773. Wenn bei einem sehr verschuldeten oder verschwenderischen
Noterben das wahrscheinliche Besorgnis obwaltet, daß der ihm gebührende
Pflichtteil ganz, oder größten Teils seinen Kindern entgehen würde; so
kann ihm der Pflichtteil von dem Erblasser, jedoch nur dergestalt entzogen
werden, daß solcher den Kindern des Noterben zugewendet werde.
Pflichtteilsminderung
§
773a.
(1) Standen ein
Elternteil und sein Kind zu keiner Zeit in einem Naheverhältnis, wie es in
der Familie zwischen Eltern und Kindern gewöhnlich besteht, so mindert
sich der Pflichtteil dieses Elternteils oder seiner Vorfahren dem Kind und
seinen Nachkommen gegenüber und der des Kindes und seiner Nachkommen dem
Elternteil und seinen Vorfahren gegenüber, wenn es der Erblasser anordnet,
auf die Hälfte.
(2) Die
§§ 771
und 772
gelten sinngemäß für die Pflichtteilsminderung.
(3)
130) Das Recht auf
Pflichtteilsminderung steht nicht zu, wenn der Erblasser die Ausübung des
Rechts auf persönlichen Verkehr mit dem Pflichtteilsberechtigten grundlos
abgelehnt hat.
Wie der Pflichtteil
zu hinterlassen
§
774. Der Pflichtteil kann in Gestalt eines Erbteiles oder
Vermächtnisses, auch ohne ausdrückliche Benennung des Pflichtteiles
hinterlassen werden. Er muß aber dem Noterben ganz frei bleiben. Jede
denselben einschränkende Bedingung oder Belastung ist ungültig. Wird dem
Noterben ein größerer Erbteil zugedacht; so kann sie nur auf den Teil,
welcher den Pflichtteil übersteigt, bezogen werden.
Rechtsmittel des Noterben:
a) bei einer
widerrechtlichen Enterbung oder Verkürzung in dem Pflichtteile;
§
775. Ein Noterbe, welcher ohne die in den
§§ 768
bis 773 vorgeschriebenen Bedingungen enterbt worden, kann den ihm
gebührenden vollen Pflichtteil; und, wenn er in dem reinen Betrage des
Pflichtteils verkürzt worden ist, die Ergänzung desselben fordern.
b) bei einer
gänzlichen Übergehung
§
776. Wenn aus mehrern Kindern, deren Dasein dem Erblasser bekannt
war, eines ganz mit Stillschweigen übergangen wird; so kann es ebenfalls
nur den Pflichtteil fordern.
§
777. Wenn aber aus den Umständen erwiesen werden kann, daß die
Übergehung eines aus mehrern Kindern nur daher rühre, weil dem Erblasser
das Dasein desselben unbekannt war, so ist der Übergangene nicht schuldig,
sich mit dem Pflichtteile zu begnügen; sondern er kann den Erbteil,
welcher für den am mindesten begünstigten Noterben ausfällt; wofern aber
der einzige noch übrige Noterbe eingesetzt wird, oder alle übrige zu
gleichen Teilen berufen sind, einen gleichen Erbteil verlangen.
§
778. Hat der Erblasser einen einzigen Noterben, und er übergeht
ihn aus oben gedachtem Irrtume mit Stillschweigen; oder erhält ein
kinderloser Erblasser erst nach Erklärung seines letzten Willens einen
Noterben, für den keine Vorsehung getroffen ist; so werden nur die zu
öffentlichen Anstalten, zur Belohnung geleisteter Dienste, oder zu frommen
Absichten bestimmten Vermächtnisse in einem, den vierten Teil der reinen
Verlassenschaft nicht übersteigenden, Betrage verhältnismäßig entrichtet,
alle übrigen Anordnungen des letzten Willens aber gänzlich entkräftet. Sie
erlangen jedoch, wenn der Noterbe vor dem Erblasser verstorben ist, wieder
ihre Kraft.
§
779.
(1) Wenn ein Kind
vor dem Erblasser stirbt und Abstämmlinge hinterläßt; so treten diese mit
Stillschweigen übergangenen Abstämmlinge in Ansehung des Erbrechtes an die
Stelle des Kindes.
(2) Die Nachkommen
eines vorverstorbenen Noterben, dessen Pflichtteil gemindert worden ist,
können nur den geminderten Pflichtteil fordern.
§
780. Die Abstämmlinge eines enterbten Kindes sind bloß befugt, den
Pflichtteil zu verlangen, dies aber auch, wenn der Enterbte den Erblasser
überlebt hat.
§
781. Werden der Ehegatte oder die Eltern mit Stillschweigen
übergangen, so können sie nur den Pflichtteil fordern.
§
782. Wenn der Erbe beweisen kann, daß ein mit Stillschweigen
übergangener Noterbe sich einer der in den
§§ 768 -
770 angeführten Enterbungsursachen schuldig gemacht hat; so wird die
Übergehung als eine stillschweigende rechtliche Enterbung angesehen.
Wer zur Entrichtung
des Erb- oder Pflichtteils beizutragen habe
§
783. In allen Fällen, wo einem Noterben der gebührende Erb- oder
Pflichtteil gar nicht oder nicht vollständig ausgemessen worden ist,
müssen sowohl die eingesetzten Erben als auch die Legatare, nicht jedoch
der Ehegatte mit dem gesetzlichen Vorausvermächtnis, verhältnismäßig zur
vollständigen Entrichtung beitragen.
Art der Ausmessung
und Berechnung des Pflichtteiles
§
784. Um den Pflichtteil richtig ausmessen zu können, werden alle
zur Verlassenschaft gehörigen beweglichen und unbeweglichen Sachen, alle
Rechte und Forderungen, welche der Erblasser auf seine Nachfolger frei zu
vererben befugt war, selbst alles, was ein Erbe oder Legatar in die Masse
schuldig ist, genau beschrieben und geschätzt. Den Noterben steht frei,
der Schätzung beizuwohnen und ihre Erinnerungen dabei zu machen. Auf eine
Feilbietung der Verlassenschaftsstücke zur Erhebung des wahren Wertes kann
von ihnen nicht gedrungen werden. Schulden und andere Lasten, welche schon
bei Lebzeiten des Erblassers auf dem Vermögen hafteten, werden von der
Masse abgerechnet.
§
785.
(1) Auf Verlangen
eines pflichtteilsberechtigten Kindes oder des pflichtteilsberechtigten
Ehegatten sind bei der Berechnung des Nachlasses Schenkungen des
Erblassers in Anschlag zu bringen. Der Gegenstand der Schenkung ist dem
Nachlaß mit dem Wert hinzuzurechnen, der für die Anrechnung nach
§ 794
maßgebend ist.
(2) Das Recht nach
Abs. 1 steht einem Kind nur hinsichtlich solcher Schenkungen zu, die
der Erblasser zu einer Zeit gemacht hat, zu der er ein
pflichtteilsberechtigtes Kind gehabt hat, dem Ehegatten nur hinsichtlich
solcher Schenkungen, die während seiner Ehe mit dem Erblasser gemacht
worden sind.
(3) In jedem Fall
bleiben Schenkungen unberücksichtigt, die der Erblasser aus Einkünften
ohne Schmälerung seines Stammvermögens, zu gemeinnützigen Zwecken, in
Entsprechung einer sittlichen Pflicht oder aus Rücksichten des Anstandes
gemacht hat. Gleiches gilt für Schenkungen, die früher als zwei Jahre vor
dem Tod des Erblassers an nicht pflichtteilsberechtigte Personen gemacht
worden sind.
§
786. Der Pflichtteil wird ohne Rücksicht auf Vermächtnisse, und
andere aus dem letzten Willen entspringenden Lasten berechnet. Bis zur
wirklichen Zuteilung ist die Verlassenschaft, in Ansehung des Gewinnes und
der Nachteile, als ein zwischen den Haupt- und Noterben verhältnismäßig
gemeinschaftliches Gut zu betrachten.
Anrechnung zum
Pflichtteile;
§
787.
(1) Alles, was die
Noterben durch Legate oder andere Verfügungen des Erblassers wirklich aus
der Verlassenschaft erhalten, wird bei Bestimmung ihres Pflichtteiles in
Rechnung gebracht.
(2) Wenn bei
Bestimmung des Pflichtteiles Schenkungen in Anschlag zu bringen sind, muß
sich jeder Noterbe auf die dadurch bewirkte Erhöhung seines Pflichtteiles
die nach
§ 785 zum Nachlasse hinzuzurechnenden Geschenke anrechnen lassen, die
er selbst vom Erblasser erhalten hat.
§
788. Was der Erblasser bei Lebzeiten seiner Tochter oder Enkelin
zum Heiratsgute; seinem Sohne oder Enkel zur Ausstattung, oder unmittelbar
zum Antritte eines Amtes, oder was immer für eines Gewerbes gegeben; oder
zur Bezahlung der Schulden eines volljährigen Kindes verwendet hat, wird
in den Pflichtteil eingerechnet.
§
789. Überhaupt sind in den Pflichtteil die als Vorschuß darauf
geleisteten Zuwendungen des Erblassers unter Lebenden einzurechnen; in den
Pflichtteil des Ehegatten außerdem alles, was er als gesetzliches
Vorausvermächtnis (§
758) erhält.
oder zum Erbteile bei
der gesetzlichen Erbfolge
§
790. Die Anrechnung bei der Erbfolge der Kinder aus einem letzten
Willen geschieht nur dann, wenn sie von dem Erblasser ausdrücklich
verordnet wird. Dagegen muß auch bei der gesetzlichen Erbfolge ein Kind
sich dasjenige, was es von dem Erblasser bei dessen Lebenszeit zu den oben
(§ 788)
erwähnten Zwecken empfangen hat, anrechnen lassen. Einem Enkel wird nicht
nur das, was er unmittelbar selbst; sondern auch, was seine Eltern, in
deren Stelle er tritt, auf solche Art empfangen haben, in den Erbteil
eingerechnet.
§
791. Was Eltern außer den erwähnten Fällen einem Kinde zugewendet
haben, wird, wenn die Eltern nicht ausdrücklich die Erstattung sich
ausbedungen haben, für eine Schenkung gehalten, und nicht angerechnet.
§
792. Die Eltern können einem Kinde die Anrechnung auch bei der
gesetzlichen Erbfolge ausdrücklich erlassen. Wenn aber die nötige
Erziehung und Versorgung der übrigen Kinder weder aus ihrem eigenen, noch
aus dem Vermögen der Eltern bestritten werden könnte; so muß das Kind
dasjenige, was es zu den im
§ 788
erwähnten Zwecken in voraus empfangen hat, sich in dem Maße anrechnen
lassen, als es zur Erziehung für die Geschwister notwendig ist.
§
793. Die Anrechnung des Empfangenen zum Erbteile geschieht
dadurch, daß jedes Kind den nämlichen Betrag noch vor der Teilung erhält.
Ist die Verlassenschaft dazu nicht hinreichend; so kann zwar das früher
begünstigte Kind keinen Erbteil ansprechen, aber auch zu keiner Erstattung
angehalten werden.
§
794. Bei jeder Anrechnung wird, wenn das Empfangene nicht in barem
Gelde; sondern in andern beweglichen oder unbeweglichen Sachen bestand,
der Wert der letztern nach dem Zeitpunkte des Empfanges; der erstern
dagegen nach dem Zeitpunkte des Erbanfalles bestimmt.
Anspruch des Noterben
auf den notwendigen,
§
795. Einem Noterben, der von seinem Pflichtteile selbst
gesetzmäßig ausgeschlossen wird, muß doch immer der notwendige Unterhalt
ausgemessen werden.
und des Ehegatten auf
den Unterhalt
§
796. Der Ehegatte hat, außer in den Fällen der
§§ 759
und 795,
solange er sich nicht wiederverehelicht, an die Erben bis zum Wert der
Verlassenschaft einen Anspruch auf Unterhalt nach den sinngemäß
anzuwendenden Grundsätzen des
§ 94.
In diesen Anspruch ist alles einzurechnen, was der Ehegatte nach dem
Erblasser durch vertragliche oder letztwillige Zuwendung, als gesetzlichen
Erbteil, als Pflichtteil, durch öffentlich-rechtliche oder
privatrechtliche Leistung erhält; desgleichen eigenes Vermögen des
Ehegatten oder Erträgnisse einer von ihm tatsächlich ausgeübten oder einer
solchen Erwerbstätigkeit, die von ihm den Umständen nach erwartet werden
kann.
Fünfzehntes Hauptstück
Von Besitznehmung der Erbschaft
Bedingungen zur
rechtlichen Besitznehmung einer Erbschaft
§
797. Niemand darf eine Erbschaft eigenmächtig in Besitz nehmen.
Das Erbrecht muß vor Gericht verhandelt und von demselben die
Einantwortung des Nachlasses, das ist, die Übergabe in den rechtlichen
Besitz, bewirkt werden.
§
798. Wie weit das Gericht nach einem Todesfalle von Amts wegen
vorzugehen habe, und welche Fristen und Vorsichtsmittel bei diesem
Abhandlungsgeschäfte zu beobachten seien, bestimmen die besondern, über
das gerichtliche Verfahren bestehenden, Vorschriften. Hier wird
festgesetzt, was dem Erben, oder demjenigen, der sonst einen Anspruch an
die Verlassenschaft hat, zu tun obliege, um zu dem Besitze dessen, was ihm
gebührt, zu gelangen.
Ausweisung des
Rechtstitels: Erbserklärung
§
799. Wer eine Erbschaft in Besitz nehmen will, muß den
Rechtstitel, ob sie ihm aus einer letzten Anordnung; aus einem gültigen
Erbvertrage; oder aus dem Gesetze zufalle, dem Gerichte ausweisen, und
sich ausdrücklich erklären, daß er die Erbschaft annehme.
§
800. Die Antretung der Erbschaft oder die Erbserklärung muß
zugleich enthalten, ob sie unbedingt, oder mit Vorbehalt der Rechtswohltat
des Inventariums geschehe.
Wirkung der
unbedingten,
§
801. Die unbedingte Erbserklärung hat zur Folge, daß der Erbe
allen Gläubigern des Erblassers für ihre Forderungen, und allen Legataren
für ihre Vermächtnisse haften muß, wenngleich die Verlassenschaft nicht
hinreicht.
und der bedingten
Erklärung
§
802. Wird die Erbschaft mit Vorbehalt der rechtlichen Wohltat des
Inventariums angetreten; so ist sogleich vom Gerichte das Inventarium auf
Kosten der Masse aufzunehmen. Ein solcher Erbe wird den Gläubigern und
Legataren nur so weit verbunden, als die Verlassenschaft für ihre, und
auch seine eigenen, außer dem Erbrechte ihm zustehenden, Forderungen
hinreicht.
Berechtigung zur
bedingten oder unbedingten Antretung oder Ausschlagung der Erbschaft
§
803. Der Erblasser kann dem Erben den Vorbehalt dieser rechtlichen
Wohltat nicht benehmen, noch die Errichtung eines Inventariums verbieten.
Selbst der in einem Erbvertrage zwischen Ehegatten darauf geschehene
Verzicht ist von keiner Wirkung.
§
804. Die Errichtung des Inventariums kann auch von demjenigen
verlangt werden, dem ein Pflichtteil gebührt.
§
805. Wer seine Rechte selbst verwalten kann, dem steht frei, die
Erbschaft unbedingt, oder mit Vorbehalt der obigen Rechtswohltat
anzutreten oder auch auszuschlagen.131)
§
806. Der Erbe kann seine gerichtliche Erbserklärung nicht mehr
widerrufen, noch auch die unbedingte abändern, und sich die Rechtswohltat
des Inventariums vorbehalten.
§
807. Wenn aus mehrern Miterben einige unbedingt; andere aber, oder
auch nur einer aus ihnen mit Vorbehalt der erwähnten Rechtswohltat sich zu
Erben erklären; so ist ein Inventarium zu errichten und die auf diesen
Vorbehalt beschränkte Erbserklärung der Verlassenschaftsabhandlung zum
Grunde zu legen. In diesem, sowie in allen Fällen, in welchen ein
Inventarium errichtet werden muß, genießt auch derjenige, welcher eine
unbedingte Erbserklärung abgegeben hat, solange ihm die Erbschaft noch
nicht übergeben worden, die rechtliche Wohltat des Inventariums.
§
808. Wird jemand zum Erben eingesetzt, dem auch ohne letzte
Willenserklärung das Erbrecht ganz oder zum Teile gebührt hätte; so ist er
nicht befugt, sich auf die gesetzliche Erbfolge zu berufen und dadurch die
Erklärung des letzten Willens zu vereiteln. Er muß die Erbschaft entweder
aus dem letzten Willen antreten, oder ihr ganz entsagen. Personen aber,
denen ein Pflichtteil gebührt, können die Erbschaft mit Vorbehalt ihres
Pflichtteiles ausschlagen.
Übertragung des
Erbrechtes
§
809. Stirbt der Erbe eher, als er die angefallene Erbschaft
angetreten oder ausgeschlagen hat; so treten seine Erben, wenn der
Erblasser diese nicht ausgeschlossen, oder nicht andere Nacherben bestimmt
hat, in das Recht, die Erbschaft anzunehmen, oder auszuschlagen (§
537).
Vorkehrungen vor Einantwortung der Erbschaft:
a) Verwaltung;
§
810. Wenn der Erbe bei Antretung der Erbschaft sein Erbrecht
hinreichend ausweist, ist ihm die Besorgung und Benützung der
Verlassenschaft zu überlassen.
b) Sicherstellung
oder Befriedigung der Gläubiger;
§
811. Für die Sicherstellung oder Befriedigung der Gläubiger des
Erblassers wird vom Gerichte nicht weiter gesorgt, als sie selbst
verlangen. Die Gläubiger sind aber nicht schuldig, eine Erbserklärung
abzuwarten. Sie können ihre Ansprüche wider die Masse anbringen, und
begehren: daß zur Vertretung derselben ein Kurator bestellt werde, gegen
welchen sie ihre Forderungen ausführen können.
c) Absonderung der
Verlassenschaft von dem Vermögen des Erben;
§
812. Besorgt ein Erbschaftsgläubiger, ein Legatar, oder ein
Noterbe, daß er durch Vermengung der Verlassenschaft mit dem Vermögen des
Erben für seine Forderung Gefahr laufen könne; so kann er vor der
Einantwortung verlangen, daß die Erbschaft von dem Vermögen des Erben
abgesondert, vom Gerichte verwahrt, oder von einem Kurator verwaltet, sein
Anspruch darauf vorgemerkt und berichtigt werde. In einem solchen Falle
hat ihm aber der Erbe, obschon dieser sich unbedingt als Erbe erklärt
hätte, aus eigenem Vermögen nicht mehr zu haften.
d) Einberufung der
Verlassenschaftsgläubiger
§
813. Dem Erben oder dem aufgestellten Verlassenschaftskurator
steht es frei, zur Erforschung des Schuldenstandes die Ausfertigung eines
Ediktes, wodurch alle Gläubiger zur Anmeldung und Dartuung ihrer
Forderungen auf eine den Umständen angemessene Zeit einberufen werden,
nachzusuchen, und bis nach verstrichener Frist mit der Befriedigung der
Gläubiger innezuhalten.
Wirkung der
Einberufung;
§
814. Die Wirkung dieser gerichtlichen Einberufung ist, daß den
Gläubigern, welche sich binnen der bestimmten Zeitfrist nicht gemeldet
haben, an die Verlassenschaft, wenn sie durch die Bezahlung der
angemeldeten Forderungen erschöpft worden ist, kein weiterer Anspruch
zusteht, als insofern ihnen ein Pfandrecht gebührt.
oder, der
Unterlassung derselben
§
815. Unterläßt der Erbe die ihm bewilligte Vorsicht der
gerichtlichen Einberufung; oder befriedigt er sogleich einige der sich
anmeldenden Gläubiger, ohne auf die Rechte der übrigen Rücksicht zu
nehmen, und bleiben einige Gläubiger aus Unzulänglichkeit der
Verlassenschaft unbezahlt; so haftet er ihnen, ungeachtet der bedingten
Erbserklärung, mit seinem ganzen Vermögen in dem Maße, als sie die Zahlung
erhalten haben würden, wenn die Verlassenschaft nach der gesetzlichen
Ordnung zur Befriedigung der Gläubiger verwendet worden wäre.
e) Ausweisung über
die Erfüllung des letzten Willens, entweder von dem Testaments-Exekutor;
§
816. Hat der Erblasser einen Vollzieher (Exekutor) seines letzten
Willens ernannt; so hängt es von dessen Willkür ab, dieses Geschäft auf
sich zu nehmen. Hat er es übernommen, so ist er schuldig, entweder als ein
Machthaber die Anordnungen des Erblassers selbst zu vollziehen, oder den
saumseligen Erben zur Vollziehung derselben zu betreiben.
oder dem Erben
§
817. Ist kein Vollzieher des letzten Willens ernannt; oder,
unterzieht sich der ernannte dem Geschäfte nicht; so liegt dem Erben
unmittelbar ob, den Willen des Erblassers so viel möglich zu erfüllen,
oder die Erfüllung sicherzustellen, und sich gegen das Gericht darüber
auszuweisen. In Ansehung bestimmter Legatare hat er bloß darzutun, daß er
denselben von dem ihnen zugefallenen Vermächtnisse Nachricht gegeben habe
(§ 688).
§
818. Was der Erbe, ehe er zum Besitze der Erbschaft gelangen kann,
an Abgaben zu entrichten, und im Falle, daß sein Erblasser gegen das
Staatsärarium in Verrechnung gestanden ist, hierwegen auszuweisen habe,
darüber enthalten die politischen Verordnungen die besondere Vorschrift.
Wann die Erbschaft
einzuantworten
§
819. Sobald über die eingebrachte Erbserklärung der rechtmäßige
Erbe vom Gerichte erkannt, und von demselben die Erfüllung der
Verbindlichkeiten geleistet ist, wird ihm die Erbschaft eingeantwortet und
die Abhandlung geschlossen. Übrigens hat der Erbe, um die Übertragung des
Eigentumes unbeweglicher Sachen zu erwirken, die Vorschrift des
§ 436
zu befolgen.
Haftung der
gemeinschaftlichen Erben
§
820. Mehrere Erben, welche eine gemeinschaftliche Erbschaft ohne
die rechtliche Wohltat des Inventariums angetreten haben, haften allen
Erbschaftsgläubigern und Legataren, selbst nach der Einantwortung, alle
für einen und einer für alle. Unter sich aber sind sie nach Verhältnis
ihrer Erbteile beizutragen schuldig.
§
821. Haben die gemeinschaftlichen Erben von der rechtlichen
Wohltat des Inventariums Gebrauch gemacht; so sind sie vor der
Einantwortung den Erbschaftsgläubigern und Legataren nach dem
§ 550
zu haften verbunden. Nach der erfolgten Einantwortung haftet jeder
Einzelne selbst für die, die Erbschaftsmasse nicht übersteigenden, Lasten
nur nach Verhältnis seines Erbteiles.
Sicherheitsmittel der
Gläubiger des Erben
§
822. Vor der Einantwortung können Gläubiger des Erben nur auf die
einzelnen Bestandteile des Nachlasses Exekution führen, über welche dem
Erben vom Nachlaßgerichte die freie Verfügung überlassen worden ist.
Erbschaftsklagen
§
823. Auch nach erhaltener Einantwortung kann der Besitznehmer von
jenem, der ein besseres oder gleiches Erbrecht zu haben behauptet, auf
Abtretung oder Teilung der Erbschaft belangt werden. Das Eigentum
einzelner Erbschaftsstücke wird nicht mit der Erbschafts-, sondern der
Eigentumsklage verfolgt.
Wirkung derselben
§
824. Wenn der Beklagte zur Abtretung der Verlassenschaft ganz oder
zum Teile verhalten wird; so sind die Ansprüche auf die Zurückstellung der
von dem Besitzer bezogenen Früchte; oder auf die Vergütung der von
demselben in dem Nachlasse verwendeten Kosten nach jenen Grundsätzen zu
beurteilen, welche in Rücksicht auf den redlichen oder unredlichen
Besitzer in dem
Hauptstücke vom Besitze überhaupt festgesetzt sind. Ein dritter
redlicher Besitzer ist für die in der Zwischenzeit erworbenen Erbstücke
niemandem verantwortlich.
Sechzehntes Hauptstück
Von der Gemeinschaft des Eigentums und anderer dinglichen Rechte
Ursprung einer
Gemeinschaft
§
825. So oft das Eigentum der nämlichen Sache, oder ein und
dasselbe Recht mehreren Personen ungeteilt zukommt; besteht eine
Gemeinschaft. Sie gründet sich auf eine zufällige Ereignung; auf ein
Gesetz; auf eine letzte Willenserklärung; oder auf einen Vertrag.
§
826. Nach Verschiedenheit der Quellen, aus denen eine Gemeinschaft
entspringt, erhalten auch die Rechte und Pflichten der Teilhaber ihre
nähere Bestimmung. Die besondern Vorschriften über eine durch Vertrag
entstehende Gemeinschaft der Güter sind in dem
siebenundzwanzigsten Hauptstücke enthalten.
§
827. Wer einen Anteil an einer gemeinschaftlichen Sache anspricht,
der muß sein Recht, wenn es von den übrigen Teilnehmern widersprochen
wird, beweisen.
Gemeinschaftliche
Rechte der Teilhaber
§
828.
(1) Solange alle
Teilhaber einverstanden sind, stellen sie nur eine Person vor, und haben
das Recht, mit der gemeinschaftlichen Sache nach Belieben zu schalten.
Sobald sie uneinig sind, kann kein Teilhaber in der gemeinschaftlichen
Sache eine Veränderung vornehmen, wodurch über den Anteil des andern
verfügt würde.
(2) ) Eine
gerichtliche oder vertraglich vereinbarte Benützungsregelung zwischen den
Teilhabern einer unbeweglichen Sache wirkt auch für deren
Rechtsnachfolger, wenn sie im Grundbuch angemerkt ist.
Rechte des Teilhabers
auf seinen Anteil
§
829. Jeder Teilhaber ist vollständiger Eigentümer seines Anteiles.
Insofern er die Rechte seiner Mitgenossen nicht verletzt, kann er
denselben, oder die Nutzungen davon willkürlich und unabhängig verpfänden,
vermachen, oder sonst veräußern (§
361).
§
830. Jeder Teilhaber ist befugt, auf Ablegung der Rechnung und auf
Verteilung des Ertrages zu dringen. Er kann in der Regel auch die
Aufhebung der Gemeinschaft verlangen; doch nicht zur Unzeit, oder zum
Nachteile der übrigen. Er muß sich daher einen, den Umständen
angemessenen, nicht wohl vermeidlichen Aufschub gefallen lassen.
§
831. Hat sich ein Teilhaber zur Fortsetzung der Gemeinschaft
verbunden, so kann er zwar vor Verlauf der Zeit nicht austreten; allein
diese Verbindlichkeit wird, wie andere Verbindlichkeiten, aufgehoben, und
erstreckt sich nicht auf die Erben, wenn diese nicht selbst dazu
eingewilligt haben.
§
832. Auch die Anordnung eines Dritten, wodurch eine Sache zur
Gemeinschaft bestimmt wird, muß zwar von den ersten Teilhabern, nicht auch
von ihren Erben befolgt werden. Eine Verbindlichkeit zu einer
immerwährenden Gemeinschaft kann nicht bestehen.
Rechte der Teilhaber in der gemeinschaftlichen Sache:
a) In Rücksicht des
Hauptstammes;
§
833. Der Besitz und die Verwaltung der gemeinschaftlichen Sache
kommt allen Teilhabern insgesamt zu. In Angelegenheiten, welche nur die
ordentliche Verwaltung und Benützung des Hauptstammes betreffen,
entscheidet die Mehrheit der Stimmen, welche nicht nach den Personen,
sondern nach Verhältnis der Anteile der Teilnehmer gezählt werden.
§
834. Bei wichtigen Veränderungen aber, welche zur Erhaltung oder
besseren Benützung des Hauptstammes vorgeschlagen werden, können die
Überstimmten Sicherstellung für künftigen Schaden; oder, wenn diese
verweigert wird, den Austritt aus der Gemeinschaft verlangen.
§
835. Wollen sie nicht austreten; oder geschähe der Austritt zur
Unzeit; so soll das Los, ein Schiedsmann, oder, wofern sie sich darüber
nicht einhellig vereinigen, der Richter entscheiden, ob die Veränderung
unbedingt oder gegen Sicherstellung stattfinden soll oder nicht. Diese
Arten der Entscheidung treten auch bei gleichen Stimmen der Mitglieder
ein.
§
836. Ist ein Verwalter der gemeinschaftlichen Sachen zu bestellen;
so entscheidet über dessen Auswahl die Mehrheit der Stimmen, und in deren
Abgang der Richter.
§
837. Der Verwalter des gemeinschaftlichen Gutes wird als ein
Machthaber angesehen. Er ist einerseits verbunden, ordentliche Rechnung
abzulegen; andererseits aber befugt, alle nützlich gemachte Auslagen in
Abrechnung zu bringen. Dieses gilt auch in dem Falle, daß ein Teilgenosse
ein gemeinschaftliches Gut ohne Auftrag der übrigen Teilnehmer verwaltet.
§
838. Wird die Verwaltung mehrern überlassen; so entscheidet auch
unter ihnen die Mehrheit der Stimmen.
b) der Nutzungen und
Lasten;
§
839. Die gemeinschaftlichen Nutzungen und Lasten werden nach
Verhältnis der Anteile ausgemessen. Im Zweifel wird jeder Anteil gleich
groß angesehen; wer das Gegenteil behauptet, muß es beweisen.
§
840. Ordentlicher Weise sind die erzielten Nutzungen in Natur zu
teilen. Ist aber diese Verteilungsart nicht tunlich; so ist jeder
berechtigt, auf die öffentliche Feilbietung zu dringen. Der gelöste Wert
wird den Teilhabern verhältnismäßig entrichtet.
c) der Teilung
§
841. Bei der nach aufgehobener Gemeinschaft vorzunehmenden Teilung
der gemeinschaftlichen Sache gilt keine Mehrheit der Stimmen. Die Teilung
muß zur Zufriedenheit eines jeden Sachgenossen vorgenommen werden. Können
sie nicht einig werden; so entscheidet das Los, oder ein Schiedsmann,
oder, wenn sie sich über die Bestimmung der einen oder andern dieser
Entscheidungsarten nicht einhellig vereinigen, der Richter.
§
842. Ein Schiedsmann oder der Richter entscheidet auch, ob bei der
Teilung liegender Gründe oder Gebäude ein Teilgenosse, zur Benützung
seines Anteiles, einer Servitut bedürfe, und unter welcher Bedingung sie
ihm zu verwilligen sei.
§
843. Kann eine gemeinschaftliche Sache entweder gar nicht, oder
nicht ohne beträchtliche Verminderung des Wertes geteilt werden; so ist
sie, und zwar, wenn auch nur ein Teilgenosse es verlangt, vermittelst
gerichtlicher Feilbietung zu verkaufen, und der Kaufschilling unter die
Teilhaber zu verteilen.
§
844. Servituten, Grenzzeichen und die zum gemeinschaftlichen
Gebrauche nötigen Urkunden sind keiner Teilung fähig. Die Urkunden werden,
wenn sonst nichts im Wege steht, bei dem ältesten Teilhaber niedergelegt.
Die übrigen erhalten auf ihre Kosten beglaubigte Abschriften. Die
Grunddienstbarkeiten bestehen mangels Vereinbarung zugunsten aller Teile
fort; jedoch darf die Dienstbarkeit dadurch nicht erweitert oder für das
dienstbare Gut beschwerlicher werden. Kommt die Ausübung der Dienstbarkeit
nur einzelnen Teilen zugute, so erlischt das Recht hinsichtlich der
übrigen Teile.
§
845. Bei Teilungen der Grundstücke sind die gegenseitigen Grenzen
durch entsprechende Grenzzeichen auf eine deutliche und unwandelbare Art
zu bezeichnen.
§
846. Über die gemachte Teilung sind Urkunden zu errichten. Ein
Teilhaber einer unbeweglichen Sache erhält auch erst dadurch ein
dingliches Recht auf seinen Anteil, daß die darüber errichtete Urkunde den
öffentlichen Büchern einverleibt wird (§
436).
§
847. Die bloße Teilung was immer für eines gemeinschaftlichen
Gutes kann einem Dritten nicht zum Nachteile gereichen; alle ihm
zustehenden Pfand-, Servituts- und anderen dinglichen Rechte werden nach
wie vor der Teilung ausgeübt. Trifft jedoch die Ausübung einer
Grunddienstbarkeit nur ein Teilstück, so erlischt das Recht hinsichtlich
der übrigen Teile.
§
848. Auch persönliche Rechte, die einem Dritten gegen eine
Gemeinschaft zustehen, haben ungeachtet des erfolgten Austrittes ihre
vorige Kraft. Ebenso kann derjenige, welcher an eine Gemeinschaft schuldig
ist, die Zahlung nicht an einzelne Teilnehmer entrichten. Solche Schulden
müssen an die ganze Gemeinschaft oder an jenen, der sie ordentlich
vorstellt, abgetragen werden.
§
848a. Gewährt eine Dienstbarkeit oder eine andere dingliche Last
einen Anspruch auf Nutzungen, so kann bei Teilung des herrschenden
Grundstückes jeder Berechtigte und bei Teilung des belasteten Grundstückes
jeder Belastete eine gerichtliche Regelung der Ausübung begehren. Die
Ausübung ist mit Rücksicht auf die Natur und Zweckbestimmung des Rechtes
sowie auf das Größenverhältnis und die wirtschaftliche Besonderheit der
einzelnen Liegenschaftsteile ohne Erschwerung der Last so zu regeln, wie
es allen Interessen billigerweise entspricht.
§
849. Was bisher von der Gemeinschaft überhaupt bestimmt worden
ist, läßt sich auch auf die einer Familie, als einer Gemeinschaft,
zustehenden Rechte und Sachen, z. B. Stiftungen, [Fideikommisse] u. dgl.
anwenden.
Erneuerung und
Berichtigung der Grenzen
§
850. Wenn die Grenzzeichen zwischen zwei Grundstücken durch was
immer für Umstände so verletzt worden sind, daß sie ganz unkenntlich
werden könnten, oder wenn die Grenzen wirklich unkennbar oder streitig
sind, so hat jeder der Nachbarn das Recht, die gerichtliche Erneuerung
oder Berichtigung der Grenze zu verlangen. Zu diesem Behufe sind die
Nachbarn zu einer Verhandlung im Verfahren außer Streitsachen mit dem
Bedeuten zu laden, daß trotz Ausbleibens des Geladenen die Grenze
festgesetzt und vermarkt werden wird.
§
851.
(1) Sind die
Grenzen wirklich unkennbar geworden oder streitig, so werden sie nach dem
letzten ruhigen Besitzstande festgesetzt. Läßt sich dieser nicht
feststellen, so hat das Gericht die streitige Fläche nach billigem
Ermessen zu verteilen.
(2) Jeder Partei
bleibt es vorbehalten, ihr besseres Recht im Prozeßweg geltend zu machen.
§
852. Die wichtigsten Behelfe bei einer Grenzberichtigung sind: die
Ausmessung und Beschreibung, oder auch die Abzeichnung des streitigen
Grundes; dann, die sich darauf beziehenden öffentlichen Bücher und andere
Urkunden; endlich, die Aussagen sachkundiger Zeugen, und das von
Sachverständigen nach vorgenommenem Augenscheine gegebene Gutachten.
§
853.
(1) Die Kosten des
Verfahrens sind von den Nachbarn nach Maß ihrer Grenzlinien zu bestreiten.
Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, wenn sich aus
der Verhandlung ergibt, daß die Grenzerneuerung oder Grenzberichtigung
nicht notwendig war, weil die Grenze nicht bestritten oder hinlänglich
kenntlich gewesen ist, oder weil die anderen Beteiligten zur
außergerichtlichen Vermarkung bereit waren. Die Kosten einer Vertretung
hat der Vertretene selbst zu tragen.
(2) Wenn das
Verfahren durch Störung des ruhigen Besitzes veranlaßt wurde, kann das
Gericht die Kosten ganz oder teilweise der Partei auferlegen, die den
Streit veranlaßt hat.
§
853a. Für Grenzen von Grundstücken, die im Grenzkataster enthalten
sind, finden die Bestimmungen der
§§ 850
bis 853 keine Anwendung.
Vermutete
Gemeinschaft
§
854. Erdfurchen, Zäune, Hecken, Planken, Mauern, Privatbäche,
Kanäle, Plätze und andere dergleichen Scheidewände, die sich zwischen
benachbarten Grundstücken befinden, werden für ein gemeinschaftliches
Eigentum angesehen; wenn nicht Wappen, Auf- oder Inschriften, oder andere
Kennzeichen und Behelfe das Gegenteil beweisen.
§
855. Jeder Mitgenosse kann eine gemeinschaftliche Mauer auf seiner
Seite bis zur Hälfte in der Dicke benützen, auch Blindtüren und
Wandschränke dort anbringen, wo auf der entgegengesetzten Seite noch keine
angebracht sind. Doch darf das Gebäude durch einen Schornstein, Feuerherd
oder andere Anlagen nicht in Gefahr gesetzt, und der Nachbar auf keine Art
in dem Gebrauche seines Anteiles gehindert werden.
§
856. Alle Miteigentümer tragen zur Erhaltung solcher
gemeinschaftlichen Scheidewände verhältnismäßig bei. Wo sie doppelt
vorhanden sind; oder das Eigentum geteilt ist, bestreitet jeder die
Unterhaltungskosten für das, was ihm allein gehört.
§
857. Ist die Stellung einer Scheidewand von der Art, daß die
Ziegel, Latten oder Steine nur auf einer Seite vorlaufen oder abhängen;
oder sind die Pfeiler, Säulen, Ständer, Bachställe auf einer Seite
eingegraben; so ist im Zweifel auf dieser Seite das ungeteilte Eigentum
der Scheidewand, wenn nicht aus einer beiderseitigen Belastung, Einfügung,
aus andern Kennzeichen, oder sonstigen Beweisen das Gegenteil erhellt.
Auch derjenige wird für den ausschließenden Besitzer einer Mauer gehalten,
welcher eine in der Richtung gleich fortlaufende Mauer von gleicher Höhe
und Dicke unstreitig besitzt.
§
858. In der Regel ist der ausschließende Besitzer nicht schuldig,
seine verfallene Mauer oder Planke neu aufzuführen; nur dann muß er sie in
gutem Stande erhalten, wenn durch die Öffnung für den Grenznachbar Schaden
zu befürchten stünde. Es ist aber jeder Eigentümer verbunden, auf der
rechten Seite seines Haupteinganges für die nötige Einschließung seines
Raumes, und für die Abteilung von dem fremden Raume zu sorgen.
Zweite Abteilung
Von den persönlichen Sachenrechten
Siebzehntes Hauptstück
Von Verträgen und Rechtsgeschäften überhaupt
Grund der
persönlichen Sachenrechte
§
859. Die persönlichen Sachenrechte, vermöge welcher eine Person
einer andern zu einer Leistung verbunden ist, gründen sich unmittelbar auf
ein Gesetz; oder auf ein Rechtsgeschäft; oder auf eine erlittene
Beschädigung.
Auslobung
§
860. Die nicht an bestimmte Personen gerichtete Zusage einer
Belohnung für eine Leistung oder einen Erfolg (Auslobung) wird durch die
öffentliche Bekanntmachung verbindlich. Eine Auslobung, die eine
Preisbewerbung zum Gegenstande hat, ist nur gültig, wenn in der
Bekanntmachung eine Frist für die Bewerbung bestimmt ist.
§
860a. Bis zur Vollendung der Leistung kann die Auslobung in
derselben Form, in welcher sie bekannt gemacht war, oder einer gleich
wirksamen Form, oder durch besondere Mitteilung widerrufen werden, wenn
anders darauf in der Bekanntmachung nicht ausdrücklich oder durch
Bestimmung einer Frist verzichtet ist. Der Widerruf ist aber unwirksam
gegenüber demjenigen, der die Leistung im Hinblick auf die Auslobung
vollbracht hat, wenn er dartut, daß der Widerruf ihm zu dieser Zeit ohne
sein Verschulden nicht bekannt geworden war.
§
860b. Ist die Leistung von mehreren Personen vollbracht worden, so
gebührt, falls nicht aus der Auslobung ein anderer Wille hervorgeht, die
Belohnung demjenigen, der die Leistung zuerst vollbracht hat, und bei
gleichzeitiger Vollendung allen zu gleichen Teilen.
Abschließung des
Vertrages
§
861. Wer sich erklärt, daß er jemandem sein Recht übertragen, das
heißt, daß er ihm etwas gestatten, etwas geben, daß er für ihn etwas tun,
oder seinetwegen etwas unterlassen wolle, macht ein Versprechen; nimmt
aber der andere das Versprechen gültig an, so kommt durch den
übereinstimmenden Willen beider Teile ein Vertrag zustande. Solange die
Unterhandlungen dauern, und das Versprechen noch nicht gemacht oder weder
zum voraus, noch nachher angenommen ist, entsteht kein Vertrag.
§
862. Das Versprechen (Antrag) muß innerhalb der vom Antragsteller
bestimmten Frist angenommen werden. In Ermanglung einer solchen muß der
einem Anwesenden oder mittels Fernsprechers von Person zu Person gemachte
Antrag sogleich, der sonst einem Abwesenden gemachte Antrag längstens bis
zu dem Zeitpunkte angenommen werden, in welchem der Antragsteller unter
der Voraussetzung, daß sein Antrag rechtzeitig angekommen sei, bei
rechtzeitiger und ordnungsmäßiger Absendung der Antwort deren Eintreffen
erwarten darf; widrigenfalls ist der Antrag erloschen. Vor Ablauf der
Annahmefrist kann der Antrag nicht zurückgenommen werden. Er erlischt auch
nicht, wenn ein Teil während der Annahmefrist stirbt oder handlungsunfähig
wird, sofern nicht ein anderer Wille des Antragstellers aus den Umständen
hervorgeht.
§
862a. Als rechtzeitig gilt die Annahme, wenn die Erklärung
innerhalb der Annahmefrist dem Antragsteller zugekommen ist. Trotz ihrer
Verspätung kommt jedoch der Vertrag zustande, wenn der Antragsteller
erkennen mußte, daß die Annahmeerklärung rechtzeitig abgesendet wurde, und
gleichwohl seinen Rücktritt dem andern nicht unverzüglich anzeigt.
§
863.
(1) Man kann seinen
Willen nicht nur ausdrücklich durch Worte und allgemein angenommene
Zeichen; sondern auch stillschweigend durch solche Handlungen erklären,
welche mit Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen Grund, daran zu
zweifeln, übrig lassen.
(2) In bezug auf
die Bedeutung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen ist auf die im
redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rücksicht zu
nehmen.
§
864.
(1) Ist eine
ausdrückliche Erklärung der Annahme nach der Natur des Geschäftes oder der
Verkehrssitte nicht zu erwarten, so kommt der Vertrag zustande, wenn dem
Antrag innerhalb der hierfür bestimmten oder den Umständen angemessenen
Frist tatsächlich entsprochen worden ist.
(2) Das Behalten,
Verwenden oder Verbrauchen einer Sache, die dem Empfänger ohne seine
Veranlassung übersandt worden ist, gilt nicht als Annahme eines Antrags.
Der Empfänger ist nicht verpflichtet, die Sache zu verwahren oder
zurückzuleiten, er darf sich ihrer auch entledigen. Muß ihm jedoch nach
den Umständen auffallen, daß die Sache irrtümlich an ihn gelangt ist, so
hat er in angemessener Frist dies dem Absender mitzuteilen oder die Sache
an den Absender zurückzuleiten.
§
864a. Bestimmungen ungewöhnlichen Inhaltes in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblättern, die ein Vertragsteil
verwendet hat, werden nicht Vertragsbestandteil, wenn sie dem anderen Teil
nachteilig sind und er mit ihnen auch nach den Umständen, vor allem nach
dem äußeren Erscheinungsbild der Urkunde, nicht zu rechnen brauchte; es
sei denn, der eine Vertragsteil hat den anderen besonders darauf
hingewiesen.
Erfordernisse eines gültigen Vertrages:
1. Fähigkeiten der
Personen
§
865. Kinder unter sieben Jahren und Personen über sieben Jahre,
die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, sind – außer in den Fällen des
§
151 Abs. 3 – unfähig, ein Versprechen zu machen oder es anzunehmen.
Andere Minderjährige oder Personen, denen ein Sachwalter bestellt ist,
können zwar ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Versprechen annehmen;132)
wenn sie aber eine damit verknüpfte Last übernehmen oder selbst etwas
versprechen, hängt – außer in den Fällen des
§
151 Abs. 3 und des
§
273a Abs. 2 – die Gültigkeit des Vertrages nach den in dem
dritten und
vierten Hauptstück
des ersten Teiles gegebenen Vorschriften in der Regel von der
Einwilligung des Vertreters oder zugleich des Gerichtes ab. Bis diese
Einwilligung erfolgt, kann der andere Teil nicht zurücktreten, aber eine
angemessene Frist zur Erklärung verlangen.
§
866. aufgehoben133)
§
867. Was zur Gültigkeit eines Vertrages mit einer unter der
besondern Vorsorge der öffentlichen Verwaltung stehenden Gemeinde (§
27), oder ihren einzelnen Gliedern und Stellvertretern erfordert
werde, ist aus der Verfassung derselben und den politischen Gesetzen zu
entnehmen (§
290).
§
868. aufgehoben
2. Wahre Einwilligung
§
869. Die Einwilligung in einen Vertrag muß frei, ernstlich,
bestimmt und verständlich erklärt werden. Ist die Erklärung
unverständlich; ganz unbestimmt; oder erfolgt die Annahme unter anderen
Bestimmungen, als unter welchen das Versprechen geschehen ist; so entsteht
kein Vertrag. Wer sich, um einen andern zu bevorteilen, undeutlicher
Ausdrücke bedient, oder eine Scheinhandlung unternimmt, leistet
Genugtuung.
§
870. Wer von dem anderen Teile durch List oder durch ungerechte
und gegründete Furcht (§
55) zu einem Vertrage veranlaßt worden, ist ihn zu halten nicht
verbunden.
§
871.
(1) War ein Teil
über den Inhalt der von ihm abgegebenen oder dem anderen zugegangenen
Erklärung in einem Irrtum befangen, der die Hauptsache oder eine
wesentliche Beschaffenheit derselben betrifft, worauf die Absicht
vorzüglich gerichtet und erklärt wurde, so entsteht für ihn keine
Verbindlichkeit, falls der Irrtum durch den anderen veranlaßt war, oder
diesem aus den Umständen offenbar auffallen mußte oder noch rechtzeitig
aufgeklärt wurde.
(2) Ein Irrtum
eines Teiles über einen Umstand, über den ihn der andere nach geltenden
Rechtsvorschriften aufzuklären gehabt hätte, gilt immer als Irrtum über
den Inhalt des Vertrages und nicht bloß als solcher über den
Bewegungsgrund oder den Endzweck (§
901).
§
872. Betrifft aber der Irrtum weder die Hauptsache, noch eine
wesentliche Beschaffenheit derselben, sondern einen Nebenumstand; so
bleibt der Vertrag, insofern beide Teile in den Hauptgegenstand gewilligt,
und den Nebenumstand nicht als vorzügliche Absicht erklärt haben, noch
immer gültig: allein dem Irregeführten ist von dem Urheber des Irrtumes
die angemessene Vergütung zu leisten.
§
873. Ebendiese Grundsätze sind auch auf den Irrtum in der Person
desjenigen, welchem ein Versprechen gemacht worden ist, anzuwenden;
insofern ohne den Irrtum der Vertrag entweder gar nicht, oder doch nicht
auf solche Art errichtet worden wäre. Als Irrtum in der Person gilt
jedenfalls der Irrtum über das Vorhandensein einer erforderlichen
verwaltungsrechtlichen Befugnis zur Erbringung der Leistung.
§
874. In jedem Falle muß derjenige, welcher einen Vertrag durch
List oder ungerechte Furcht bewirkt hat, für die nachteiligen Folgen
Genugtuung leisten.
§
875. Ist einer der Vertragschließenden von einem Dritten durch
List oder durch ungerechte und gegründete Furcht zu einem Vertrage
bewogen; oder zu einer irrtümlichen Erklärung veranlaßt worden; so ist der
Vertrag gültig. Nur in dem Falle, daß der andere Teil an der Handlung des
Dritten teilnahm oder von derselben offenbar wissen mußte, kommen die
§§ 870
bis 874 zur Anwendung.
§
876. Die vorstehenden Bestimmungen (§§
869 bis 875) finden entsprechende Anwendung auf sonstige
Willenserklärungen, welche einer anderen Person gegenüber abzugeben sind.
§
877. Wer die Aufhebung eines Vertrages aus Mangel der Einwilligung
verlangt, muß dagegen auch alles zurückstellen, was er aus einem solchen
Vertrage zu seinem Vorteile erhalten hat.
3. Möglichkeit und
Erlaubtheit
§
878. Was geradezu unmöglich ist, kann nicht Gegenstand eines
gültigen Vertrages werden. Ist Mögliches und Unmögliches zugleich
bedungen, so bleibt der Vertrag in ersterem Teile gültig, wenn anders aus
dem Vertrage nicht hervorgeht, daß kein Punkt von dem anderen abgesondert
werden könne. Wer bei Abschließung des Vertrages die Unmöglichkeit kannte
oder kennen mußte, hat dem anderen Teile, falls von diesem nicht dasselbe
gilt, den Schaden zu ersetzen, den er durch das Vertrauen auf die
Gültigkeit des Vertrages erlitten hat.
§
879.
(1) Ein Vertrag,
der gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt,
ist nichtig.
(2) Insbesondere
sind folgende Verträge nichtig:
1. wenn etwas für
die Unterhandlung eines Ehevertrages bedungen wird;
1a. wenn etwas für
die Vermittlung einer medizinisch unterstützten Fortpflanzung bedungen
wird;
2. wenn ein
Rechtsfreund eine ihm anvertraute Streitsache ganz oder teilweise an sich
löst oder sich einen bestimmten Teil des Betrages versprechen läßt, der
der Partei zuerkannt wird;
3. wenn eine
Erbschaft oder ein Vermächtnis, die man von einer dritten Person erhofft,
noch bei Lebzeiten derselben veräußert wird;
4. wenn jemand den
Leichtsinn, die Zwangslage, Verstandesschwäche, Unerfahrenheit oder
Gemütsaufregung eines anderen dadurch ausbeutet, daß er sich oder einem
Dritten für eine Leistung eine Gegenleistung versprechen oder gewähren
läßt, deren Vermögenswert zu dem Werte der Leistung in auffallendem
Mißverhältnisse steht.
(3) Eine in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblättern enthaltene
Vertragsbestimmung, die nicht eine der beiderseitigen Hauptleistungen
festlegt, ist jedenfalls nichtig, wenn sie unter Berücksichtigung aller
Umstände des Falles einen Teil gröblich benachteiligt.
§
880. Wird der Gegenstand, worüber ein Vertrag geschlossen worden,
vor dessen Übergabe dem Verkehre entzogen; so ist es ebensoviel, als wenn
man den Vertrag nicht geschlossen hätte.
§
880a. Hat jemand einem andern eine Leistung eines Dritten
versprochen, so gilt dies als Zusage seiner Verwendung bei dem Dritten;
ist er aber für den Erfolg eingestanden, so haftet er für volle
Genugtuung, wenn die Leistung des Dritten ausbleibt.
Verträge zugunsten
Dritter
§
881.
(1) Hat sich jemand
eine Leistung an einen Dritten versprechen lassen, so kann er fordern, daß
an den Dritten geleistet werde.
(2) Ob und in
welchem Zeitpunkt auch der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, vom
Versprechenden Erfüllung zu fordern, ist aus der Vereinbarung und der
Natur und dem Zwecke des Vertrages zu beurteilen. Im Zweifel erwirbt der
Dritte dieses Recht, wenn die Leistung hauptsächlich ihm zum Vorteile
gereichen soll.
(3) Das Recht auf
die bei einer Gutsabtretung vom Übernehmer zugunsten eines Dritten
versprochenen Leistungen gilt mangels anderer Vereinbarung dem Dritten als
mit der Übergabe des Gutes erworben.
§
882.
(1) Weist der
Dritte das aus dem Vertrag erworbene Recht zurück, so gilt das Recht als
nicht erworben.
(2) Einwendungen
aus dem Vertrage stehen dem Versprechenden auch gegen den Dritten zu.
Form der Verträge
§
883. Ein Vertrag kann mündlich oder schriftlich; vor Gerichte oder
außerhalb desselben; mit oder ohne Zeugen errichtet werden. Diese
Verschiedenheit der Form macht, außer den im Gesetze bestimmten Fällen, in
Ansehung der Verbindlichkeit keinen Unterschied.
§
884. Haben die Parteien für einen Vertrag die Anwendung einer
bestimmten Form vorbehalten, so wird vermutet, daß sie vor Erfüllung
dieser Form nicht gebunden sein wollen.
§
885. Ist zwar noch nicht die förmliche Urkunde, aber doch ein
Aufsatz über die Hauptpunkte errichtet und von den Parteien unterfertigt
worden (Punktation), so gründet auch schon ein solcher Aufsatz diejenigen
Rechte und Verbindlichkeiten, welche darin ausgedrückt sind.
§
886. Ein Vertrag, für den Gesetz oder Parteiwille Schriftlichkeit
bestimmt, kommt durch die Unterschrift der Parteien oder, falls sie des
Schreibens unkundig oder wegen Gebrechens unfähig sind, durch Beisetzung
ihres gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichens oder Beisetzung
des Handzeichens vor zwei Zeugen, deren einer den Namen der Partei
unterfertigt, zustande. Der schriftliche Abschluß des Vertrages wird durch
gerichtliche oder notarielle Beurkundung ersetzt. Eine Nachbildung der
eigenhändigen Unterschrift auf mechanischem Wege ist nur da genügend, wo
sie im Geschäftsverkehr üblich ist.
§
887. aufgehoben
Gemeinschaftliche
Verbindlichkeit oder Berechtigung
§
888. Wenn zwei oder mehrere Personen jemandem eben dasselbe Recht
zu einer Sache versprechen, oder es von ihm annehmen; so wird sowohl die
Forderung, als die Schuld nach den Grundsätzen der Gemeinschaft des
Eigentumes geteilt.
§
889. Außer den in dem Gesetze bestimmten Fällen haftet also aus
mehrern Mitschuldnern einer teilbaren Sache jeder nur für seinen Anteil,
und ebenso muß von mehrern Mitgenossen einer teilbaren Sache, jeder sich
mit dem ihm gebührenden Teile begnügen.
§
890. Betrifft es hingegen unteilbare Sachen; so kann ein
Gläubiger, wenn er der einzige ist, solche von einem jeden Mitschuldner
fordern. Wenn aber mehrere Gläubiger und nur ein Schuldner da sind; so ist
dieser die Sache einem einzelnen Mitgläubiger, ohne Sicherstellung
herauszugeben, nicht verpflichtet; er kann auf die Übereinkunft aller
Mitgläubiger dringen, oder die gerichtliche Verwahrung der Sache
verlangen.
Korrealität
§
891. Versprechen mehrere Personen ein und dasselbe Ganze zur
ungeteilten Hand dergestalt, daß sich einer für alle, und alle für einen
ausdrücklich verbinden; so haftet jede einzelne Person für das Ganze. Es
hängt dann von dem Gläubiger ab, ob er von allen, oder von einigen
Mitschuldnern das Ganze, oder nach von ihm gewählten Anteilen; oder ob er
es von einem einzigen fordern wolle. Selbst nach erhobener Klage bleibt
ihm, wenn er von derselben absteht, diese Wahl vorbehalten; und, wenn er
von einem oder dem andern Mitschuldner nur zum Teile befriedigt wird; so
kann er das Rückständige von den übrigen fordern.
§
892. Hat hingegen einer mehrern Personen eben dasselbe Ganze
zugesagt, und sind diese ausdrücklich berechtigt worden, es zur
ungeteilten Hand fordern zu können; so muß der Schuldner das Ganze
demjenigen dieser Gläubiger entrichten, der ihn zuerst darum angeht.
§
893. Sobald ein Mitschuldner dem Gläubiger das Ganze entrichtet
hat, darf dieser von den übrigen Mitschuldnern nichts mehr fordern; und
sobald ein Mitgläubiger von dem Schuldner ganz befriedigt worden ist,
haben die übrigen Mitgläubiger keinen Anspruch mehr.
§
894. Ein Mitschuldner kann dadurch, daß er mit dem Gläubiger
lästigere Bedingungen eingeht, den übrigen keinen Nachteil zuziehen, und
die Nachsicht oder Befreiung, welche ein Mitschuldner für seine Person
erhält, kommt den übrigen nicht zustatten.
§
895. Wie weit aus mehrern Mitgläubigern, welchen eben dasselbe
Ganze zur ungeteilten Hand zugesagt worden ist, derjenige, welcher die
ganze Forderung für sich erhalten hat, den übrigen Gläubigern hafte, muß
aus den besondern, zwischen den Mitgläubigern bestehenden, rechtlichen
Verhältnissen bestimmt werden. Besteht kein solches Verhältnis; so ist
einer dem andern keine Rechenschaft schuldig.
§
896. Ein Mitschuldner zur ungeteilten Hand, welcher die ganze
Schuld aus dem Seinigen abgetragen hat, ist berechtigt, auch ohne
geschehene Rechtsabtretung, von den übrigen den Ersatz, und zwar, wenn
kein anderes besonderes Verhältnis unter ihnen besteht, zu gleichen Teilen
zu fordern. War einer aus ihnen unfähig, sich zu verpflichten, oder ist er
unvermögend, seiner Verpflichtung Genüge zu leisten; so muß ein solcher
ausfallender Anteil ebenfalls von allen Mitverpflichteten übernommen
werden. Die erhaltene Befreiung eines Mitverpflichteten kann den übrigen
bei der Forderung des Ersatzes nicht nachteilig sein (§
894).
Nebenbestimmungen bei Verträgen:
1. Bedingungen;
§
897. In Ansehung der Bedingungen bei Verträgen gelten überhaupt
die nämlichen Vorschriften, welche über die den Erklärungen des letzten
Willens beigesetzten Bedingungen aufgestellt worden sind.
§
898. Verabredungen unter solchen Bedingungen, welche bei einem
letzten Willen für nicht beigesetzt angesehen werden, sind ungültig.
§
899. Ist die in einem Vertrage vorgeschriebene Bedingung schon vor
dem Vertrage eingetroffen; so muß sie nach dem Vertrage nur dann
wiederholt werden, wenn sie in einer Handlung dessen, der das Recht
erwerben soll, besteht, und von ihm wiederholt werden kann.
§
900. Ein unter einer aufschiebenden Bedingung zugesagtes Recht
geht auch auf die Erben über.
2. Bewegungsgrund;
§
901. Haben die Parteien den Bewegungsgrund, oder den Endzweck
ihrer Einwilligung ausdrücklich zur Bedingung gemacht; so wird der
Bewegungsgrund oder Endzweck wie eine andere Bedingung angesehen. Außerdem
haben dergleichen Äußerungen auf die Gültigkeit entgeltlicher Verträge
keinen Einfluß. Bei den unentgeltlichen aber sind die bei den letzten
Anordnungen gegebenen Vorschriften anzuwenden.
3. Zeit, Ort und Art
der Erfüllung;
§
902.
(1) Eine durch
Vertrag oder Gesetz bestimmte Frist ist vorbehaltlich anderer Festsetzung
so zu berechnen, daß bei einer nach Tagen bestimmten Frist der Tag nicht
mitgezählt wird, in welchen das Ereignis fällt, von dem der Fristenlauf
beginnt.
(2) Das Ende einer
nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmten Frist fällt auf denjenigen Tag
der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher nach seiner Benennung
oder Zahl dem Tage des Ereignisses entspricht, mit dem der Lauf der Frist
beginnt, wenn aber dieser Tag in dem letzten Monat fehlt, auf den letzten
Tag dieses Monats.
(3) Unter einem
halben Monate sind fünfzehn Tage zu verstehen, unter der Mitte eines
Monats der fünfzehnte dieses Monats.
§
903. Ein Recht, dessen Erwerbung an einen bestimmten Tag gebunden
ist, wird mit dem Anfang dieses Tages erworben. Die Rechtsfolgen der
Nichterfüllung einer Verbindlichkeit oder eines Versäumnisses treten erst
mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist ein. Fällt der für die Abgabe
einer Erklärung oder für eine Leistung bestimmte letzte Tag auf einen
Sonntag oder anerkannten Feiertag, so tritt an dessen Stelle,
vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung, der nächstfolgende Werktag.
§
904. Ist keine gewisse Zeit für die Erfüllung des Vertrages
bestimmt worden; so kann sie sogleich, nämlich ohne unnötigen Aufschub,
gefordert werden. Hat der Verpflichtete die Erfüllungszeit seiner Willkür
vorbehalten; so muß man entweder seinen Tod abwarten, und sich an die
Erben halten; oder, wenn es um eine bloß persönliche, nicht vererbliche,
Pflicht zu tun ist, die Erfüllungszeit von dem Richter nach Billigkeit
festsetzen lassen. Letzteres findet auch dann statt, wenn der
Verpflichtete die Erfüllung, nach Möglichkeit, oder Tunlichkeit
versprochen hat. Übrigens müssen die Vorschriften, welche oben (§§
704 bis 706) in Rücksicht der den letzten Anordnungen beigerückten
Zeitbestimmung gegeben werden, auch hier angewendet werden.
§
905.
(1) Kann der
Erfüllungsort weder aus der Verabredung noch aus der Natur oder dem Zwecke
des Geschäftes bestimmt werden, so ist an dem Orte zu leisten, wo der
Schuldner zur Zeit des Vertragsabschlusses seinen Wohnsitz hatte, oder,
wenn die Verbindlichkeit im Betriebe des gewerblichen oder geschäftlichen
Unternehmens des Schuldners entstand, am Orte der Niederlassung. In
Ansehung des Maßes, des Gewichtes und der Geldsorten ist auf den Ort der
Erfüllung zu sehen.
(2) Geldzahlungen
hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und Kosten dem Gläubiger an
dessen Wohnsitz (Niederlassung) zu übermachen. Hat sich dieser nach der
Entstehung der Forderung geändert, so trägt der Gläubiger die dadurch
bewirkte Erhöhung der Gefahr und der Kosten.
§
906. Kann das Versprechen auf mehrere Arten erfüllt werden; so hat
der Verpflichtete die Wahl; er kann aber von der einmal getroffenen Wahl
für sich allein nicht abgehen.
§
907. Wird ein Vertrag ausdrücklich mit Vorbehalt der Wahl
geschlossen, und dieselbe durch zufälligen Untergang eines oder mehrerer
Wahlstücke vereitelt; so ist der Teil, dem die Wahl zusteht, an den
Vertrag nicht gebunden. Unterläuft aber ein Verschulden des
Verpflichteten; so muß er dem Berechtigten für die Vereitlung der Wahl
haften.
4. Angeld;
§
908. Was bei Abschließung eines Vertrages voraus gegeben wird,
ist, außer dem Falle einer besondern Verabredung, nur als ein Zeichen der
Abschließung, oder als eine Sicherstellung für die Erfüllung des Vertrages
zu betrachten, und heißt Angeld. Wird der Vertrag durch Schuld einer
Partei nicht erfüllt; so kann die schuldlose Partei das von ihr empfangene
Angeld behalten, oder den doppelten Betrag des von ihr gegebenen Angeldes
zurückfordern. Will sie sich aber damit nicht begnügen, so kann sie auf
die Erfüllung; oder, wenn diese nicht mehr möglich ist, auf den Ersatz
dringen.
5. Reugeld;
§
909. Wird bei Schließung eines Vertrages ein Betrag bestimmt,
welchen ein oder der andere Teil in dem Falle, daß er von dem Vertrage vor
der Erfüllung zurücktreten will, entrichten muß; so wird der Vertrag gegen
Reugeld geschlossen. In diesem Falle muß entweder der Vertrag erfüllt,
oder das Reugeld bezahlt werden. Wer den Vertrag auch nur zum Teile
erfüllt; oder das, was von dem andern auch nur zum Teile zur Erfüllung
geleistet worden ist, angenommen hat, kann selbst gegen Entrichtung des
Reugeldes nicht mehr zurücktreten.
§
910. Wenn ein Angeld gegeben, und zugleich das Befugnis des
Rücktrittes ohne Bestimmung eines besondern Reugeldes bedungen wird; so
vertritt das Angeld die Stelle des Reugeldes. Im Falle des Rücktrittes
verliert also der Geber das Angeld; oder der Empfänger stellt das Doppelte
zurück.
§
911. Wer nicht durch bloßen Zufall, sondern durch sein Verschulden
an der Erfüllung des Vertrages verhindert wird, muß ebenfalls das Reugeld
entrichten.
6. Nebengebühren
§
912. Der Gläubiger ist von seinem Schuldner außer der Hauptschuld
zuweilen auch Nebengebühren zu fordern berechtigt. Sie bestehen in dem
Zuwachse, und in den Früchten der Hauptsache; in den bestimmten oder in
den Zögerungszinsen; oder in dem Ersatze des verursachten Schadens; oder
dessen, was dem andern daran liegt, daß die Verbindlichkeit nicht gehörig
erfüllt worden; endlich in dem Betrage, welchen ein Teil sich auf diesen
Fall bedungen hat.
§
913. Inwieweit mit einem dinglichen Rechte das Recht auf den
Zuwachs, oder auf die Früchte verbunden sei, ist in dem
ersten und
vierten
Hauptstücke des zweiten Teiles bestimmt worden. Wegen eines bloß
persönlichen Rechtes hat der Berechtigte noch keinen Anspruch auf
Nebengebühren. Inwieweit dem Gläubiger ein Recht auf diese zukomme, ist
teils aus den besondern Arten und Bestimmungen der Verträge; teils aus dem
Hauptstücke von
dem Rechte des Schadenersatzes und der Genugtuung zu entnehmen.
Auslegungsregeln bei
Verträgen
§
914. Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem buchstäblichen
Sinne des Ausdrucks zu haften, sondern die Absicht der Parteien zu
erforschen und der Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen
Verkehrs entspricht.
§
915. Bei einseitig verbindlichen Verträgen wird im Zweifel
angenommen, daß sich der Verpflichtete eher die geringere als die
schwerere Last auflegen wollte; bei zweiseitig verbindlichen wird eine
undeutliche Äußerung zum Nachteile desjenigen erklärt, der sich derselben
bedient hat (§
869).
§
916.
(1) Eine
Willenserklärung, die einem anderen gegenüber mit dessen Einverständnis
zum Schein abgegeben wird, ist nichtig. Soll dadurch ein anderes Geschäft
verborgen werden, so ist dieses nach seiner wahren Beschaffenheit zu
beurteilen.
(2) Einem Dritten,
der im Vertrauen auf die Erklärung Rechte erworben hat, kann die Einrede
des Scheingeschäftes nicht entgegengesetzt werden.
Allgemeine
Bestimmungen über entgeltliche Verträge und Geschäfte
§
917. Bei einem entgeltlichen Vertrage werden entweder Sachen mit
Sachen, oder Handlungen, worunter auch die Unterlassungen gehören, mit
Handlungen, oder endlich Sachen mit Handlungen und Handlungen mit Sachen
vergolten.
§
917a. Ist zum Schutz eines Vertragspartners gesetzlich bestimmt,
daß kein höheres oder kein niedrigeres als ein bestimmtes Entgelt
vereinbart werden darf, so ist eine Entgeltvereinbarung soweit unwirksam,
als sie dieses Höchstmaß über- beziehungsweise dieses Mindestmaß
unterschreitet. Im zweiten Fall gilt das festgelegte Mindestentgelt als
vereinbart.
§
918.
(1) Wenn ein
entgeltlicher Vertrag von einem Teil entweder nicht zur gehörigen Zeit, am
gehörigen Ort oder auf die bedungene Weise erfüllt wird, kann der andere
entweder Erfüllung und Schadenersatz wegen der Verspätung begehren oder
unter Festsetzung einer angemessenen Frist zur Nachholung den Rücktritt
vom Vertrag erklären.
(2) Ist die
Erfüllung für beide Seiten teilbar, so kann wegen Verzögerung einer
Teilleistung der Rücktritt nur hinsichtlich der einzelnen oder auch aller
noch ausstehenden Teilleistungen erklärt werden.
§
919. Ist die Erfüllung zu einer bestimmten Zeit oder binnen einer
festbestimmten Frist bei sonstigem Rücktritt bedungen, so muß der
Rücktrittsberechtigte, wenn er auf der Erfüllung bestehen will, das nach
Ablauf der Zeit dem andern ohne Verzug anzeigen; unterläßt er dies, so
kann er später nicht mehr auf der Erfüllung bestehen. Dasselbe gilt, wenn
die Natur des Geschäftes oder der dem Verpflichteten bekannte Zweck der
Leistung entnehmen läßt, daß die verspätete Leistung oder, im Falle der
Verspätung einer Teilleistung, die noch übrigen Leistungen für den
Empfänger kein Interesse haben.
§
920. Wird die Erfüllung durch Verschulden des Verpflichteten oder
einen von ihm zu vertretenden Zufall vereitelt, so kann der andere Teil
entweder Schadenersatz wegen Nichterfüllung fordern oder vom Vertrage
zurücktreten. Bei teilweiser Vereitlung steht ihm der Rücktritt zu, falls
die Natur des Geschäftes oder der dem Verpflichteten bekannte Zweck der
Leistung entnehmen läßt, daß die teilweise Erfüllung für ihn kein
Interesse hat.
§
921. Der Rücktritt vom Vertrage läßt den Anspruch auf Ersatz des
durch verschuldete Nichterfüllung verursachten Schadens unberührt. Das
bereits empfangene Entgelt ist auf solche Art zurückzustellen oder zu
vergüten, daß kein Teil aus dem Schaden des anderen Gewinn zieht.
Gewährleistung
§
922. 134)
(1) Wer einem
anderen eine Sache gegen Entgelt überlässt, leistet Gewähr, dass sie dem
Vertrag entspricht. Er haftet also dafür, dass die Sache die bedungenen
oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften hat, dass sie seiner
Beschreibung, einer Probe oder einem Muster entspricht und dass sie der
Natur des Geschäftes oder der getroffenen Verabredung gemäß verwendet
werden kann.
(2) Ob die Sache
dem Vertrag entspricht, ist auch danach zu beurteilen, was der Übernehmer
auf Grund der über sie gemachten öffentlichen Äußerungen des Übergebers
oder des Herstellers, vor allem in der Werbung und in den der Sache
beigefügten Angaben, erwarten kann; das gilt auch für öffentliche
Äußerungen einer Person, die die Sache in den Europäischen Wirtschaftsraum
eingeführt hat oder die sich durch die Anbringung ihres Namens, ihrer
Marke oder eines anderen Kennzeichens an der Sache als Hersteller
bezeichnet. Solche öffentlichen Äußerungen binden den Übergeber jedoch
nicht, wenn er sie weder kannte noch kennen konnte, wenn sie beim
Abschluss des Vertrags berichtigt waren oder wenn sie den
Vertragsabschluss nicht beeinflusst haben konnten.
Fälle der
Gewährleistung
§
923. Wer also der Sache Eigenschaften beilegt, die sie nicht hat
und die ausdrücklich oder vermöge der Natur des Geschäftes stillschweigend
bedungen worden sind; wer ungewöhnliche Mängel, oder Lasten derselben
verschweigt; wer eine nicht mehr vorhandene, oder eine fremde Sache als
die seinige veräußert; wer fälschlich vorgibt, daß die Sache zu einem
bestimmten Gebrauche tauglich; oder daß sie auch von den gewöhnlichen
Mängeln und Lasten frei sei; der hat, wenn das Widerspiel hervorkommt,
dafür zu haften.
Vermutung der
Mangelhaftigkeit
§
924. Der Übergeber leistet Gewähr für Mängel, die bei der Übergabe
vorhanden sind. Dies wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, wenn der
Mangel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe hervorkommt. Die
Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels
unvereinbar ist.135)
§
925. Durch Verordnung wird bestimmt, inwiefern die Vermutung
eintritt, daß ein Tier schon vor der Übergabe krank gewesen ist, wenn
innerhalb bestimmter Fristen gewisse Krankheiten und Mängel hervorkommen.
§
926. Von der rechtlichen Vermutung, daß der Mangel schon vor der
Übergabe des Tieres vorhanden war, kann aber der Übernehmer nur dann
Gebrauch machen, wenn er dem Übergeber oder in dessen Abwesenheit dem
Gemeindevorsteher sogleich von dem bemerkten Fehler Nachricht gibt oder
das Tier durch einen Sachverständigen untersuchen läßt oder die
gerichtliche Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises beantragt.
§
927. Vernachlässigt der Übernehmer diese Vorsicht, so liegt ihm
der Beweis ob, daß das Tier schon vor der Übergabe mangelhaft war. Immer
steht aber auch dem Übergeber der Beweis offen, daß der gerügte Mangel
erst nach der Übergabe eingetreten sei.
§
928. Fallen die Mängel einer Sache in die Augen oder sind die auf
der Sache haftenden Lasten aus den öffentlichen Büchern zu ersehen, so
findet außer dem Falle arglistigen Verschweigens des Mangels oder einer
ausdrücklichen Zusage, daß die Sache von allen Fehlern und Lasten frei
sei, keine Gewährleistung statt (§
443). Schulden und Rückstände, welche auf der Sache haften, müssen
stets vertreten werden.
§
929. Wer eine fremde Sache wissentlich an sich bringt, hat
ebensowenig Anspruch auf eine Gewährleistung, als derjenige, welcher
ausdrücklich darauf Verzicht getan hat.
§
930. Werden Sachen in Pausch und Bogen, nämlich so, wie sie stehen
und liegen, ohne Zahl, Maß und Gewicht übergeben; so ist der Übergeber,
außer dem Falle, daß eine von ihm fälschlich vorgegebene, oder von dem
Empfänger bedungene Beschaffenheit mangelt, für die daran entdeckten
Fehler nicht verantwortlich.
Bedingung der
Gewährleistung
§
931. Wenn der Übernehmer wegen eines von einem Dritten auf die
Sache erhobenen Anspruches von der Gewährleistung Gebrauch machen will, so
muß er seinem Vormann den Streit verkündigen. Unterläßt er dies, so
verliert er zwar noch nicht das Recht der Schadloshaltung, aber sein
Vormann kann ihm alle wider den Dritten unausgeführt gebliebenenen
Einwendungen entgegensetzen und sich dadurch von der Entschädigung in dem
Maße befreien, als erkannt wird, daß diese Einwendungen, wenn von ihnen
der gehörige Gebrauch gemacht worden wäre, eine andere Entscheidung gegen
den Dritten veranlaßt haben würden.
Rechte aus der
Gewährleistung
§
932. 136)
(1) Der Übernehmer
kann wegen eines Mangels die Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des
Fehlenden), den Austausch der Sache, eine angemessene Minderung des
Entgelts (Preisminderung) oder die Aufhebung des Vertrags (Wandlung)
fordern.
(2) Zunächst kann
der Übernehmer nur die Verbesserung oder den Austausch der Sache
verlangen, es sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich
ist oder für den Übergeber, verglichen mit der anderen Abhilfe, mit einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist,
richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Sache, der Schwere des
Mangels und den mit der anderen Abhilfe für den Übernehmer verbundenen
Unannehmlichkeiten.
(3) Die
Verbesserung oder der Austausch ist in angemessener Frist und mit
möglichst geringen Unannehmlichkeiten für den Übernehmer zu bewirken,
wobei die Art der Sache und der mit ihr verfolgte Zweck zu berücksichtigen
sind.
(4) Sind sowohl die
Verbesserung als auch der Austausch unmöglich oder für den Übergeber mit
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat der Übernehmer das
Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen
Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn der Übergeber
die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht in angemessener
Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für den Übernehmer mit erheblichen
Unannehmlichkeiten verbunden wären oder wenn sie ihm aus triftigen, in der
Person des Übergebers liegenden Gründen unzumutbar sind.
§
932a. Während des Rechtsstreites über die Aufhebung des Vertrages
wegen eines Viehmangels hat das Gericht auf Antrag einer der Parteien,
sobald die Besichtigung nicht mehr erforderlich ist, durch einstweilige
Verfügung den gerichtlichen Verkauf des Tieres und die gerichtliche
Hinterlegung des Erlöses anzuordnen.
Verjährung
§
933. 137)
(1) Das Recht auf
die Gewährleistung muss, wenn es unbewegliche Sachen betrifft, binnen drei
Jahren, wenn es bewegliche Sachen betrifft, binnen zwei Jahren gerichtlich
geltend gemacht werden. Die Frist beginnt mit dem Tag der Ablieferung der
Sache, bei Rechtsmängeln aber erst mit dem Tag, an dem der Mangel dem
Übernehmer bekannt wird. Die Parteien können eine Verkürzung oder
Verlängerung dieser Frist vereinbaren.
(2) Bei Viehmängeln
beträgt die Frist sechs Wochen. Sie beginnt bei Mängeln, für die eine
Vermutungsfrist besteht, erst nach deren Ablauf.
(3) In jedem Fall
bleibt dem Übernehmer die Geltendmachung durch Einrede vorbehalten, wenn
er innerhalb der Frist dem Übergeber den Mangel anzeigt.
Schadenersatz
§
933a.
(1) Hat der
Übergeber den Mangel verschuldet, so kann der Übernehmer auch
Schadenersatz fordern.
(2) Wegen des
Mangels selbst kann der Übernehmer auch als Schadenersatz zunächst nur die
Verbesserung oder den Austausch verlangen. Er kann jedoch Geldersatz
verlangen, wenn sowohl die Verbesserung als auch der Austausch unmöglich
ist oder für den Übergeber mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand
verbunden wäre. Dasselbe gilt, wenn der Übergeber die Verbesserung oder
den Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn
diese Abhilfen für den Übernehmer mit erheblichen Unannehmlichkeiten
verbunden wären oder wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des
Übergebers liegenden Gründen unzumutbar sind.
(3) Nach Ablauf von
zehn Jahren ab der Übergabe der Sache obliegt für einen Ersatzanspruch
wegen der Mangelhaftigkeit selbst und wegen eines durch diese verursachten
weiteren Schadens dem Übernehmer der Beweis des Verschuldens des
Übergebers.138)
Besonderer Rückgriff
§
933b.
(1) Hat ein
Unternehmer einem Verbraucher Gewähr geleistet, so kann er von seinem
Vormann, wenn auch dieser Unternehmer ist, auch nach Ablauf der Fristen
des §
933 die Gewährleistung fordern. Dasselbe gilt für frühere Übergeber im
Verhältnis zu ihren Vormännern, wenn sie selbst wegen der
Gewährleistungsrechte des letzten Käufers ihrem Nachmann Gewähr geleistet
haben. Der Anspruch ist mit der Höhe des eigenen Aufwandes beschränkt.
(2) Ansprüche nach
Abs. 1 sind innerhalb von zwei Monaten ab Erfüllung der eigenen
Gewährleistungspflicht gerichtlich geltend zu machen. Die Haftung eines
Rückgriffspflichtigen verjährt jedenfalls in fünf Jahren nach Erbringung
seiner Leistung. Die Frist wird durch eine Streitverkündigung für die
Dauer des Rechtsstreits gehemmt.139)
Schadloshaltung wegen
Verkürzung über die Hälfte
§
934. Hat bei zweiseitig verbindlichen Geschäften ein Teil nicht
einmal die Hälfte dessen, was er dem andern gegeben hat, von diesem an dem
gemeinen Werte erhalten; so räumt das Gesetz dem verletzten Teile das
Recht ein, die Aufhebung, und die Herstellung in den vorigen Stand zu
fordern. Dem andern Teile steht aber bevor, das Geschäft dadurch aufrecht
zu erhalten, daß er den Abgang bis zum gemeinen Werte zu ersetzen bereit
ist. Das Mißverhältnis des Wertes wird nach dem Zeitpunkte des
geschlossenen Geschäftes bestimmt.
§
935. Die Anwendung des
§ 934
kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden; er ist jedoch dann nicht
anzuwenden, wenn jemand erklärt hat, die Sache aus besonderer Vorliebe um
einen außerordentlichen Wert zu übernehmen; wenn er, obgleich ihm der
wahre Wert bekannt war, sich dennoch zu dem unverhältnismäßigen Werte
verstanden hat; ferner, wenn aus dem Verhältnisse der Personen zu vermuten
ist, daß sie einen, aus einem entgeltlichen und unentgeltlichen
vermischten, Vertrag schließen wollten; wenn sich der eigentliche Wert
nicht mehr erheben läßt; endlich, wenn die Sache von dem Gerichte
versteigert worden ist.
Von der Verabredung
eines künftigen Vertrages
§
936. Die Verabredung, künftig erst einen Vertrag schließen zu
wollen, ist nur dann verbindlich, wenn sowohl die Zeit der Abschließung,
als die wesentlichen Stücke des Vertrages bestimmt, und die Umstände
inzwischen nicht dergestalt verändert worden sind, daß dadurch der
ausdrücklich bestimmte, oder aus den Umständen hervorleuchtende Zweck
vereitelt, oder das Zutrauen des einen oder andern Teiles verloren wird.
Überhaupt muß auf die Vollziehung solcher Zusagen längstens in einem Jahre
nach dem bedungenen Zeitpunkte gedrungen werden; widrigenfalls ist das
Recht erloschen.
Von dem Verzicht auf
Einwendungen
§
937. Allgemeine, unbestimmte Verzichtleistungen auf Einwendungen
gegen die Gültigkeit eines Vertrages sind ohne Wirkung.
Achzehntes Hauptstück
Von Schenkungen
Schenkung
§
938. Ein Vertrag, wodurch eine Sache jemandem unentgeltlich
überlassen wird, heißt eine Schenkung.
Inwiefern eine
Verzichtleistung eine Schenkung sei
§
939. Wer auf ein gehofftes, oder wirklich angefallenes, oder
zweifelhaftes Recht Verzicht tut, ohne es einem andern ordentlich
abzutreten, oder dasselbe dem Verpflichteten mit dessen Einwilligung zu
erlassen, ist für keinen Geschenkgeber anzusehen.
Belohnende Schenkung
§
940. Es verändert die Wesenheit der Schenkung nicht, wenn sie aus
Erkenntlichkeit; oder in Rücksicht auf die Verdienste des Beschenkten;
oder als eine besondere Belohnung desselben gemacht worden ist; nur darf
er vorher kein Klagerecht darauf gehabt haben.
§
941. Hat der Beschenkte ein Klagerecht auf die Belohnung gehabt,
entweder, weil sie unter den Parteien schon bedungen, oder durch das
Gesetz vorgeschrieben war; so hört das Geschäft auf, eine Schenkung zu
sein, und ist als ein entgeltlicher Vertrag anzusehen.
Wechselseitige
Schenkungen
§
942. Sind Schenkungen vorher dergestalt bedungen, daß der
Schenkende wieder beschenkt werden muß; so entsteht keine wahre Schenkung
im Ganzen; sondern nur in Ansehung des übersteigenden Wertes.
Form des
Schenkungsvertrages,
§
943. Aus einem bloß mündlichen, ohne wirkliche Übergabe
geschlossenen Schenkungsvertrage erwächst dem Geschenknehmer kein
Klagerecht. Dieses Recht muß durch eine schriftliche Urkunde begründet
werden.
und Maß einer
Schenkung
§
944. Ein unbeschränkter Eigentümer kann mit Beobachtung der
gesetzlichen Vorschriften auch sein ganzes gegenwärtiges Vermögen
verschenken. Ein Vertrag aber, wodurch das künftige Vermögen verschenkt
wird, besteht nur insoweit, als er die Hälfte dieses Vermögens nicht
übersteigt.
Inwiefern der Geber
für das Geschenkte hafte
§
945. Wer wissentlich eine fremde Sache verschenkt, und dem
Geschenknehmer diesen Umstand verschweigt, haftet für die nachteiligen
Folgen.
Unwiderruflichkeit
der Schenkungen
§
946. Schenkungsverträge dürfen in der Regel nicht widerrufen
werden.
Ausnahmen: 1. Wegen
Dürftigkeit;
§
947. Gerät der Geschenkgeber in der Folge in solche Dürftigkeit,
daß es ihm an dem nötigen Unterhalte gebricht; so ist er befugt, jährlich
von dem geschenkten Betrage die gesetzlichen Zinsen, insoweit die
geschenkte Sache, oder derselben Wert noch vorhanden ist, und ihm der
nötige Unterhalt mangelt, von dem Beschenkten zu fordern, wenn sich anders
dieser nicht selbst in gleich dürftigen Umständen befindet. Aus mehrern
Geschenknehmern ist der frühere nur insoweit verbunden, als die Beiträge
der spätern zum Unterhalte nicht zureichen.
2. Undankes;
§
948. Wenn der Beschenkte sich gegen seinen Wohltäter eines groben
Undankes schuldig macht, kann die Schenkung widerrufen werden. Unter
grobem Undanke wird eine Verletzung am Leibe, an Ehre, an Freiheit oder am
Vermögen verstanden, welche von der Art ist, daß gegen den Verletzer von
Amts wegen, oder auf Verlangen des Verletzten nach dem Strafgesetze
verfahren werden kann.
§
949. Der Undank macht den Undankbaren für seine Person zum
unredlichen Besitzer, und gibt selbst dem Erben des Verletzten, insofern
der letztere den Undank nicht verziehen hat, und noch etwas von dem
Geschenke in Natur oder Werte vorhanden ist, ein Recht zur
Widerrufungsklage auch gegen den Erben des Verletzers.
3. Verkürzung des
schuldigen Unterhaltes;
§
950. Wer jemandem den Unterhalt zu reichen schuldig ist, kann
dessen Recht durch Beschenkung eines Dritten nicht verletzen. Der auf
solche Art Verkürzte ist befugt, den Beschenkten um die Ergänzung
desjenigen zu belangen, was ihm der Schenkende nun nicht mehr zu leisten
vermag. Bei mehreren Geschenknehmern ist die obige (§
947) Vorschrift anzuwenden.
4. des Pflichtteiles;
§
951.
(1) Wenn bei
Bestimmung des Pflichtteiles Schenkungen in Anschlag gebracht werden (§
785), der Nachlaß aber zu dessen Deckung nicht ausreicht, kann der
verkürzte Noterbe vom Beschenkten die Herausgabe des Geschenkes zur
Deckung des Fehlbetrages verlangen. Der Beschenkte kann die Herausgabe
durch Zahlung des Fehlbetrages abwenden.
(2) Ist der
Beschenkte selbst pflichtteilsberechtigt, so haftet er dem andern nur so
weit, als er infolge der Schenkung mehr als den ihm bei Einrechnung der
Schenkungen gebührenden Pflichtteil erhalten würde.
(3) Unter mehreren
Beschenkten haftet der früher Beschenkte nur in dem Maße, als der später
Beschenkte zur Herausgabe nicht verpflichtet oder nicht imstande ist.
Gleichzeitig Beschenkte haften verhältnismäßig.
§
952. Besitzt der Beschenkte die geschenkte Sache oder ihren Wert
nicht mehr; so haftet er nur insofern, als er sie unredlicher Weise aus
dem Besitze gelassen hat.
5. der Gläubiger;
§
953. [Unter eben dieser (§
952) Beschränkung können auch diejenigen Geschenke zurückgefordert
werden, wodurch die zur Zeit der Schenkung schon vorhandenen Gläubiger
verkürzt worden sind. Auf Gläubiger, deren Forderungen jünger sind, als
die Schenkung, erstreckt sich dieses Recht nur dann, wenn der Beschenkte
eines hinterlistigen Einverständnisses überwiesen werden kann.]
6. wegen nachgeborner
Kinder
§
954. Dadurch, daß einem kinderlosen Geschenkgeber nach
geschlossenem Schenkungsvertrage Kinder geboren werden, erwächst weder
ihm, noch den nachgebornen Kindern das Recht, die Schenkung zu widerrufen.
Doch kann er, oder das nachgeborne Kind, im Notfalle sowohl gegen den
Beschenkten, als gegen dessen Erben das oben angeführte Recht auf die
gesetzlichen Zinsen des geschenkten Betrages geltend machen (§
947).
Welche Schenkungen
auf die Erben nicht übergehen
§
955. Hat der Geschenkgeber dem Beschenkten eine Unterstützung in
gewissen Fristen zugesichert, so erwächst für die Erben derselben weder
ein Recht, noch eine Verbindlichkeit; es müßte denn in dem
Schenkungsvertrage ausdrücklich anders bedungen worden sein.
Schenkung auf den
Todesfall
§
956. Eine Schenkung, deren Erfüllung erst nach dem Tode des
Schenkenden erfolgen soll, ist mit Beobachtung der vorgeschriebenen
Förmlichkeiten als ein Vermächtnis gültig. Nur dann ist sie als ein
Vertrag anzusehen, wenn der Beschenkte sie angenommen, der Schenkende sich
des Befugnisses, sie zu widerrufen, ausdrücklich begeben hat, und eine
schriftliche Urkunde darüber dem Beschenkten eingehändigt worden ist.
Neunzehntes Hauptstück
Von dem Verwahrungsvertrage
Verwahrungsvertrag
§
957. Wenn jemand eine fremde Sache in seine Obsorge übernimmt; so
entsteht ein Verwahrungsvertrag. Das angenommene Versprechen, eine fremde,
noch nicht übergebene Sache in die Obsorge zu übernehmen, macht zwar den
versprechenden Teil verbindlich; es ist aber noch kein Verwahrungsvertrag.
§
958. Durch den Verwahrungsvertrag erwirbt der Übernehmer weder
Eigentum, noch Besitz, noch Gebrauchsrecht; er ist bloßer Inhaber mit der
Pflicht, die ihm anvertraute Sache vor Schaden zu sichern.
Wann er in einen
Darlehens- oder Leihvertrag;
§
959. Wird dem Verwahrer auf sein Verlangen, oder durch
freiwilliges Anerbieten des Hinterlegers der Gebrauch gestattet; so hört
im ersten Falle der Vertrag gleich nach der Verwilligung; im zweiten aber
von dem Augenblicke, da das Anerbieten angenommen, oder von der
hinterlegten Sache wirklich Gebrauch gemacht worden ist, auf, ein
Verwahrungsvertrag zu sein; er wird bei verbrauchbaren Sachen in einen
Darlehens-, bei unverbrauchbaren in einen Leihvertrag umgeändert, und es
treten die damit verbundenen Rechte und Pflichten ein.
oder in eine
Bevollmächtigung übergehe
§
960. Es können bewegliche und unbewegliche Sachen in Obsorge
gegeben werden. Wird aber dem Übernehmer zugleich ein anderes, auf die
anvertraute Sache sich beziehendes Geschäft aufgetragen; so wird er als
ein Gewalthaber angesehen.
Pflichten und Rechte
des Verwahrers;
§
961. Die Hauptpflicht des Verwahrers ist: die ihm anvertraute
Sache durch die bestimmte Zeit sorgfältig zu bewahren, und nach Verlauf
derselben dem Hinterleger in eben dem Zustande, in welchem er sie
übernommen hat, und mit allem Zuwachse zurückzustellen.
§
962. Der Verwahrer muß dem Hinterleger auf Verlangen die Sache
auch noch vor Verlauf der Zeit zurückstellen, und kann nur den Ersatz des
ihm etwa verursachten Schadens begehren. Er kann hingegen die ihm
anvertraute Sache nicht früher zurückgeben; es wäre denn, daß ein
unvorhergesehener Umstand ihn außer Stand setzte, die Sache mit Sicherheit
oder ohne seinen eigenen Nachteil zu verwahren.
§
963. Ist die Verwahrungszeit weder ausdrücklich bestimmt worden,
noch sonst aus Nebenumständen abzunehmen; so kann die Verwahrung nach
Belieben aufgekündet werden.
§
964. Der Verwahrer haftet dem Hinterleger für den aus der
Unterlassung der pflichtmäßigen Obsorge verursachten Schaden, aber nicht
für den Zufall; selbst dann nicht, wenn er die anvertraute, obschon
kostbarere Sache, mit Aufopferung seiner eigenen hätte retten können.
§
965. Hat aber der Verwahrer von der hinterlegten Sache Gebrauch
gemacht; hat er sie ohne Not und ohne Erlaubnis des Hinterlegers einem
Dritten in Verwahrung gegeben; oder die Zurückstellung verzögert, und die
Sache leidet einen Schaden, welchem sie bei dem Hinterleger nicht
ausgesetzt gewesen wäre; so kann er keinen Zufall vorschützen, und die
Beschädigung wird ihm zugerechnet.
§
966. [Wenn Sachen verschlossen oder versiegelt hinterlegt, und in
der Folge das Schloß oder Siegel verletzt worden; so ist der Hinterleger,
wenn er einen Abgang behauptet, zur Beschwörung seines Schadens, insofern
derselbe nach seinem Stande, Gewerbe, Vermögen und den übrigen Umständen
wahrscheinlich ist, nach Vorschrift der Gerichtsordnung zuzulassen; es
wäre denn, daß der Verwahrer beweisen könnte, daß die Verletzung des
Schlosses oder Siegels ohne sein Verschulden geschehen sei. Das Nämliche
hat auch dann zu gelten, wenn sämtliche auf solche Art hinterlegte Sachen
in Verlust geraten sind.]
und des Hinterlegers
§
967. Der Hinterleger ist verpflichtet, dem Verwahrer den
schuldbarer Weise zugefügten Schaden, und die zur Erhaltung der verwahrten
Sache, oder zur Vermehrung der fortdauernden Nutzungen verwendeten Kosten
zu ersetzen. Hat der Verwahrer im Notfalle, um das hinterlegte Gut zu
retten, seine eigenen Sachen aufgeopfert; so kann er einen angemessenen
Ersatz fordern. Die wechselseitigen Forderungen des Verwahrers und
Hinterlegers einer beweglichen Sache können aber nur binnen dreißig Tagen
von Zeit der Zurückstellung angebracht werden.
Sequester
§
968. Wird eine in Anspruch genommene Sache von den streitenden
Parteien oder vom Gerichte jemanden in Verwahrung gegeben; so heißt der
Verwahrer, Sequester. Die Rechte und Verbindlichkeiten des Sequesters
werden nach den hier festgesetzten Grundsätzen beurteilt.
Ob dem Verwahrer ein
Lohn gebühre
§
969. Ein Lohn kann für die Aufbewahrung nur dann gefordert werden,
wenn er ausdrücklich, oder nach dem Stande des Aufbewahrers
stillschweigend bedungen worden ist.
Gastaufnahme
§
970.
(1) Gastwirte, die
Fremde beherbergen, haften als Verwahrer für die von den aufgenommenen
Gästen eingebrachten Sachen, sofern sie nicht beweisen, daß der Schaden
weder durch sie oder einen ihrer Leute verschuldet noch durch fremde, in
dem Hause aus- und eingehende Personen verursacht ist. Hat bei der
Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so
hat der Richter nach den Umständen zu entscheiden, ob und in welcher Höhe
ein Ersatz gebührt.
(2) Als eingebracht
gelten die Sachen, die dem Wirte oder einem seiner Leute übergeben oder an
einen von diesen angewiesenen oder hierzu bestimmten Ort gebracht sind.
Ebenso haften Unternehmer, die Stallungen und Aufbewahrungsräume halten,
für die bei ihnen eingestellten Tiere und Fahrzeuge und die auf diesen
befindlichen Sachen.
(3) Den Wirten
werden gleichgehalten die Besitzer von Badeanstalten in Rücksicht auf die
üblicherweise eingebrachten Sachen der Badegäste.
§
970a. Ablehnung der Haftung durch Anschlag ist ohne rechtliche
Wirkung. Für Kostbarkeiten, Geld und Wertpapiere haftet der Gastwirt nur
bis zum Betrage von 550 Euro140)
, es sei denn, daß er diese Sachen in Kenntnis ihrer Beschaffenheit zur
Aufbewahrung übernommen hat oder daß der Schaden von ihm selbst oder
seinen Leuten verschuldet ist.
§
970b. Der Ersatzanspruch aus der Gastaufnahme erlischt, wenn der
Beschädigte nach erlangter Kenntnis von dem Schaden nicht ohne Verzug dem
Wirte die Anzeige macht. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Sachen vom Wirte
zur Aufbewahrung übernommen waren.
§
970c. Den im
§ 970
bezeichneten Personen steht das Recht zu, zur Sicherung ihrer Forderungen
aus der Beherbergung und Verpflegung sowie ihrer Auslagen für die Gäste
die eingebrachten Sachen zurückzuhalten.
Zwanzigstes Hauptstück
Von dem Leihvertrage
Leihvertrag
§
971. Wenn jemandem eine unverbrauchbare Sache bloß zum
unentgeltlichen Gebrauche auf eine bestimmte Zeit übergeben wird; so
entsteht ein Leihvertrag. Der Vertrag, wodurch man jemandem eine Sache zu
leihen verspricht, ohne sie zu übergeben, ist zwar verbindlich, aber noch
kein Leihvertrag.
Rechte und Pflichten des Entlehners:
1. in Rücksicht des
Gebrauches;
§
972. Der Entlehner erwirbt das Recht, den ordentlichen oder näher
bestimmten Gebrauch von der Sache zu machen. Nach Verlauf der Zeit ist er
verpflichtet, eben dieselbe Sache zurückzustellen.
2. der
Zurückstellung;
§
973. Wenn keine Zeit zur Zurückgabe festgesetzt, wohl aber die
Absicht des Gebrauches bestimmt worden ist; so ist der Entlehner
verbunden, mit dem Gebrauche nicht zu zögern, und die Sache so bald als
möglich zurückzugeben.
§
974. Hat man weder die Dauer, noch die Absicht des Gebrauches
bestimmt; so entsteht kein wahrer Vertrag, sondern ein unverbindliches
Bittleihen (Prekarium), und der Verleiher kann die entlehnte Sache nach
Willkür zurückfordern.
§
975. Bei einem Streite über die Dauer des Gebrauches muß der
Entlehner das Recht auf den längeren Gebrauch beweisen.
§
976. Wenngleich die verlehnte Sache vor Verlauf der Zeit und vor
geendigtem Gebrauche dem Verleiher selbst unentbehrlich wird; so hat er
ohne ausdrückliche Verabredung doch kein Recht, die Sache früher
zurückzunehmen.
§
977. Der Entlehner ist zwar in der Regel berechtigt, die entlehnte
Sache auch vor der bestimmten Zeit zurückzugeben; fällt aber die frühere
Zurückgabe dem Verleiher beschwerlich; so kann sie wider seinen Willen
nicht stattfinden.
3. der Beschädigung;
§
978. Wenn der Entlehner die geliehene Sache anders gebraucht, als
es bedungen war, oder den Gebrauch derselben eigenmächtig einem Dritten
gestattet; so ist er dem Verleiher verantwortlich, und dieser auch
berechtigt, die Sache sogleich zurückzufordern.
§
979. Wird die geliehene Sache beschädigt, oder zu Grunde
gerichtet; so muß der Entlehner nicht nur den zunächst durch sein
Verschulden verursachten, sondern auch den zufälligen Schaden, den er
durch eine widerrechtliche Handlung veranlaßt hat, so wie der Verwahrer
einer Sache ersetzen (§
965).
§
980. Dadurch, daß der Entlehner für ein verlornes Lehnstück den
Wert erlegt, hat er noch kein Recht, dasselbe, wenn es wieder gefunden
wird, gegen den Willen des Eigentümers für sich zu behalten, wenn dieser
bereit ist, den empfangenen Wert zurückzugeben.
4. der
Erhaltungskosten
§
981. Die mit dem Gebrauche ordentlicher Weise verbundenen Kosten
muß der Entlehner selbst bestreiten. Die außerordentlichen
Erhaltungskosten hat er zwar, dafern er die Sache dem Verleiher nicht zur
eigenen Besorgung überlassen kann oder will, inzwischen vorzuschießen;
doch werden sie ihm gleich einem redlichen Besitzer vergütet.
Beschränkung der
wechselseitigen Klagen
§
982. Wenn der Verleiher nach der Zurücknahme des Lehnstückes
dessen Mißbrauch, oder übertriebene Abnutzung innerhalb dreißig Tagen
nicht gerügt; oder, wenn der Entlehner nach der Zurückgabe von den auf die
Sache verwendeten außerordentlichen Kosten binnen eben diesem Zeitraume
keine Meldung gemacht hat; so ist die Klage erloschen.
Einundzwanzigstes Hauptstück
Von dem Darlehensvertrage
Darlehen
§
983. Wenn jemandem verbrauchbare Sachen unter der Bedingung
übergeben werden, daß er zwar willkürlich darüber verfügen könne, aber
nach einer gewissen Zeit ebensoviel von derselben Gattung und Güte
zurückgeben soll; so entsteht ein Darlehensvertrag. Er ist mit dem,
obgleich ebenfalls verbindlichen Vertrage (§
936), ein Darlehen künftig zu geben, nicht zu verwechseln.
Arten desselben
§
984. Ein Darlehen wird entweder in Geld oder in anderen
verbrauchbaren Sachen, und zwar ohne, oder gegen Zinsen gegeben. Im
letzteren Falle nennt man es auch einen Zinsenvertrag.
Gelddarlehen:
§
985. Ein Gelddarlehen kann klingende Münze, oder Papiergeld, oder
öffentliche Schuldscheine (Obligationen) zum Gegenstande haben.
a) in klingender
Münze, oder Papiergeld;
§
986. Inwiefern ein Darlehen in klingender Münze überhaupt
geschlossen werden könne, und in welcher Währung (Valuta) ein solches
Darlehen, oder ein Darlehen in Papiergeld zurückzuzahlen sei, bestimmen
die darüber bestehenden besonderen Vorschriften.
§
987. Wenn ein Darleiher sich die Zahlung in der besonderen, von
ihm gegebenen Münzsorte bedungen hat; so muß die Zahlung in eben dieser
Münzsorte geleistet werden.
§
988. Gesetzliche Münzveränderungen ohne Veränderung des inneren
Gehaltes gehen auf Rechnung des Darleihers. Er empfängt die Zahlung in der
bestimmten, gegebenen Münzsorte, z. B. von 1000 Stücken kaiserlicher
Dukaten, oder 3000 Zwanzig-Kreuzer Stücken ohne Rücksicht, ob deren
äußerer Wert in der Zwischenzeit erhöht oder vermindert worden ist. Wird
aber der innere Wert geändert; so ist die Zahlung im Verhältnis zu dem
inneren Werte, den die gegebene Münzsorte zur Zeit des Darlehens hatte, zu
leisten.
§
989. Sind zur Zeit der Rückzahlung dergleichen Münzsorten im
Staate nicht im Umlaufe; so muß der Schuldner den Gläubiger mit zunächst
ähnlichen Geldstücken in solcher Zahl und Art befriedigen, daß derselbe
den zur Zeit des Darlehens bestandenen inneren Wert dessen, was er gegeben
hat, erhalte.
b) in Schuldscheinen;
§
990. In öffentlichen Schuldscheinen können Darlehen in der Art
gültig geschlossen werden, daß die Tilgung der Schuld entweder mit einem
durchaus gleichen öffentlichen Schuldscheine, wie der dargeliehene war,
geleistet, oder der Betrag nach dem Werte, welchen der Schuldschein zur
Zeit des Darlehens hatte, zurückgezahlt werde.
§
991. Wenn statt Geldes ein Privatschuldschein oder Waren gegeben
worden sind; so ist der Schuldner nur verbunden, entweder den Schuldschein
oder die empfangenen Waren unbeschädigt zurückzustellen, oder dem
Gläubiger den von diesem zu erweisenden Schaden zu ersetzen.
c) Darlehen in
anderen verbrauchbaren Gegenständen
§
992. Bei Darlehen, die nicht über Geld, sondern über andere
verbrauchbare Gegenstände geschlossen werden, macht es, dafern nur die
Zurückstellung in der nämlichen Gattung, Güte und Menge bedungen worden,
keinen Unterschied, wenn sie in der Zwischenzeit am Werte gestiegen oder
gefallen sind.
Zinsen
§
993. aufgehoben
§
994. aufgehoben
§
995. aufgehoben
§
996. aufgehoben
§
997. aufgehoben
§
998. aufgehoben
§
999. Zinsen von Gelddarlehen sind in der nämlichen Währung
(Valuta), wie das Kapital selbst, zu entrichten.
§
1000.
(1) An Zinsen, die
ohne Bestimmung der Höhe vereinbart worden sind oder aus dem Gesetz
gebühren, sind, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, vier vom
Hundert auf ein Jahr zu entrichten.
(2) Der Gläubiger
einer Geldforderung kann Zinsen von Zinsen verlangen, wenn die Parteien
dies ausdrücklich vereinbart haben. Sonst kann er, sofern fällige Zinsen
eingeklagt werden, Zinseszinsen vom Tag der Streitanhängigkeit an fordern.
Wurde über die Höhe der Zinseszinsen keine Vereinbarung getroffen, so sind
ebenfalls vier vom Hundert auf ein Jahr zu entrichten.
(3) Haben die
Parteien über die Frist zur Zahlung der Zinsen keine Vereinbarung
getroffen, so sind diese bei der Zurückzahlung des Kapitals oder, sofern
der Vertrag auf mehrere Jahre abgeschlossen worden ist, jährlich zu
zahlen.
Zinsenrechts-Änderungsgesetz, BGBl I Nr. 2002/118
Artikel V
Verbandsklage
1. Ein
Unternehmer, der im geschäftlichen Verkehr ohne sachliche Rechtfertigung
grob nachteilige Zahlungsbedingungen verwendet, indem er einem anderen
unangemessen lange Zahlungsfristen oder wesentlich unter den gesetzlichen
Zinsen liegende Verzugszinsen aufzwingt, kann von Vereinigungen zur
Förderung wirtschaftlicher Interessen von Unternehmern auf Unterlassung
geklagt werden, soweit diese Vereinigungen Interessen vertreten, die durch
die Handlung berührt werden. Der Unterlassungsanspruch kann auch von der
Wirtschaftskammer Österreich und der Präsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern Österreichs geltend gemacht werden. Die
§§ 24,
25 Abs. 3
bis 7 und
26 UWG
1984 sind sinngemäß anzuwenden.
2. Die Gefahr
einer Verwendung derartiger Zahlungsbedingungen besteht nicht mehr, wenn
der Unternehmer nach Abmahnung durch eine nach Z 1 klagebefugte
Vereinigung binnen angemessener Frist eine mit angemessener
Konventionalstrafe (§
1336 ABGB) besicherte Unterlassungserklärung abgibt.
Form des
Schuldscheines
§
1001. Damit ein Schuldschein über einen Darlehensvertrag einen
vollständigen Beweis mache, müssen darin der eigentliche Darleiher oder
Gläubiger sowohl, als der eigentliche Anleiher oder Schuldner; der
Gegenstand und Betrag des Darlehens; und, wenn es in Geld gegeben wird,
die Gattung desselben, wie auch alle auf die Zahlung der Hauptschuld
sowohl, als auf die etwa zu entrichtenden Zinsen sich beziehende
Bedingungen redlich und deutlich bestimmt werden. Die äußere, zur
Beweiskraft nötige Form einer Schuldurkunde setzt die Gerichtsordnung
fest.
Zweiundzwanzigstes Hauptstück
Von der Bevollmächtigung und andern Arten der Geschäftsführung
Bevollmächtigungsvertrag
§
1002. Der Vertrag, wodurch jemand ein ihm aufgetragenes Geschäft
im Namen des andern zur Besorgung übernimmt, heißt
Bevollmächtigungsvertrag.
§
1003. Personen, welche zur Besorgung bestimmter Geschäfte
öffentlich bestellt worden, sind schuldig, über einen darauf sich
beziehenden Auftrag ohne Zögerung gegen den Auftragenden sich ausdrücklich
zu erklären, ob sie denselben annehmen oder nicht; widrigenfalls bleiben
sie dem Auftragenden für den dadurch veranlaßten Nachteil verantwortlich.
Einteilung der
Bevollmächtigung in eine unentgeltliche oder entgeltliche;
§
1004. Wird für die Besorgung eines fremden Geschäftes entweder
ausdrücklich, oder nach dem Stande des Geschäftsträgers auch nur
stillschweigend eine Belohnung bedungen; so gehört der Vertrag zu den
entgeltlichen, außer dem aber zu den unentgeltlichen.
mündliche oder
schriftliche;
§
1005. Bevollmächtigungsverträge können mündlich oder schriftlich
geschlossen werden. Die von dem Gewaltgeber dem Gewalthaber hierüber
ausgestellte Urkunde wird Vollmacht genannt.
allgemeine oder
besondere;
§
1006. Es gibt allgemeine und besondere Vollmachten, je nachdem
jemandem die Besorgung aller, oder nur einiger Geschäfte anvertraut wird.
Die besonderen Vollmachten können bloß gerichtliche oder bloß
außergerichtliche Geschäfte überhaupt; oder sie können einzelne
Angelegenheiten der einen oder der anderen Gattung zum Gegenstande haben.
unumschränkte oder
beschränkte
§
1007. Vollmachten werden entweder mit unumschränkter oder mit
beschränkter Freiheit zu handeln erteilet. Durch die erstere wird der
Gewalthaber berechtigt, das Geschäft nach seinem besten Wissen und
Gewissen zu leiten; durch die letztere aber werden ihm die Grenzen, wie
weit, und die Art, wie er dasselbe betreiben soll, vorgeschrieben.
§
1008. Folgende Geschäfte: wenn im Namen eines andern Sachen
veräußert, oder entgeltlich übernommen; Anleihen oder Darleihen
geschlossen; Geld oder Geldeswert erhoben; Prozesse anhängig gemacht;
[Eide aufgetragen, angenommen oder zurückgeschoben], oder Vergleiche
getroffen werden sollen, erfordern eine besondere, auf diese Gattungen der
Geschäfte lautende Vollmacht. Wenn aber eine Erbschaft unbedingt
angenommen oder ausgeschlagen; Gesellschaftsverträge errichtet;
Schenkungen gemacht; die Befugnis, einen Schiedsrichter zu wählen,
eingeräumt, oder Rechte unentgeltlich aufgegeben werden sollen; ist eine
besondere, auf das einzelne Geschäft ausgestellte Vollmacht notwendig.
Allgemeine, selbst unbeschränkte Vollmachten sind in diesen Fällen nur
hinreichend, wenn die Gattung des Geschäftes in der Vollmacht ausgedrückt
worden ist.
Rechte und
Verbindlichkeiten des Gewalthabers;
§
1009. Der Gewalthaber ist verpflichtet, das Geschäft seinem
Versprechen und der erhaltenen Vollmacht gemäß, emsig und redlich zu
besorgen, und allen aus dem Geschäfte entspringenden Nutzen dem Machtgeber
zu überlassen. Er ist, ob er gleich eine beschränkte Vollmacht hat,
berechtigt, alle Mittel anzuwenden, die mit der Natur des Geschäftes
notwendig verbunden, oder der erklärten Absicht des Machtgebers gemäß
sind. Überschreitet er aber die Grenzen der Vollmacht; so haftet er für
die Folgen.
§
1010. Trägt der Gewalthaber das Geschäft ohne Not einem Dritten
auf; so haftet er ganz allein für den Erfolg. Wird ihm aber die Bestellung
eines Stellvertreters in der Vollmacht ausdrücklich gestattet, oder durch
die Umstände unvermeidlich; so verantwortet er nur ein bei der Auswahl der
Person begangenes Verschulden.
§
1011. Wird mehreren Bevollmächtigten zugleich ein Geschäft
aufgetragen; so ist die Mitwirkung aller zur Gültigkeit des Geschäftes,
und Verpflichtung des Machtgebers notwendig; wenn nicht ausdrücklich einem
oder mehreren aus ihnen die volle Befugnis in der Vollmacht erteilt worden
ist.
§
1012. Der Gewalthaber ist schuldig, dem Machtgeber den durch sein
Verschulden verursachten Schaden zu ersetzen, und die bei dem Geschäfte
vorkommenden Rechnungen, sooft dieser es verlangt, vorzulegen.
§
1013. Gewalthaber sind, außer dem im
§ 1004
enthaltenen Falle, nicht befugt, ihrer Bemühung wegen eine Belohnung zu
fordern. Es ist ihnen nicht erlaubt, ohne Willen des Machtgebers in
Rücksicht auf die Geschäftsverwaltung von einem Dritten Geschenke
anzunehmen. Die erhaltenen werden zur Armenkasse
[nunmehr: Fürsorgeverband]
eingezogen.
des Gewaltgebers;
§
1014. Der Gewaltgeber ist verbunden, dem Gewalthaber allen zur
Besorgung des Geschäftes notwendig oder nützlich gemachten Aufwand, selbst
bei fehlgeschlagenem Erfolge, zu ersetzen, und ihm auf Verlangen zur
Bestreitung der baren Auslagen auch einen angemessenen Vorschuß zu
leisten; er muß ferner allen durch sein Verschulden entstandenen, oder mit
der Erfüllung des Auftrages verbundenen Schaden vergüten.
§
1015. Leidet der Gewalthaber bei der Geschäftsführung nur
zufälligerweise Schaden; so kann er in dem Falle, daß er das Geschäft
unentgeltlich zu besorgen übernahm, einen solchen Betrag fordern, welcher
ihm bei einem entgeltlichen Vertrage zur Vergütung der Bemühung nach dem
höchsten Schätzungswerte gebührt haben würde.
§
1016. Überschreitet der Gewalthaber die Grenzen seiner Vollmacht;
so ist der Gewaltgeber nur insofern verbunden, als er das Geschäft
genehmigt, oder den aus dem Geschäfte entstandenen Vorteil sich zuwendet.
in Rücksicht eines
Dritten;
§
1017. Insofern der Gewalthaber nach dem Inhalte der Vollmacht den
Gewaltgeber vorstellt, kann er ihm Rechte erwerben und Verbindlichkeiten
auflegen. Hat er also innerhalb der Grenzen der offenen Vollmacht mit
einem Dritten einen Vertrag geschlossen; so kommen die dadurch gegründeten
Rechte und Verbindlichkeiten dem Gewaltgeber und dem Dritten; nicht aber
dem Gewalthaber zu. Die dem Gewalthaber erteilte geheime Vollmacht hat auf
die Rechte des Dritten keinen Einfluß.
§
1018. Auch in dem Falle, daß der Gewaltgeber einen solchen
Gewalthaber, der sich selbst zu verbinden unfähig ist, aufgestellt hat,
sind die innerhalb der Grenzen der Vollmacht geschlossenen Geschäfte
sowohl für den Gewaltgeber, als für den Dritten verbindlich.
§
1019. aufgehoben
Auflösung des
Vertrages durch den Widerruf;
§
1020. Es steht dem Machtgeber frei, die Vollmacht nach Belieben zu
widerrufen; doch muß er dem Gewalthaber nicht nur die in der Zwischenzeit
gehabten Kosten und den sonst erlittenen Schaden ersetzen; sondern auch
einen der Bemühung angemessenen Teil der Belohnung entrichten. Dieses
findet auch dann statt, wenn die Vollendung des Geschäftes durch einen
Zufall verhindert worden ist.
die Aufkündung;
§
1021. Auch der Machthaber kann die angenommene Vollmacht
aufkünden. Wenn er sie aber vor Vollendung des ihm insbesondere
aufgetragenen, oder vermöge der allgemeinen Vollmacht angefangenen
Geschäftes aufkündet; so muß er, dafern nicht ein unvorhergesehenes und
unvermeidliches Hindernis eingetreten ist, allen daraus entstandenen
Schaden ersetzen.
den Tod;
§
1022. In der Regel wird die Vollmacht sowohl durch den Tod des
Gewaltgebers als des Gewalthabers aufgehoben. Läßt sich aber das
angefangene Geschäft ohne offenbaren Nachteil der Erben nicht
unterbrechen, oder erstreckt sich die Vollmacht selbst auf den Sterbefall
des Gewaltgebers; so hat der Gewalthaber das Recht und die Pflicht, das
Geschäft zu vollenden.
§
1023. Die von einem Körper (Gemeinschaft) ausgestellten und
übernommenen Vollmachten werden durch die Erlöschung der Gemeinschaft
aufgehoben.
oder Konkurs
§
1024. Verfällt der Machtgeber in Konkurs; so sind alle Handlungen,
die der Gewalthaber nach Kundmachung des Konkurses im Namen des
Konkursschuldners unternommen hat, ohne Rechtskraft. Ebenso erklärt die
Verhängung des Konkurses über das Vermögen des Machthabers schon an und
für sich die erteilte Vollmacht für aufgehoben.
Inwiefern die
Verbindlichkeit fortdauere
§
1025. Wird die Vollmacht durch Widerruf, Aufkündung, oder durch
den Tod des Gewaltgebers oder Gewalthabers aufgehoben; so müssen doch die
Geschäfte, welche keinen Aufschub leiden, so lange fortgesetzt werden, bis
von dem Machtgeber oder dessen Erben eine andere Verfügung getroffen
worden ist, oder füglich getroffen werden konnte.
§
1026. Auch bleiben die mit einem Dritten, dem die Aufhebung der
Vollmacht ohne sein Verschulden unbekannt war, geschlossenen Verträge
verbindlich, und der Gewaltgeber kann sich nur bei dem Gewalthaber, der
die Aufhebung verschwiegen hat, wegen seines Schadens erholen.
Stillschweigende
Bevollmächtigung der Dienstpersonen
§
1027. Die in diesem Hauptstücke enthaltenen Vorschriften haben
auch ihre Anwendung auf die Eigentümer einer Handlung, eines Schiffes,
Kaufladens oder andern Gewerbes, welche die Verwaltung einem Faktor,
Schiffer, Ladendiener oder andern Geschäftsträgern anvertrauen.
§
1028. Die Rechte solcher Geschäftsführer sind vorzüglich aus der
Urkunde ihrer Bestellung, dergleichen unter Handelsleuten das ordentlich
kundgemachte Befugnis der Unterzeichnung (Firma) ist, zu beurteilen.
§
1029. Ist die Vollmacht nicht schriftlich gegeben worden; so wird
ihr Umfang aus dem Gegenstande, und aus der Natur des Geschäftes
beurteilt. Wer einem andern eine Verwaltung anvertraut hat, von dem wird
vermutet, daß er ihm auch die Macht eingeräumt habe, alles dasjenige zu
tun, was die Verwaltung selbst erfordert und was gewöhnlich damit
verbunden ist (§
1009).
§
1030. Gestattet der Eigentümer einer Handlung oder eines Gewerbes
seinem Diener oder Lehrlinge, Waren im Laden oder außer demselben zu
verkaufen; so wird vermutet, daß sie bevollmächtigt seien, die Bezahlung
zu empfangen, und Quittungen dagegen auszustellen.
§
1031. Die Vollmacht, Waren im Namen des Eigentümers zu verkaufen,
erstreckt sich aber nicht auf das Recht, in seinem Namen Waren
einzukaufen; auch dürfen Fuhrleute weder den Wert der ihnen anvertrauten
Güter beziehen, noch Geld darauf anleihen, wenn es nicht ausdrücklich in
Frachtbriefen bestimmt worden ist.
§
1032. Dienstgeber und Familienhäupter sind nicht verbunden, das,
was von ihren Dienstpersonen oder andern Hausgenossen in ihrem Namen auf
Borg genommen wird, zu bezahlen. Der Borger muß in solchen Fällen den
gemachten Auftrag erweisen.
§
1033. Besteht aber zwischen dem Borgnehmer und dem Borggeber ein
ordentliches Einschreibebuch, worin die ausgeborgten Sachen aufgezeichnet
werden; so gilt die Vermutung, daß der Überbringer dieses Buches
bevollmächtigt sei, die Ware auf Borg zu nehmen.
Gerichtliche und
gesetzliche Bevollmächtigung
§
1034. 141)
Das Recht der Großeltern, der Pflegeeltern, anderer mit der Obsorge
betrauter Personen, der Sachwalter und Kuratoren, die Geschäfte ihrer
Pflegebefohlenen zu verwalten, gründet sich auf die Anordnung des
Gerichtes. Die Eltern (ein Elternteil) werden unmittelbar durch das Gesetz
mit der Vertretung ihrer minderjährigen Kinder betraut.
Geschäftsführung ohne
Auftrag;
§
1035. Wer weder durch ausdrücklichen oder stillschweigenden
Vertrag, noch vom Gerichte, noch aus dem Gesetze die Befugnis erhalten
hat, darf der Regel nach sich in das Geschäft eines andern nicht mengen.
Hätte er sich dessen angemaßt; so ist er für alle Folgen verantwortlich.
im Notfalle;
§
1036. Wer, obgleich unberufen, ein fremdes Geschäft zur Abwendung
eines bevorstehenden Schadens besorgt, dem ist derjenige, dessen Geschäft
er besorgt hat, den notwendigen und zweckmäßig gemachten Aufwand zu
ersetzen schuldig; wenngleich die Bemühung ohne Verschulden fruchtlos
geblieben ist (§
403).
oder zum Nutzen des
anderen;
§
1037. Wer fremde Geschäfte bloß, um den Nutzen des andern zu
befördern, übernehmen will, soll sich um dessen Einwilligung bewerben. Hat
der Geschäftsführer zwar diese Vorschrift unterlassen, aber das Geschäft
auf seine Kosten zu des andern klarem, überwiegenden Vorteile geführt; so
müssen ihm von diesem die darauf verwendeten Kosten ersetzt werden.
§
1038. Ist aber der überwiegende Vorteil nicht klar; oder hat der
Geschäftsführer eigenmächtig so wichtige Veränderungen in einer fremden
Sache vorgenommen, daß die Sache dem andern zu dem Zwecke, wozu er sie
bisher benützte, unbrauchbar wird, so ist dieser zu keinem Ersatze
verbunden; er kann vielmehr verlangen, daß der Geschäftsführer auf eigene
Kosten die Sache in den vorigen Stand zurücksetze, oder, wenn das nicht
möglich ist, ihm volle Genugtuung leiste.
§
1039. Wer ein fremdes Geschäft ohne Auftrag auf sich genommen hat,
muß es bis zur Vollendung fortsetzen, und gleich einem Bevollmächtigten
genaue Rechnung darüber ablegen.
gegen den Willen des
anderen
§
1040. Wenn jemand gegen den gültig erklärten Willen des
Eigentümers sich eines fremden Geschäftes anmaßt, oder den rechtmäßigen
Bevollmächtigten durch eine solche Einmengung an der Besorgung des
Geschäftes verhindert; so verantwortet er nicht nur den hieraus
erwachsenen Schaden und entgangenen Gewinn, sondern er verliert auch den
gemachten Aufwand, insofern er nicht in Natur zurückgenommen werden kann.
Verwendung einer
Sache zum Nutzen des anderen
§
1041. Wenn ohne Geschäftsführung eine Sache zum Nutzen eines
andern verwendet worden ist; kann der Eigentümer sie in Natur, oder, wenn
dies nicht mehr geschehen kann, den Wert verlangen, den sie zur Zeit der
Verwendung gehabt hat, obgleich der Nutzen in der Folge vereitelt worden
ist.
§
1042. Wer für einen andern einen Aufwand macht, den dieser nach
dem Gesetze selbst hätte machen müssen, hat das Recht, den Ersatz zu
fordern.
§
1043. Hat jemand in einem Notfalle, um einen größern Schaden von
sich und andern abzuwenden, sein Eigentum aufgeopfert; so müssen ihn alle,
welche daraus Vorteil zogen, verhältnismäßig entschädigen. Die
ausführlichere Anwendung dieser Vorschrift auf Seegefahren ist ein
Gegenstand der Seegesetze.
§
1044. Die Verteilung der Kriegsschäden wird nach besondern
Vorschriften von den politischen Behörden bestimmt.
Dreiundzwanzigstes Hauptstück
Von dem Tauschvertrage
Tausch
§
1045. Der Tausch ist ein Vertrag, wodurch eine Sache gegen eine
andere Sache überlassen wird. Die wirkliche Übergabe ist nicht zur
Errichtung; sondern nur zur Erfüllung des Tauschvertrages, und zur
Erwerbung des Eigentumes notwendig.
§
1046. Das Geld ist kein Gegenstand des Tauschvertrages; doch
lassen sich Gold und Silber als eine Ware, und selbst als Münzsorten
insoweit vertauschen, als sie nur gegen andere Münzsorten, goldene nämlich
gegen silberne, kleinere gegen größere Stücke verwechselt werden sollen.
Rechte und Pflichten
der Tauschenden;
§
1047. Tauschende sind vermöge des Vertrages verpflichtet, die
vertauschten Sachen der Verabredung gemäß mit ihren Bestandteilen und mit
allem Zugehöre zu rechter Zeit, am gehörigen Ort und in eben dem Zustand,
in welchem sie sich bei Schließung des Vertrages befunden haben, zum
freien Besitz zu übergeben und zu übernehmen.
insbesondere in
Rücksicht der Gefahr;
§
1048. Ist eine Zeit bedungen, zu welcher die Übergabe geschehen
soll, und wird in der Zwischenzeit entweder die vertauschte bestimmte
Sache durch Verbot außer Verkehr gesetzt, oder zufälliger Weise ganz, oder
doch über die Hälfte am Werte zu Grunde gerichtet, so ist der Tausch für
nicht geschlossen anzusehen.
§
1049. Andere in dieser Zwischenzeit durch Zufall erfolgte
Verschlimmerungen der Sache und Lasten gehen auf die Rechnung des
Besitzers. Sind jedoch Sachen in Pausch und Bogen behandelt worden; so
trägt der Übernehmer den zufälligen Untergang einzelner Stücke, wenn
anders hierdurch das Ganze nicht über die Hälfte am Werte verändert worden
ist.
und der Nutzungen vor
der Übergabe
§
1050. Dem Besitzer gebühren die Nutzungen der vertauschten Sache
bis zur bedungenen Zeit der Übergabe. Von dieser Zeit an gebühren sie,
samt dem Zuwachse, dem Übernehmer, obgleich die Sache noch nicht übergeben
worden ist.
§
1051. Ist keine Zeit zur Übergabe der bestimmten Sache bedungen,
und fällt keinem Teile ein Versehen zur Last; so sind die obigen
Vorschriften wegen Gefahr und Nutzungen (§§
1048 bis 1050) auf den Zeitpunkt der Übergabe selbst anzuwenden;
insofern die Parteien nicht etwas anderes festgesetzt haben.
§
1052. Wer auf die Übergabe dringen will, muß seine Verbindlichkeit
erfüllt haben oder sie zu erfüllen bereit sein. Auch der zur
Vorausleistung Verpflichtete kann seine Leistung bis zur Bewirkung oder
Sicherstellung der Gegenleistung verweigern, wenn diese durch schlechte
Vermögensverhältnisse des anderen Teiles gefährdet ist, die ihm zur Zeit
des Vertragsabschlusses nicht bekannt sein mußten.
Vierundzwanzigstes Hauptstück
Von dem Kaufvertrage
Kaufvertrag
§
1053. Durch den Kaufvertrag wird eine Sache um eine bestimmte
Summe Geldes einem andern überlassen. Er gehört, wie der Tausch, zu den
Titeln, ein Eigentum zu erwerben. Die Erwerbung erfolgt erst durch die
Übergabe des Kaufgegenstandes. Bis zur Übergabe behält der Verkäufer das
Eigentumsrecht.
Erfordernisse des
Kaufvertrages
§
1054. Wie die Einwilligung des Käufers und Verkäufers beschaffen
sein müsse, und welche Sachen gekauft und verkauft werden dürfen, dieses
wird nach den Regeln der Verträge überhaupt bestimmt. Der Kaufpreis muß in
barem Gelde bestehen, und darf weder unbestimmt, noch gesetzwidrig sein.
Der
Kaufpreis muß
a) in barem Gelde
bestehen;
§
1055. Wird eine Sache teils gegen Geld, teils gegen eine andere
Sache veräußert; so wird der Vertrag, je nachdem der Wert am Gelde mehr
oder weniger, als der gemeine Wert der gegebenen Sache beträgt, zum Kaufe
oder Tausche, und bei gleichem Werte der Sache, zum Kaufe gerechnet.
b) bestimmt;
§
1056. Käufer und Verkäufer können die Festsetzung des Preises auch
einer dritten bestimmten Person überlassen. Wird von dieser in dem
bedungenen Zeitraume nichts festgesetzt; oder will im Falle, daß kein
Zeitraum bedungen worden ist, ein Teil vor der Bestimmung des Preises
zurücktreten; so wird der Kaufvertrag als nicht geschlossen angesehen.
§
1057. Wird die Bestimmung des Preises mehreren Personen
überlassen, so entscheidet die Mehrheit der Stimmen. Fallen die Stimmen so
verschieden aus, daß der Preis nicht einmal durch wirkliche Mehrheit der
Stimmen festgesetzt wird; so ist der Kauf für nicht eingegangen zu achten.
§
1058. Auch der Wert, welcher bei einer frühern Veräußerung
bedungen worden ist, kann zur Bestimmung des Preises dienen. Hat man den
ordentlichen Marktpreis zum Grunde gelegt, so wird der mittlere Marktpreis
des Ortes und der Zeit, wo und in welcher der Vertrag erfüllt werden muß,
angenommen.
c) nicht gesetzwidrig
sein
§
1059. aufgehoben
§
1060. Außer diesem Falle kann der Kauf sowohl von dem Käufer als
Verkäufer nur wegen Verletzung über die Hälfte bestritten werden (§§
934 und
935).
Diese Beschwerde findet auch dann statt, wenn der Ausspruch des
Kaufpreises einem Dritten überlassen worden ist.
Pflichten des
Verkäufers,
§
1061. Der Verkäufer ist schuldig, die Sache bis zur Zeit der
Übergabe sorgfältig zu verwahren und sie dem Käufer nach eben den
Vorschriften zu übergeben, welche oben bei dem Tausche (§
1047) aufgestellt worden sind.
und des Käufers
§
1062. Der Käufer hingegen ist verbunden, die Sache sogleich, oder
zur bedungenen Zeit zu übernehmen, zugleich aber auch das Kaufgeld bar
abzuführen; widrigenfalls ist der Verkäufer ihm die Übergabe der Sache zu
verweigern berechtigt.
§
1063. Wird die Sache dem Käufer von dem Verkäufer, ohne das
Kaufgeld zu erhalten, übergeben; so ist die Sache auf Borg verkauft, und
das Eigentum derselben geht gleich auf den Käufer über.
Gefahr und Nutzen des
Kaufgegenstandes
§
1064. In Rücksicht der Gefahr und Nutzungen einer zwar gekauften,
aber noch nicht übergebenen Sache gelten die nämlichen Vorschriften, die
bei dem Tauschvertrage gegeben worden sind (§§
1048 - 1051).
Kauf einer gehofften
Sache
§
1065. Wenn Sachen, die noch zu erwarten stehen, gekauft werden; so
sind die in dem
Hauptstücke von gewagten Geschäften gegebenen Anordnungen anzuwenden.
Allgemeine Vorschrift
§
1066. In allen bei einem Kaufvertrage vorkommenden Fällen, welche
in dem Gesetze nicht ausdrücklich entschieden werden, sind die in den
Hauptstücken von
Verträgen überhaupt, und von dem Tauschvertrage insbesondere
aufgestellten Vorschriften anzuwenden.
Besondere Arten oder
Nebenverträge eines Kaufvertrages
§
1067. Besondere Arten oder Nebenverträge eines Kaufvertrages sind:
der Vorbehalt des Wiederkaufes, des Rückverkaufes, des Vorkaufes; der
Verkauf auf die Probe; der Verkauf mit Vorbehalt eines bessern Käufers;
und der Verkaufsauftrag.
Verkauf mit Vorbehalt
des Wiederkaufes
§
1068. Das Recht, eine verkaufte Sache wieder einzulösen, heißt das
Recht des Wiederkaufes. Ist dieses Recht dem Verkäufer überhaupt und ohne
nähere Bestimmung eingeräumt, so wird von einer Seite das Kaufstück in
einem nicht verschlimmerten Zustande; von der andern Seite aber das
erlegte Kaufgeld zurückgegeben, und die inzwischen beiderseits aus dem
Gelde und der Sache gezogenen Nutzungen bleiben gegeneinander aufgehoben.
§
1069. Hat der Käufer das Kaufstück aus dem Seinigen verbessert;
oder zu dessen Erhaltung außerordentliche Kosten verwendet, so gebührt ihm
gleich einem redlichen Besitzer der Ersatz; er haftet aber auch dafür,
wenn durch sein Verschulden der Wert verändert oder die Zurückgabe
vereitelt worden ist.
§
1070. Der Vorbehalt des Wiederkaufes findet nur bei unbeweglichen
Sachen statt und gebührt dem Verkäufer nur für seine Lebenszeit. Er kann
sein Recht weder auf die Erben noch auf einen anderen übertragen. Ist das
Recht in die öffentlichen Bücher einverleibt, so kann die Sache auch einem
Dritten abgefordert werden und dieser wird nach Beschaffenheit seines
redlichen oder unredlichen Besitzes behandelt.
Kauf mit Vorbehalt
des Rückverkaufes
§
1071. Den nämlichen Beschränkungen unterliegt das von dem Käufer
ausbedungene Recht, die Sache dem Verkäufer wieder zurückzuverkaufen; und
es sind auf dasselbe die für den Wiederkauf erteilten Vorschriften
anzuwenden. Ist aber die Bedingung des Wiederverkaufs oder Wiederkaufs
verstellt, und eigentlich, um ein Pfandrecht oder ein Borggeschäft zu
verbergen, gebraucht worden, so tritt die Vorschrift des
§ 916
ein.
Vorbehalt des
Vorkaufsrechts
§
1072. Wer eine Sache mit der Bedingung verkauft, daß der Käufer,
wenn er eine solche wieder verkaufen will, ihm die Einlösung anbieten
soll, der hat das Vorkaufsrecht.
§
1073. Das Vorkaufsrecht ist in der Regel ein persönliches Recht.
In Rücksicht auf unbewegliche Güter kann es durch Eintragung in die
öffentlichen Bücher in ein dingliches verwandelt werden.
§
1074. Auch kann das Vorkaufsrecht weder einem Dritten abgetreten,
noch auf die Erben des Berechtigten übertragen werden.
§
1075. Der Berechtigte muß bewegliche Sachen binnen vierundzwanzig
Stunden; unbewegliche aber binnen dreißig Tagen, nach der geschehenen
Anbietung, wirklich einlösen. Nach Verlauf dieser Zeit ist das
Vorkaufsrecht erloschen.
§
1076. Das Vorkaufsrecht hat im Falle einer gerichtlichen
Feilbietung der mit diesem Rechte belasteten Sachen keine andere Wirkung,
als daß der den öffentlichen Büchern einverleibte Berechtigte zur
Feilbietung insbesondere vorgeladen werden muß.
§
1077. Der zur Einlösung Berechtigte muß, außer dem Falle einer
andern Verabredung, den vollständigen Preis, welcher von einem Dritten
angeboten worden ist, entrichten. Kann er die außer dem gewöhnlichen
Kaufpreise angebotenen Nebenbedingungen nicht erfüllen und lassen sie sich
auch durch einen Schätzungswert nicht ausgleichen, so kann das
Vorkaufsrecht nicht ausgeübt werden.
§
1078. Das Vorkaufsrecht läßt sich auf andere Veräußerungsarten
ohne eine besondere Verabredung nicht ausdehnen.
§
1079. Hat der Besitzer dem Berechtigten die Einlösung nicht
angeboten, so muß er ihm für allen Schaden haften. Im Falle eines
dinglichen Vorkaufsrechts kann die veräußerte Sache dem Dritten
abgefordert werden, und dieser wird nach Beschaffenheit seines redlichen
oder unredlichen Besitzes behandelt.
Kauf auf die Probe
§
1080. Der Kauf auf die Probe ist unter der im Belieben des Käufers
stehenden Bedingung geschlossen, daß er die Ware genehmige. Die Bedingung
ist im Zweifel eine aufschiebende; der Käufer ist vor der Genehmigung an
den Kauf nicht gebunden, der Verkäufer hört auf, gebunden zu sein, wenn
der Käufer bis zum Ablaufe der Probezeit nicht genehmigt.
§
1081. Ist die Sache zum Zwecke der Besichtigung oder Probe bereits
übergeben, so gilt Stillschweigen des Käufers bis nach Ablauf der
Probezeit als Genehmigung.
§
1082. Ist die Probezeit durch Verabredung nicht bestimmt worden,
so wird sie bei beweglichen Sachen auf drei Tage; bei unbeweglichen aber
auf ein Jahr angenommen.
Verkauf mit Vorbehalt
eines besseren Käufers
§
1083. Wird das Kaufgeschäft mit dem Vorbehalte verabredet, daß der
Verkäufer, wenn sich binnen einer bestimmten Zeit ein besserer Käufer
meldet, denselben vorzuziehen befugt sei; so bleibt in dem Falle, daß das
Kaufstück nicht übergeben worden, die Wirklichkeit des Vertrages bis zum
Eintritte der Bedingung aufgeschoben.
§
1084. Ist das Kaufstück übergeben worden, so ist der Kaufvertrag
abgeschlossen; er wird aber durch den Eintritt der Bedingung wieder
aufgelöst. Bei dem Mangel einer ausdrücklichen Zeitbestimmung wird der bei
dem Kaufe auf die Probe angenommene Zeitraum vermutet.
§
1085. Ob der neue Käufer besser sei, beurteilt der Verkäufer. Er
kann den zweiten Käufer, wenn der erste auch noch mehr zahlen wollte,
vorziehen. Bei der Auflösung des Vertrages heben sich die Nutzungen der
Sache und des Geldes gegeneinander auf. In Rücksicht der Verbesserungen
oder Verschlimmerungen wird der Käufer gleich einem redlichen Besitzer
behandelt.
Verkaufsauftrag
§
1086. Wenn jemand seine bewegliche Sache einem anderen für einen
gewissen Preis zum Verkaufe übergibt, mit der Bedingung, daß ihm der
Übernehmer binnen einer festgesetzten Zeit entweder das bestimmte Kaufgeld
liefern oder die Sache zurückstellen soll; so ist der Übergeber vor
Verlauf der Zeit die Sache zurückzufordern nicht berechtigt; der
Übernehmer aber muß nach deren Ablauf das bestimmte Kaufgeld entrichten.
§
1087. Während der festgesetzten Zeit bleibt der Übergeber
Eigentümer. Der Übernehmer haftet ihm für den durch sein Verschulden
verursachten Schaden, und es werden ihm bei Zurückstellung der Sache nur
solche Kosten vergütet, die dem Übergeber zum Nutzen gereichen.
§
1088. Ist die Sache unbeweglich; oder ist der Preis, oder die
Zahlungsfrist nicht bestimmt; so wird der Übernehmer wie ein Gewalthaber
angesehen. In keinem Falle kann die zum Verkaufe anvertraute Sache dem
Dritten, welcher sie von dem Übernehmer redlicher Weise an sich gebracht
hat, abgefordert werden (§
367).
§
1089. Auch bei gerichtlichen Verkäufen finden die über Verträge
und den Tausch- und Kaufvertrag insbesondere aufgestellten Vorschriften in
der Regel statt; insofern nicht in diesem Gesetze, oder in der
Gerichtsordnung eigene Anordnungen enthalten sind.
Fünfundzwanzigstes Hauptstück
Von Bestand-, Erbpacht- und Erbzinsverträgen
Bestandvertrag
§
1090. Der Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch einer
unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten
Preis erhält, heißt überhaupt Bestandvertrag.
I.
Miet- und Pachtvertrag
§
1091. Der Bestandvertrag wird, wenn sich die in Bestand gegebene
Sache ohne weitere Bearbeitung gebrauchen läßt, ein Mietvertrag; wenn sie
aber nur durch Fleiß und Mühe benützt werden kann, ein Pachtvertrag
genannt. Werden durch einen Vertrag Sachen von der ersten und zweiten Art
zugleich in Bestand gegeben; so ist der Vertrag nach der Beschaffenheit
der Hauptsache zu beurteilen.
Erfordernisse
§
1092. Miet- und Pachtverträge können über die nämlichen
Gegenstände und auf die nämliche Art, als der Kaufvertrag geschlossen
werden. Der Miet- und Pachtzins wird, wenn keine andere Übereinkunft
getroffen worden ist, wie das Kaufgeld entrichtet.
§
1093. Der Eigentümer kann sowohl seine beweglichen und
unbeweglichen Sachen, als seine Rechte in Bestand geben; er kann aber auch
in den Fall kommen, den Gebrauch seiner eigenen Sache, wenn er einem
Dritten gebührt, in Bestand zu nehmen.
Wirkung
§
1094. Sind die vertragschließenden Teile über das Wesentliche des
Bestandes, nämlich über die Sache und den Preis, übereingekommen; so ist
der Vertrag vollkommen abgeschlossen, und der Gebrauch der Sache für
gekauft anzusehen.
§
1095. Wenn ein Bestandvertrag in die öffentlichen Bücher
eingetragen ist; so ist das Recht des Bestandnehmers als ein dingliches
Recht zu betrachten, welches sich auch der nachfolgende Besitzer auf die
noch übrige Zeit gefallen lassen muß.
Wechselseitige Rechte:
1. In Hinsicht auf
Überlassung, Erhaltung, Benützung;
§
1096.
(1) Vermieter und
Verpächter sind verpflichtet, das Bestandstück auf eigene Kosten in
brauchbarem Stande zu übergeben und zu erhalten und die Bestandinhaber in
dem bedungenen Gebrauche oder Genusse nicht zu stören. Ist das
Bestandstück bei der Übergabe derart mangelhaft oder wird es während der
Bestandzeit ohne Schuld des Bestandnehmers derart mangelhaft, daß es zu
dem bedungenen Gebrauche nicht taugt, so ist der Bestandnehmer für die
Dauer und in dem Maße der Unbrauchbarkeit von der Entrichtung des Zinses
befreit. Auf diese Befreiung kann bei der Miete unbeweglicher Sachen im
voraus nicht verzichtet werden.
(2) Der Pächter hat
die gewöhnlichen Ausbesserungen der Wirtschaftsgebäude nur insoweit selbst
zu tragen, als sie mit den Materialien des Gutes und den Diensten, die er
nach der Beschaffenheit des Gutes zu fordern berechtigt ist, bestritten
werden können.
§
1097. Werden Ausbesserungen nötig, welche dem Bestandgeber
obliegen, so ist der Bestandnehmer bei sonstigem Schadenersatz
verpflichtet, dem Bestandgeber ohne Verzug Anzeige zu machen. Der
Bestandnehmer wird als ein Geschäftsführer ohne Auftrag betrachtet, wenn
er auf das Bestandstück einen dem Bestandgeber obliegenden Aufwand (§
1036) oder einen nützlichen Aufwand (§
1037) gemacht hat; er muß aber den Ersatz längstens binnen sechs
Monaten nach Zurückstellung des Bestandstückes gerichtlich fordern, sonst
ist die Klage erloschen.
§
1098. Mieter und Pächter sind berechtigt, die Miet- und
Pachtstücke dem Vertrage gemäß durch die bestimmte Zeit zu gebrauchen und
zu benützen, oder auch in Afterbestand zu geben, wenn es ohne Nachteil des
Eigentümers geschehen kann und im Vertrage nicht ausdrücklich untersagt
worden ist.
2. Lasten;
§
1099. Bei Vermietungen trägt alle Lasten und Abgaben der
Vermieter. Bei eigentlichen Pachtungen, wenn sie in Pausch und Bogen
geschehen, übernimmt der Pächter, mit Ausschluß der eingetragenen
Hypothekarlasten, alle übrige; wird aber die Pachtung nach einem Anschlage
geschlossen, so trägt er jene Lasten, welche von dem Ertrage abgezogen
worden sind, oder bloß von den Früchten, und nicht von dem Grunde selbst
entrichtet werden müssen.
3. Zins
§
1100. Ist nichts anderes vereinbart oder ortsüblich, so ist der
Zins, wenn eine Sache auf ein oder mehrere Jahre in Bestand genommen wird,
halbjährlich, bei einer kürzeren Bestandzeit hingegen nach Verlauf
derselben zu entrichten.
§
1101.
(1) Zur
Sicherstellung des Bestandzinses hat der Vermieter einer unbeweglichen
Sache das Pfandrecht an den eingebrachten, dem Mieter oder seinen mit ihm
in gemeinschaftlichem Haushalte lebenden Familienmitgliedern gehörigen
Einrichtungsstücken und Fahrnissen, soweit sie nicht der Pfändung entzogen
sind. Das Pfandrecht erlischt, wenn die Gegenstände vor ihrer pfandweisen
Beschreibung entfernt werden, es sei denn, daß dies infolge einer
gerichtlichen Verfügung geschieht und der Vermieter binnen drei Tagen nach
dem Vollzuge sein Recht bei Gericht anmeldet.
(2) Zieht der
Mieter aus oder werden Sachen verschleppt, ohne daß der Zins entrichtet
oder sichergestellt ist, so kann der Vermieter die Sachen auf eigene
Gefahr zurückbehalten, doch muß er binnen drei Tagen um die pfandweise
Beschreibung ansuchen oder die Sachen herausgeben.
(3) Dem Verpächter
eines Grundstückes steht in gleichem Umfange und mit gleicher Wirkung das
Pfandrecht an dem auf dem Pachtgute vorhandenen Vieh und den
Wirtschaftsgerätschaften und den darauf noch befindlichen Früchten zu.
§
1102. Der Bestandgeber kann sich zwar die Vorausbezahlung des
Bestandzinses bedingen. Hat aber der Bestandnehmer mehr als eine
Fristzahlung voraus geleistet, so kann er dieselbe einem später
eingetragenen Gläubiger oder neuen Eigentümer nur dann entgegensetzen,
wenn sie in dem öffentlichen Buch ersichtlich gemacht ist.
Zins in Früchten
§
1103. Wenn der Eigentümer sein Gut mit der Bedingung überläßt, daß
der Übernehmer die Wirtschaft betreiben, und dem Übergeber einen auf die
ganze Nutzung sich beziehenden Teil, z. B. ein Dritteil oder die Hälfte
der Früchte geben solle; so entsteht kein Pacht-, sondern ein
Gesellschaftsvertrag, welcher nach den darüber aufgestellten Regeln
beurteilt wird.
Fälle und Bedingungen
einer Erlassung des Zinses
§
1104. Wenn die in Bestand genommene Sache wegen außerordentlicher
Zufälle, als Feuer, Krieg oder Seuche, großer Überschwemmungen,
Wetterschläge, oder wegen gänzlichen Mißwachses gar nicht gebraucht oder
benutzt werden kann, so ist der Bestandgeber zur Wiederherstellung nicht
verpflichtet, doch ist auch kein Miet- oder Pachtzins zu entrichten.
§
1105. Behält der Mieter trotz eines solchen Zufalls einen
beschränkten Gebrauch des Mietstückes, so wird ihm auch ein
verhältnismäßiger Teil des Mietzinses erlassen. Dem Pächter gebührt ein
Erlaß an dem Pachtzinse, wenn durch außerordentliche Zufälle die Nutzungen
des nur auf ein Jahr gepachteten Gutes um mehr als die Hälfte des
gewöhnlichen Ertrages gefallen sind. Der Verpächter ist so viel zu
erlassen schuldig, als durch diesen Abfall an dem Pachtzinse mangelt.
§
1106. Hat der Bestandnehmer unbestimmt alle Gefahren auf sich
genommen; so werden darunter nur die Feuer-, Wasserschäden und
Wetterschläge verstanden. Andere außerordentliche Unglücksfälle kommen
nicht auf seine Gefahr. Verbindet er sich aber ausdrücklich, auch alle
andere außerordentliche Unglücksfälle zu tragen; so wird deswegen noch
nicht vermutet, daß er auch für den zufälligen Untergang des ganzen
Pachtstückes haften wolle.
§
1107. Wird der Gebrauch oder Genuß des Bestandstückes nicht wegen
dessen Beschädigung oder sonst entstandener Unbrauchbarkeit, sondern aus
einem dem Bestandnehmer zugestoßenen Hindernisse oder Unglücksfalle
vereitelt, oder waren zur Zeit der Beschädigung die Früchte von dem Grunde
schon abgesondert, so fällt die widrige Ereignung dem Bestandnehmer allein
zur Last. Er muß den Zins doch entrichten. Der Bestandgeber muß sich aber
den ersparten Aufwand und die Vorteile, die er durch anderweitige
Verwertung des Bestandstückes erlangt, anrechnen.
§
1108. Behauptet der Pächter den Erlaß des ganzen Pachtzinses oder
eines Teiles davon entweder aus dem Vertrage oder aus dem Gesetze; so muß
er dem Verpächter ohne Zeitverlust den geschehenen Unglücksfall anzeigen,
und die Begebenheit, wenn sie nicht landkundig ist, gerichtlich, oder
wenigstens durch zwei sachkundige Männer erheben lassen; ohne diese
Vorsicht wird er nicht angehört.
4. Zurückstellung;
§
1109. Nach geendigtem Bestandvertrage muß der Bestandnehmer die
Sache dem etwa errichteten Inventarium gemäß oder doch in dem Zustand, in
welchem er sie übernommen hat, gepachtete Grundstücke aber mit Rücksicht
auf die Jahreszeit, in welcher die Pacht geendigt worden ist, in
gewöhnlicher wirtschaftlicher Kultur zurückstellen. Weder ein
Zurückbehaltungsrecht oder die Einwendung der Kompensation noch selbst des
früheren Eigentumsrechtes kann ihn vor der Zurückstellung schützen.
§
1110. Wenn bei dem Bestandvertrage kein Inventarium errichtet
worden ist; so tritt die nämliche Vermutung, wie bei der Fruchtnießung (§
518) ein.
§
1111. Wird das Miet- oder Pachtstück beschädigt, oder durch
Mißbrauch abgenützt; so haften Mieter und Pächter sowohl für ihr eigenes,
als des Afterbestandnehmers Verschulden, nicht aber für den Zufall. Doch
muß der Bestandgeber den Ersatz aus dieser Haftung längstens binnen einem
Jahre nach Zurückstellung des Bestandstückes gerichtlich fordern; sonst
ist das Recht erloschen.
5. Auflösung des
Bestandvertrages:
a) durch Untergang der Sache;
§
1112. Der Bestandvertrag löst sich von selbst auf, wenn die
bestandene Sache zu Grunde geht. Geschieht dies aus Verschulden des einen
Teiles, so gebührt dem andern Ersatz; geschieht es durch einen
Unglücksfall, so ist kein Teil dem andern dafür verantwortlich.
b) Verlauf der Zeit;
§
1113. Der Bestandvertrag erlischt auch durch den Verlauf der Zeit,
welcher ausdrücklich oder stillschweigend, entweder durch den nach einem
gewissen Zeitraume ausgemessenen Zins, wie bei sogenannten Tag-, Wochen-
und Monatszimmern, oder durch die erklärte, oder aus den Umständen
hervorleuchtende Absicht des Bestandnehmers bedungen worden ist.
Wenn keine Erneuerung
geschieht;
§
1114. Der Bestandvertrag kann aber nicht nur ausdrücklich; sondern
auch stillschweigend erneuert werden. Ist in dem Vertrage eine vorläufige
Aufkündigung bedungen worden; so wird der Vertrag durch die Unterlassung
der gehörigen Aufkündigung stillschweigend erneuert. Ist keine
Aufkündigung bedungen worden; so geschieht eine stillschweigende
Erneuerung, wenn der Bestandnehmer nach Verlauf der Bestandzeit fortfährt,
die Sache zu gebrauchen oder zu benützen, und der Bestandgeber es dabei
bewenden läßt.
§
1115. Die stillschweigende Erneuerung des Bestandvertrages
geschieht unter den nämlichen Bedingungen, unter welchen er vorher
geschlossen war. Doch erstreckt sie sich bei Pachtungen nur auf ein Jahr;
wenn aber der ordentliche Genuß erst in einem späteren Zeitraume erfolgen
kann, auf eine so lange Zeit, als notwendig ist, um die Nutzungen einmal
beziehen zu können. Mietungen, wofür man den Zins erst nach einem ganzen
oder halben Jahre zu bezahlen pflegt, werden auf ein halbes Jahr; alle
kürzere Mietungen aber auf diejenige Zeit stillschweigend erneuert, welche
vorher durch den Bestandvertrag bestimmt war. Von wiederholten
Erneuerungen gilt das Nämliche, was hier in Rücksicht der ersten
Erneuerung vorgeschrieben ist.
c) Aufkündigung;
§
1116. Insofern die Dauer eines Bestandvertrages weder
ausdrücklich, noch stillschweigend, noch durch besondere Vorschriften
bestimmt ist, muß derjenige, welcher den Vertrag aufheben will, dem andern
die Pachtung sechs Monate; die Mietung einer unbeweglichen Sache vierzehn
Tage; und einer beweglichen vierundzwanzig Stunden vorher aufkündigen, als
die Abtretung erfolgen soll.
§
1116a. Durch den Tod eines der vertragschließenden Teile wird der
Bestandvertrag nicht aufgehoben. Wohnungsmieten können jedoch, wenn der
Mieter stirbt, ohne Rücksicht auf die vereinbarte Dauer sowohl von den
Erben des Mieters wie von dem Vermieter unter Einhaltung der gesetzlichen
Kündigungsfrist gelöst werden.
§
1117. Der Bestandnehmer ist berechtigt, auch vor Verlauf der
bedungenen Zeit von dem Vertrag ohne Kündigung abzustehen, wenn das
Bestandstück in einem Zustand übergeben oder ohne seine Schuld in einen
Zustand geraten ist, der es zu dem bedungenen Gebrauch untauglich macht,
oder wenn ein beträchtlicher Teil durch Zufall auf eine längere Zeit
entzogen oder unbrauchbar wird. Aus dem Grunde der
Gesundheitsschädlichkeit gemieteter Wohnräume steht dieses Recht dem
Mieter auch dann zu, wenn er im Vertrage darauf verzichtet oder die
Beschaffenheit der Räume beim Vertragsabschluß gekannt hat.
§
1118. Der Bestandgeber kann seinerseits die frühere Aufhebung des
Vertrages fordern, wenn der Bestandnehmer der Sache einen erheblichen
nachteiligen Gebrauch davon macht; wenn er nach geschehener Einmahnung mit
der Bezahlung des Zinses dergestalt säumig ist, daß er mit Ablauf des
Termins den rückständigen Bestandzins nicht vollständig entrichtet hat;
oder, wenn ein vermietetes Gebäude neu aufgeführt werden muß. Eine
nützlichere Bauführung ist der Mieter zu seinem Nachteile zuzulassen nicht
schuldig, wohl aber notwendige Ausbesserungen.
§
1119. Wenn dem Vermieter die Notwendigkeit der neuen Bauführung
schon zur Zeit des geschlossenen Vertrages bekannt sein mußte; oder, wenn
die Notwendigkeit der durch längere Zeit fortzusetzenden Ausbesserungen
aus Vernachlässigung der kleinern Ausbesserungen entstanden ist; so muß
dem Mieter für den vermißten Gebrauch eine angemessene Entschädigung
geleistet werden.
d) Veräußerung der
Sache
§
1120. Hat der Eigentümer das Bestandstück an einen andern
veräußert, und ihm bereits übergeben; so muß der Bestandinhaber, wenn sein
Recht nicht in die öffentlichen Bücher eingetragen ist (§
1095), nach der gehörigen Aufkündigung dem neuen Besitzer weichen. Er
ist aber berechtigt, von dem Bestandgeber in Rücksicht auf den erlittenen
Schaden, und entgangenen Nutzen eine vollkommene Genugtuung zu fordern.
§
1121. Bei einer zwangsweisen gerichtlichen Veräußerung ist das
Bestandrecht, wenn es in die öffentlichen Bücher eingetragen ist, gleich
einer Dienstbarkeit zu behandeln. Hat der Ersteher das Bestandrecht nicht
zu übernehmen, so muß ihm der Bestandnehmer nach gehöriger Aufkündigung
weichen.
II.
Erbpacht
§
1122. Der Vertrag, wodurch jemandem das Nutzeigentum eines Gutes
erblich unter der Bedingung überlassen wird, daß er die jährlichen
Nutzungen mit einer jährlichen, im Verhältnisse zu dem Ertrage bestimmten
Abgabe im Gelde, in Früchten, oder auch in verhältnismäßigen Diensten
vergelten solle, heißt ein Erbpachtvertrag.
III.
Erbzinsvertrag
§
1123. Wird eine geringe Abgabe von dem Besitzer nur zur
Anerkennung des Grundeigentumes geleistet; so heißt der Grund ein
Erbzinsgut, und der darüber errichtete Vertrag ein Erbzinsvertrag.
§
1124. Im Zweifel, ob ein Nutzeigentum ein Erbpachtgut oder ein
Erbzinsgut sei, ist auf den Betrag des jährlichen Zinses, und andere
Schuldigkeiten Rücksicht zu nehmen. Steht dieser Betrag mit den jährlichen
reinen Nutzungen außer allem Verhältnisse; so ist das Nutzeigentum ein
Erbzinsgut; läßt sich aber wenigstens von alten Zeiten her und bei ganz
öde übernommenen Gründen ein Verhältnis denken; so ist es ein Erbpachtgut
(§ 359).
IV.
Bodenzins
§
1125. Ist ein Eigentum dergestalt geteilt, daß einem Teile die
Substanz des Grundes samt der Benützung der Unterfläche, dem andern Teile
aber nur die Benützung der Oberfläche erblich gehört; so heißt die
jährliche von diesem letztern Besitzer zu entrichtende Abgabe, Bodenzins.
Erwerbung des
nutzbaren Eigentumes
§
1126. Das geteilte Eigentum einer unbeweglichen Sache kann
ebensowenig, als das vollständige ohne Einverleibung in die öffentlichen
Bücher oder Register erworben werden. Ein gültiger Titel gründet nur ein
persönliches Recht gegen die verbundene Person, aber kein dingliches Recht
gegen einen Dritten (§
431).
Gemeinschaftliche
Rechte des Ober- und Nutzungseigentümers
§
1127. Die Rechte des Ober- und Nutzungseigentümers kommen
überhaupt darin überein, daß ein jeder mit seinem Teile insoweit verfügen
kann, als die Rechte des andern dadurch nicht verletzt werden (§
363).
§
1128. Einer wie der andere ist berechtigt, seinen Anteil
gerichtlich zu verfolgen, ihn zu verpfänden, und unter Lebenden oder durch
eine letzte Willenserklärung zu veräußern. Wer eine Einschränkung
behauptet, muß solche durch die gehörigen Urkunden, durch sogenannte
Gewährbriefe oder Handfesten beweisen.
Besondere Rechte und
Pflichten des Obereigentümers
§
1129. Der Obereigentümer ist insbesondere berechtigt, dem
Nutzungseigentümer nicht nur die Verringerung der Nutzungssache; sondern
auch alle Veränderungen zu untersagen, wodurch die Ausübung seiner Rechte
vereitelt, oder erschwert werden kann.
1. In Rücksicht der
Erhaltung, Bearbeitung und Veränderungen des Gutes;
§
1130. Er kann also verlangen, daß der Nutzungseigentümer für die
Erhaltung und Bestellung der Grundstücke Sorge trage. Vernachlässigt er,
ungeachtet der geschehenen Warnung, die Erfüllung dieser Pflichten; oder
ist er die auf dem Grunde haftenden Lasten zu tragen unfähig; so kann der
Obereigentümer auf die Überlassung des Gutes an andere Erbpacht- oder
Erbzins-Männer dringen.
2. des Erbzinses
§
1131. Das vorzüglichste Recht des Erbpacht- und Erbzinsherrn
besteht in der Beziehung des jährlichen Zinses und anderer bedungenen
Gebühren. Diese können unter keinem Vorwande erhöht, von den zum Grunde
nicht gehörigen Fahrnissen aber, so wie von andern beweglichen Sachen, gar
nicht bezogen werden.
Wann der Zins zu
entrichten
§
1132. Der jährliche Zins muß, wenn nichts verabredet oder durch
Provinzial-Gesetze bestimmt ist, in der ersten Hälfte des Monats November
abgeführt werden.
Wann eine Erlassung
stattfinde?
§
1133. In der Regel haftet ein unvollständiger Eigentümer dem
andern nicht für den Zufall: Allein, wenn ein Erbpächter durch
Überschwemmungen, Krieg oder Seuchen sein Pachtgut zu benützen verhindert
worden ist; so muß demselben für die Zeit der vermißten Benützung ein
angemessener Erlaß vom Zinse gestattet werden.
§
1134. Ein Erbzinsmann hat auf einen ähnlichen Erlaß keinen
Anspruch; er muß, solange ein Teil des Erbzinsgutes vorhanden ist, den
festgesetzten Erbzins voll entrichten.
Recht bei verzögerter
Entrichtung des Zinses
§
1135. Hat der Erbzinsmann den Zins in der bedungenen Zeit nicht
abgeführt; so kann der Erbzinsherr verlangen, daß die Nutzung in Beschlag
genommen, und er aus derselben schadlos gehalten werde.
§
1136. Ein Erbpachtherr hat in Ansehung des über ein Jahr
ausständigen Zinses die Wahl, entweder die Pfändung der Nutzungen, oder
die gerichtliche Versteigerung des Erbpachtgutes zur Berichtigung der
Rückstände zu verlangen.
3. In Rücksicht der
Lasten und Verbesserungen
§
1137. Der Obereigentümer ist verpflichtet, den Nutzungseigentümer
in Rücksicht des unmittelbar von ihm erhaltenen Nutzungseigentumes zu
vertreten, und wenn das Nutzungsrecht mit der Substanz wieder vereinigt
wird, ihm oder seinem Nachfolger die getroffenen Verbesserungen wie einem
andern redlichen Besitzer zu vergüten, und für die Richtigkeit der
öffentlichen Bücher und Register, die er über seine Zinsgüter führt, zu
haften.
§
1138. Für andere von dem Nutzungseigentümer aufgebürdete und den
öffentlichen Büchern nicht einverleibte Lasten haftet der Obereigentümer
nicht. Der Nutzungseigentümer kann überhaupt einem andern nicht mehr Recht
übertragen, als er selbst hat. Das Recht des einen erlischt also mit dem
Rechte des andern.
Rechte und
Verbindlichkeiten des Nutzungseigentümers überhaupt
§
1139. Die Rechte und Verbindlichkeiten des Nutzungseigentümers
stehen überhaupt mit den festgesetzten Verbindlichkeiten und Rechten des
Obereigentümers im Verhältnisse.
Insbesondere
1. in Rücksicht der
Veräußerung;
§
1140. Der Nutzungseigentümer bedarf zur Veräußerung die
Einwilligung des Obereigentümers nicht; doch muß er ihm den Nachfolger zur
Beurteilung, ob derselbe dem Gute vorzustehen, und die darauf haftenden
Lasten zu entrichten fähig sei, namhaft machen. Auf ein Vorkaufs- oder
Einstandsrecht hat der Obereigentümer keinen Anspruch.
§
1141. Hat sich aber der Obereigentümer diese Einwilligung und
Rechte ausdrücklich vorbehalten; so muß er sich binnen dreißig Tagen nach
der ihm gemachten ordentlichen Anzeige erklären. Nach dieser Frist wird
seine Einwilligung für erteilt gehalten. Ohne Ausübung des Vorkaufs- oder
Einstandsrechtes kann er die Einwilligung nur wegen offenbarer Gefahr der
Substanz und der damit verknüpften Rechte verweigern.
§
1142. Die Abgabe, welche der Obereigentümer zuweilen von einem
neuen Nutzungseigentümer zu fordern hat, heißt, wenn die Veränderung bei
Lebzeiten geschieht, Lehenware (Laudemium); geschieht sie aber von Todes
wegen, Sterbelehen. Beide werden auch Veränderungsgebühren genannt. Ob und
wie diese Rechte gegründet seien, entscheidet die Landesverfassung, die
öffentlichen Bücher und Urkunden, oder ein dreißigjähriger ruhiger Besitz.
2. in Rücksicht eines
Schatzes und der Verminderung der Substanz;
§
1143. Dem Nutzungseigentümer gebührt auch ein verhältnismäßiger
Teil von einem gefundenen Schatze (§
399). Er ist sogar befugt, die Substanz zu verringern, wenn er dem
Obereigentümer beweisen kann, daß die Benutzung des Grundes sonst nicht
stattfinde (§
1129).
3. der Lasten;
§
1144. Der Nutzungseigentümer trägt alle ordentliche und
außerordentliche dem Gute anklebende Lasten; er entrichtet die Steuern,
Zehenten und andere besonders vorgemerkten Abgaben. Für Lasten, die den
Zins betreffen, haftet der Obereigentümer.
4. des Gewährbriefes
§
1145. Jeder neue Nutzungseigentümer ist in der Regel verbunden,
sich von dem Obereigentümer einen Beglaubigungsschein oder eine Urkunde
des erneuerten Nutzungseigentumes zu verschaffen.
Besondere
Verhältnisse zwischen Gutsbesitzern und Untertanen
§
1146. Inwiefern die Nutzungseigentümer gegen die Obereigentümer
noch in anderen Verhältnissen stehen, und welche Rechte und
Verbindlichkeiten insbesondere zwischen den Gutsbesitzern und den
Gutsuntertanen bestehen, ist aus der Verfassung jeder Provinz, und den
politischen Vorschriften zu entnehmen.
Rechte aus dem
Bodenzinse
§
1147. Wer nichts als einen Bodenzins entrichtet, hat nur auf die
Benutzung der Oberfläche, als: Bäume, Pflanzen und Gebäude, und auf einen
Teil des auf derselben gefundenen Schatzes Anspruch. Vergrabene Schätze
und andere unterirdische Nutzungen gehören dem Obereigentümer allein zu.
Erlöschung des
Nutzungseigentumes
§
1148. Was von der Aufhebung des vollständigen Eigentumes bestimmt
worden ist (§
444), gilt überhaupt auch von dem geteilten.
§
1149. Erbpacht- und Erbzinsgüter gehen auf alle Erben über, die
nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden sind. Hat der Nutzungseigentümer
keinen rechtmäßigen Nachfolger; so wird das Nutzungseigentum mit dem
Obereigentume vereinigt. Doch muß der Obereigentümer, wenn er von diesem
Rechte Gebrauch machen will, alle Schulden des Nutzungseigentümers, die
aus einem andern Vermögen nicht getilgt werden können, berichtigen.
Inwiefern ein Obereigentümer das heimgefallene Gut an andere zu überlassen
verbunden sei, bestimmen die politischen Verordnungen.
§
1150. Durch Zerstörung der Pflanzen, Bäume und Gebäude geht das
Nutzungseigentum der Oberfläche nicht verloren. Solange noch ein Teil des
Grundes bleibt, kann ihn der Besitzer, wenn er anders seinen Zins abführt,
mit neuen Pflanzen, Bäumen und Gebäuden besetzen.
Sechsundzwanzigstes Hauptstück
Von Verträgen über Dienstleistungen
Dienst- und
Werkvertrag
§
1151.
(1) Wenn jemand
sich auf eine gewisse Zeit zur Dienstleistung für einen anderen
verpflichtet, so entsteht ein Dienstvertrag; wenn jemand die Herstellung
eines Werkes gegen Entgelt übernimmt, ein Werkvertrag.
(2) Insoweit damit
eine Geschäftsbesorgung (§
1002) verbunden ist, müssen auch die Vorschriften über den
Bevollmächtigungsvertrag beobachtet werden.
§
1152. Ist im Vertrage kein Entgelt bestimmt und auch nicht
Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt ein angemessenes Entgelt als
bedungen.
1. Dienstvertrag
§
1153. Wenn sich aus dem Dienstvertrage oder aus den Umständen
nichts anderes ergibt, hat der Dienstnehmer die Dienste in eigener Person
zu leisten und ist der Anspruch auf die Dienste nicht übertragbar. Soweit
über Art und Umfang der Dienste nichts vereinbart ist, sind die den
Umständen nach angemessenen Dienste zu leisten.
Anspruch auf das
Entgelt
§
1154.
(1) Wenn nichts
anderes vereinbart oder bei Diensten der betreffenden Art üblich ist, ist
das Entgelt nach Leistung der Dienste zu entrichten.
(2) Ist das Entgelt
nach Monaten oder kürzeren Zeiträumen bemessen, so ist es am Schlusse des
einzelnen Zeitraumes; ist es nach längeren Zeiträumen bemessen, am
Schlusse eines jeden Kalendermonats zu entrichten. Ein nach Stunden, nach
Stück oder Einzelleistungen bemessenes Entgelt ist für die schon
vollendeten Leistungen am Schlusse einer jeden Kalenderwoche, wenn es sich
jedoch um Dienste höherer Art handelt, am Schlusse eines jeden
Kalendermonats zu entrichten.
(3) In jedem Falle
wird das bereits verdiente Entgelt mit der Beendigung des
Dienstverhältnisses fällig.
§
1154a. Der nach Stück oder Einzelleistungen entlohnte Dienstnehmer
kann einen den geleisteten Diensten und seinen Auslagen entsprechenden
Vorschuß vor Fälligkeit des Entgelts verlangen.
§
1154b.
(1) Der
Dienstnehmer behält seinen Anspruch auf das Entgelt, wenn er nach Antritt
des Dienstes durch Krankheit oder Unglücksfall an der Dienstleistung
verhindert ist, ohne dies vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit
verschuldet zu haben, bis zur Dauer von sechs Wochen. Der Anspruch auf das
Entgelt erhöht sich auf die Dauer von acht Wochen, wenn das
Dienstverhältnis fünf Jahre, von zehn Wochen, wenn es 15 Jahre und von
zwölf Wochen, wenn es 25 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch jeweils
weitere vier Wochen behält der Dienstnehmer den Anspruch auf das halbe
Entgelt.
(2) Bei
wiederholter Dienstverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) innerhalb
eines Arbeitsjahres besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nur
insoweit, als die Dauer des Anspruchs gemäß
Abs. 1 noch nicht erschöpft ist.
(3) Wird ein
Dienstnehmer durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit im Sinne der
Vorschriften über die gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung
seiner Dienste verhindert, ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder
durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch
auf das Entgelt ohne Rücksicht auf andere Zeiten einer Dienstverhinderung
bis zur Dauer von acht Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt erhöht sich
auf die Dauer von zehn Wochen, wenn das Dienstverhältnis 15 Jahre
ununterbrochen gedauert hat. Bei wiederholten Dienstverhinderungen, die im
unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder einer
Berufskrankheit stehen, besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts
innerhalb eines Dienstjahres nur insoweit, als die Dauer des Anspruchs
nach dem ersten oder zweiten Satz noch nicht erschöpft ist. Ist ein
Dienstnehmer gleichzeitig bei mehreren Dienstgebern beschäftigt, so
entsteht ein Anspruch nach diesem Absatz nur gegenüber jenem Dienstgeber,
bei dem die Dienstverhinderung im Sinne dieses Absatzes eingetreten ist;
gegenüber den anderen Dienstgebern entstehen Ansprüche nach
Abs. 1.
(4) Kur- und
Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil- und Pflegeanstalten,
Rehabilitationszentren und Rekonvaleszentenheimen, die wegen eines
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit von einem Träger der
Sozialversicherung, dem Bundesministerium für soziale Sicherheit und
Generationen gemäß
§ 12
Abs. 4 Opferfürsorgegesetz, einem Bundesamt für Soziales und
Behindertenwesen oder einer Landesregierung auf Grund eines
Behindertengesetzes auf deren Rechnung bewilligt oder angeordnet werden,
sind einer Dienstverhinderung gemäß
Abs. 3 gleichzuhalten.
(5) Der
Dienstnehmer behält ferner den Anspruch auf das Entgelt, wenn er durch
andere wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden
während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Dienstleistung verhindert
wird.
(6) Durch
Kollektivvertrag können von
Abs. 5 abweichende Regelungen getroffen werden. Bestehende
Kollektivverträge gelten als abweichende Regelungen.
§
1155.
(1) Auch für
Dienstleistungen, die nicht zustande gekommen sind, gebührt dem
Dienstnehmer das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch
Umstände, die auf Seite des Dienstgebers liegen, daran verhindert worden
ist; er muß sich jedoch anrechnen, was er infolge Unterbleibens der
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung erworben oder zu
erwerben absichtlich versäumt hat.
(2) Wurde er
infolge solcher Umstände durch Zeitverlust bei der Dienstleistung
verkürzt, so gebührt ihm angemessene Entschädigung.
Erlöschen der
Ansprüche
§
1156. Die dem Dienstgeber nach
§
1154b obliegenden Verpflichtungen erlöschen, wenn das Dienstverhältnis
infolge Ablaufes der Zeit, für die es eingegangen wurde, oder infolge
einer früheren Kündigung oder einer Entlassung endet, die nicht durch die
Erkrankung oder sonstige die Person des Dienstnehmers betreffende wichtige
Gründe im Sinne des
§
1154b verursacht ist. Wird der Dienstnehmer wegen der Verhinderung
entlassen oder wird ihm während der Verhinderung gekündigt, so bleibt die
dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienstverhältnisses in Ansehung der
bezeichneten Ansprüche außer Betracht.
§
1156a. aufgehoben
Fürsorgepflicht des
Dienstgebers
§
1157.
(1) Der Dienstgeber
hat die Dienstleistungen so zu regeln und bezüglich der von ihm
beizustellenden oder beigestellten Räume und Gerätschaften auf seine
Kosten dafür zu sorgen, daß Leben und Gesundheit des Dienstnehmers, soweit
es nach der Natur der Dienstleistung möglich ist, geschützt werden.
(2) Ist der
Dienstnehmer in die Hausgemeinschaft des Dienstgebers aufgenommen, so hat
dieser in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes, der Verpflegung sowie der
Arbeits- und Erholungszeit die mit Rücksicht auf Gesundheit, Sittlichkeit
und Religion des Dienstnehmers erforderlichen Anordnungen zu treffen.
Endigung des
Dienstverhältnisses
§
1158.
(1) Das
Dienstverhältnis endet mit dem Ablaufe der Zeit, für die es eingegangen
wurde.
(2) Ein auf Probe
oder nur für die Zeit eines vorübergehenden Bedarfes vereinbartes
Dienstverhältnis kann während des ersten Monates von beiden Teilen
jederzeit gelöst werden.
(3) Ein für die
Lebenszeit einer Person oder für länger als fünf Jahre vereinbartes
Dienstverhältnis kann von dem Dienstnehmer nach Ablauf von fünf Jahren
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gelöst werden.
(4) Ist das
Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung eingegangen oder fortgesetzt worden,
so kann es durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen gelöst werden.
Kündigungsfristen
§
1159. Die Kündigung ist zulässig: wenn bei einem
Dienstverhältnisse, das keine Dienste höherer Art zum Gegenstande hat, das
Entgelt nach Stunden oder Tagen, nach Stück oder Einzelleistungen bemessen
ist, jederzeit für den folgenden Tag; wenn ein solches Dienstverhältnis
die Erwerbstätigkeit des Dienstnehmers hauptsächlich in Anspruch nimmt und
schon drei Monate gedauert hat oder wenn das Entgelt nach Wochen bemessen
ist, spätestens am ersten Werktage für den Schluß der Kalenderwoche. Die
Wirkung der Kündigung tritt im Falle der Entlohnung nach Stück oder
Einzelleistungen keinesfalls vor Vollendung der zur Zeit der Kündigung in
Ausführung begriffenen Leistungen ein.
§
1159a.
(1) Wenn ein
Dienstverhältnis, das Dienste höherer Art zum Gegenstande hat, die
Erwerbstätigkeit des Dienstnehmers hauptsächlich in Anspruch nimmt und
schon drei Monate gedauert hat, so ist ohne Rücksicht auf die Art der
Bemessung des Entgelts eine mindestens vierwöchentliche Kündigungsfrist
einzuhalten.
(2) Dasselbe gilt
überhaupt, wenn das Entgelt nach Jahren bemessen ist.
§
1159b. In allen anderen Fällen kann das Dienstverhältnis unter
Einhaltung einer mindestens vierzehntägigen Kündigungsfrist gelöst werden.
§
1159c. Die Kündigungsfrist muß immer für beide Teile gleich sein.
Wurden ungleiche Fristen vereinbart, so gilt für beide Teile die längere
Frist.
Freizeit während der
Kündigungsfrist
§
1160.
(1) Bei Kündigung
durch den Dienstgeber ist dem Dienstnehmer während der Kündigungsfrist auf
sein Verlangen wöchentlich mindestens ein Fünftel der regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit ohne Schmälerung des Entgelts freizugeben.
(2) Ansprüche nach
Abs. 1 bestehen nicht, wenn der Dienstnehmer einen Anspruch auf eine
Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung hat, sofern eine
Bescheinigung über die vorläufige Krankenversicherung vom
Pensionsversicherungsträger ausgestellt wurde.
(3)
Abs. 2 gilt nicht bei Kündigung wegen Inanspruchnahme einer
Gleitpension gemäß
§ 253c
ASVG.
(4) Durch
Kollektivvertrag können abweichende Regelungen getroffen werden.
Konkurs
§
1161. Welche Wirkungen die Eröffnung des Konkurses über das
Vermögen des Dienstgebers auf das Dienstverhältnis hat, bestimmt die
Konkursordnung.
Vorzeitige Auflösung
§
1162. Das Dienstverhältnis kann, wenn es für bestimmte Zeit
eingegangen wurde, vor Ablauf dieser Zeit, sonst aber ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist von jedem Teile aus wichtigen Gründen gelöst werden.
§
1162a. Wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig
austritt, kann der Dienstgeber entweder dessen Wiedereintritt zur
Dienstleistung nebst Schadenersatz oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung
des Vertrages verlangen. Wird der Dienstnehmer wegen eines Verschuldens
vorzeitig entlassen, so hat er Schadenersatz wegen Nichterfüllung des
Vertrages zu leisten. Für die schon bewirkten Leistungen, deren Entgelt
noch nicht fällig ist, steht dem Dienstnehmer ein Anspruch auf den
entsprechenden Teil des Entgelts nur insoweit zu, als sie nicht durch die
vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses für den Dienstgeber ihren
Wert ganz oder zum größten Teil eingebüßt haben.
§
1162b. Wenn der Dienstgeber den Dienstnehmer ohne wichtigen Grund
vorzeitig entläßt oder wenn ihn ein Verschulden an dem vorzeitigen
Austritte des Dienstnehmers trifft, behält dieser, unbeschadet
weitergehenden Schadenersatzes, seine vertragsgemäßen Ansprüche auf das
Entgelt für den Zeitraum, der bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses
durch Ablauf der Vertragszeit oder durch ordnungsmäßige Kündigung hätte
verstreichen müssen, unter Anrechnung dessen, was er infolge des
Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige
Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. Soweit
jedoch der oben genannte Zeitraum drei Monate nicht übersteigt, kann der
Dienstnehmer das ganze für diese Zeit gebührende Entgelt ohne Abzug sofort
fordern.
§
1162c. Trifft beide Teile ein Verschulden an der vorzeitigen
Lösung des Dienstverhältnisses, so hat der Richter nach freiem Ermessen zu
entscheiden, ob und in welcher Höhe ein Ersatz gebührt.
§
1162d. Ansprüche wegen vorzeitigen Austrittes oder vorzeitiger
Entlassung im Sinne der
§§
1162a und
1162b
müssen bei sonstigem Ausschlusse binnen sechs Monaten nach Ablauf des
Tages, an dem sie erhoben werden konnten, gerichtlich geltend gemacht
werden.
Zeugnis
§
1163.
(1) Bei Beendigung
des Dienstverhältnisses ist dem Dienstnehmer auf sein Verlangen ein
schriftliches Zeugnis über die Dauer und Art der Dienstleistung
auszustellen. Verlangt der Dienstnehmer während der Dauer des
Dienstverhältnisses ein Zeugnis, so ist ihm ein solches auf seine Kosten
auszustellen. Eintragungen und Anmerkungen im Zeugnisse, durch die dem
Dienstnehmer die Erlangung einer neuen Stellung erschwert wird, sind
unzulässig.
(2) Zeugnisse des
Dienstnehmers, die sich in Verwahrung des Dienstgebers befinden, sind dem
Dienstnehmer auf Verlangen jederzeit auszufolgen.
Zwingende
Vorschriften
§
1164.
(1) Die
Berechtigungen des Dienstnehmers, die sich aus den Bestimmungen der
§§ 1154 Abs. 3,
1154b Abs. 1 bis 4,
1156
bis 1159b,
1160
und
1162a bis 1163 ergeben, können durch den Dienstvertrag oder durch
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung nicht aufgehoben oder beschränkt
werden.
(2) Die
§§
1154b,
1156
und 1164 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 44/2000 sind auf Dienstverhinderungen anzuwenden, die in nach dem 31.
Dezember 2000 begonnenen Arbeitsjahren eingetreten sind.
(3) Die verlängerte
Anspruchsdauer nach
§ 1154b Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000
bewirkt keine Verlängerung einer in Normen der kollektiven
Rechtsgestaltung oder Dienstverträgen vorgesehenen längeren
Anspruchsdauer. Sehen Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder
Dienstverträge einen zusätzlichen Anspruch im Anschluss an den Anspruch
nach
§ 1154b Abs. 1 vor, wird die Gesamtdauer der Ansprüche nicht
verlängert.
(4) Im Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 für die
Dienstnehmer günstigere Regelungen in Dienstverträgen oder in Normen der
kollektiven Rechtsgestaltung werden durch die Neuregelung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 nicht berührt.
2. Werkvertrag
§
1165. Der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk persönlich
auszuführen oder unter seiner persönlichen Verantwortung ausführen zu
lassen.
§
1166. Hat derjenige, der die Verfertigung einer Sache übernommen
hat, den Stoff dazu zu liefern, so ist der Vertrag im Zweifel als
Kaufvertrag; liefert aber der Besteller den Stoff, im Zweifel als
Werkvertrag zu betrachten.
Gewährleistung
§
1167. 142)
Bei Mängeln des Werkes kommen die für entgeltliche Verträge überhaupt
geltenden Bestimmungen (§§
922 bis 933b) zur Anwendung.
Vereitlung der
Ausführung
§
1168.
(1) Unterbleibt die
Ausführung des Werkes, so gebührt dem Unternehmer gleichwohl das
vereinbarte Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände,
die auf Seite des Bestellers liegen, daran verhindert worden ist; er muß
sich jedoch anrechnen, was er infolge Unterbleibens der Arbeit erspart
oder durch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich
versäumt hat. Wurde er infolge solcher Umstände durch Zeitverlust bei der
Ausführung des Werkes verkürzt, so gebührt ihm angemessene Entschädigung.
(2) Unterbleibt
eine zur Ausführung des Werkes erforderliche Mitwirkung des Bestellers, so
ist der Unternehmer auch berechtigt, ihm zur Nachholung eine angemessene
Frist zu setzen mit der Erklärung, daß nach fruchtlosem Verstreichen der
Frist der Vertrag als aufgehoben gelte.
§
1168a. Geht das Werk vor seiner Übernahme durch einen bloßen
Zufall zugrunde, so kann der Unternehmer kein Entgelt verlangen. Der
Verlust des Stoffes trifft denjenigen Teil, der ihn beigestellt hat.
Mißlingt aber das Werk infolge offenbarer Untauglichkeit des vom Besteller
gegebenen Stoffes oder offenbar unrichtiger Anweisungen des Bestellers, so
ist der Unternehmer für den Schaden verantwortlich, wenn er den Besteller
nicht gewarnt hat.
Fürsorgepflicht
§
1169. Die Bestimmungen des
§ 1157,
mit Ausnahme der die Regelung der Dienstleistungen und die Arbeits- und
Erholungszeit betreffenden, finden auf den Werkvertrag sinngemäße
Anwendung.
Entrichtung des
Entgelts
§
1170. In der Regel ist das Entgelt nach vollendetem Werk zu
entrichten. Wird aber das Werk in gewissen Abteilungen verrichtet oder
sind Auslagen damit verbunden, die der Unternehmer nicht auf sich genommen
hat, so ist dieser befugt, einen verhältnismäßigen Teil des Entgelts und
den Ersatz der gemachten Auslagen schon vorher zu fordern.
§
1170a.
(1) Ist dem
Vertrage ein Kostenvoranschlag unter ausdrücklicher Gewährleistung für
seine Richtigkeit zugrunde gelegt, so kann der Unternehmer auch bei
unvorhergesehener Größe oder Kostspieligkeit der veranschlagten Arbeiten
keine Erhöhung des Entgelts fordern.
(2) Ist ein
Voranschlag ohne Gewährleistung zugrunde gelegt und erweist sich eine
beträchtliche Überschreitung als unvermeidlich, so kann der Besteller
unter angemessener Vergütung der vom Unternehmer geleisteten Arbeit vom
Vertrage zurücktreten. Sobald sich eine solche Überschreitung als
unvermeidlich herausstellt, hat der Unternehmer dies dem Besteller
unverzüglich anzuzeigen, widrigenfalls er jeden Anspruch wegen der
Mehrarbeiten verliert.
Erlöschen durch Tod
§
1171. Ein Werkvertrag über Arbeiten, bei denen es auf die
besonderen persönlichen Eigenschaften des Unternehmers ankommt, erlischt
durch dessen Tod und seine Erben können nur den Preis für den zubereiteten
brauchbaren Stoff und einen dem Werte der geleisteten Arbeit angemessenen
Teil des Entgelts fordern. Stirbt der Besteller, so bleiben die Erben an
den Vertrag gebunden.
3. Verlagsvertrag
§
1172. Durch den Verlagsvertrag verpflichtet sich der Urheber eines
Werkes der Literatur, der Tonkunst oder der bildenden Künste oder sein
Rechtsnachfolger, das Werk einem anderen zur Vervielfältigung und
Verbreitung für eigene Rechnung zu überlassen, dieser (der Verleger)
dagegen, das Werk zu vervielfältigen und die Vervielfältigungsstücke zu
verbreiten.
§
1173. Wurde über die Anzahl der Auflagen nichts bestimmt, so ist
der Verleger nur zu einer Auflage berechtigt. Vor dem Absatze der Auflage
darf der Urheber über das Werk nur dann anderweitig verfügen, wenn er dem
Verleger eine angemessene Schadloshaltung leistet.
4. Leistung zu
unerlaubtem Zweck
§
1174.
(1) Was jemand
wissentlich zur Bewirkung einer unmöglichen oder unerlaubten Handlung
gegeben hat, kann er nicht wieder zurückfordern. Inwiefern es der Fiskus
einzuziehen berechtigt sei, bestimmen die politischen Verordnungen. Ist
aber etwas zur Verhinderung einer unerlaubten Handlung demjenigen, der
diese Handlung begehen wollte, gegeben worden, so findet die
Zurückforderung statt.
(2) Ein zum Zweck
eines verbotenen Spieles gegebenes Darlehen kann nicht zurückgefordert
werden.
Siebenundzwanzigstes Hauptstück
Von dem Vertrage über eine Gemeinschaft der Güter
Entstehung einer
Erwerbsgesellschaft. Begriff
§
1175. Durch einen Vertrag, vermöge dessen zwei oder mehrere
Personen einwilligen, ihre Mühe allein, oder auch ihre Sachen zum
gemeinschaftlichen Nutzen zu vereinigen, wird eine Gesellschaft zu einem
gemeinschaftlichen Erwerbe errichtet.
Einteilung
§
1176. Je nachdem die Mitglieder einer Gesellschaft nur einzelne
Sachen, oder Summen; oder eine ganze Gattung von Sachen, z. B. alle Waren,
alle Früchte, alle liegende Gründe, oder endlich ihr ganzes Vermögen ohne
Ausnahme der Gemeinschaft widmen, sind auch die Arten der Gesellschaft
verschieden, und die Gesellschaftsrechte mehr oder weniger ausgedehnt.
§
1177. Wenn ein Gesellschaftsvertrag auf das ganze Vermögen lautet;
so wird doch nur das gegenwärtige darunter verstanden. Wird aber auch das
künftige Vermögen mit begriffen; so versteht man darunter nur das
erworbene, nicht das ererbte; außer es wäre beides ausdrücklich bedungen
worden.
Form der Errichtung
§
1178. Gesellschaftsverträge, welche sich nur auf das gegenwärtige,
oder nur auf das zukünftige Vermögen beziehen, sind ungültig, wenn das von
dem einen und dem andern Teile eingebrachte Gut nicht ordentlich
beschrieben, und verzeichnet worden ist.
§
1179. Wie der gesellschaftliche Vertrag unter Handelsleuten zu
errichten, in die gehörigen Register einzutragen und öffentlich bekannt zu
machen sei, bestimmen die besonderen Handels- und politischen Gesetze.
[Werden nur einzelne Geschäfte gemeinschaftlich betrieben; so ist genug,
wenn der darüber errichtete Vertrag in den Handlungsbüchern erscheint.]
§
1180. Der Vertrag über eine Gemeinschaft des ganzen sowohl
gegenwärtigen als künftigen Vermögens, welcher gewöhnlich nur zwischen
Ehegatten errichtet zu werden pflegt, ist nach den in dem
Hauptstücke von
den Ehepakten hierüber erteilten Vorschriften zu beurteilen. Die
gegenwärtigen Vorschriften beziehen sich auf die übrigen Arten der durch
Vertrag errichteten Gütergemeinschaft.
Wirkung des Vertrages
und des wirklichen Beitrages
§
1181. Der Gesellschaftsvertrag gehört zwar unter die Titel, ein
Eigentum zu erwerben; die Erwerbung selbst aber, und die Gemeinschaft der
Güter oder Sachen kommt nur durch die Übergabe derselben zustande.
Hauptstamm
§
1182. Alles, was ausdrücklich zum Betriebe des gemeinschaftlichen
Geschäftes bestimmt worden ist, macht das Kapital, oder den Hauptstamm der
Gesellschaft aus. Das Übrige, was jedes Mitglied besitzt, wird als ein
abgesondertes Gut betrachtet.
§
1183. Wenn Geld, verbrauchbare, oder zwar unverbrauchbare, jedoch
in Geldwert angeschlagene Sachen eingelegt werden; so ist nicht nur der
daraus verschaffte Nutzen, sondern auch der Hauptstamm in Rücksicht der
Mitglieder, welche hierzu beigetragen haben, als ein gemeinschaftliches
Eigentum anzusehen. Wer nur seine Mühe zum gemeinschaftlichen Nutzen zu
verwenden verspricht, hat zwar auf den Gewinn, nicht aber auf den
Hauptstamm einen Anspruch (§
1192).
Rechte und Pflichten
der Mitglieder. Beitrag zum Hauptstamme (Fonds)
§
1184. Jedes Mitglied ist außer dem Falle einer besondern
Verabredung, verbunden, einen gleichen Anteil zum gemeinschaftlichen
Hauptstamme beizutragen.
Mitwirkung
§
1185. In der Regel sind alle Mitglieder verbunden, ohne Rücksicht
auf ihren größern oder geringern Anteil, zu dem gemeinschaftlichen Nutzen
gleich mitzuwirken.
§
1186. Kein Mitglied ist befugt, die Mitwirkung einem Dritten
anzuvertrauen; oder jemanden in die Gesellschaft aufzunehmen; oder ein der
Gesellschaft schädliches Nebengeschäft zu unternehmen.
§
1187. Die Pflichten der Mitglieder werden durch den Vertrag
genauer bestimmt. Wer sich bloß zur Arbeit verbunden hat, der ist keinen
Beitrag schuldig. Wer lediglich einen Geld- oder andern Beitrag verheißen
hat, der hat weder die Verbindlichkeit, noch das Recht, auf eine andere
Art zu dem gemeinschaftlichen Erwerbe mitzuwirken.
§
1188. Bei der Beratschlagung und Entscheidung über die
gesellschaftlichen Angelegenheiten sind, wenn keine andere Verabredung
besteht, die in dem
Hauptstücke von
der Gemeinschaft des Eigentumes gegebenen Vorschriften anzuwenden (§§
833 – 842).
Nachschuß zum
Hauptstamme
§
1189. Die Mitglieder können zu einem mehreren Beitrage, als wozu
sie sich verpflichtet haben, nicht gezwungen werden. Fände jedoch bei
veränderten Umständen ohne Vermehrung des Beitrages die Erreichung des
gesellschaftlichen Zweckes gar nicht statt; so kann das sich weigernde
Mitglied austreten, oder zum Austritte verhalten werden.
Betrieb der
anvertrauten Geschäfte
§
1190. Wird einem oder einigen Mitgliedern der Betrieb der
Geschäfte anvertraut; so sind sie als Bevollmächtigte zu betrachten. Auf
ihre Beratschlagungen und Entscheidungen über gesellschaftliche
Angelegenheiten sind ebenfalls die oben (§§
833 – 842) erwähnten Vorschriften anzuwenden.
Haftung für den
Schaden
§
1191. Jedes Mitglied haftet für den Schaden, den es der
Gesellschaft durch sein Verschulden zugefügt hat. Dieser Schaden läßt sich
mit dem Nutzen, den es der Gesellschaft sonst verschaffte, nicht
ausgleichen. Hat aber ein Mitglied durch ein eigenmächtig unternommenes
neues Geschäft der Gesellschaft von einer Seite Schaden, und von der
andern Nutzen verursacht; so soll eine verhältnismäßige Ausgleichung
stattfinden.
Verteilung des
Gewinnes
§
1192. Das Vermögen, welches nach Abzug aller Kosten und erlittenen
Nachteile über den Hauptstamm zurückbleibt, ist der Gewinn. Der Hauptstamm
selbst bleibt ein Eigentum derjenigen, welche dazu beigetragen haben;
außer es wäre der Wert der Arbeiten zum Kapitale geschlagen und alles als
ein gemeinschaftliches Gut erklärt worden.
§
1193. Der Gewinn wird nach Verhältnis der Kapitalsbeiträge
verteilt, und die von allen Mitgliedern geleisteten Arbeiten heben sich
gegeneinander auf. Wenn ein oder einige Mitglieder bloß arbeiten, oder
nebst dem Kapitalsbeitrage zugleich Arbeiten leisten; so wird für die
Bemühungen, wenn keine Verabredung besteht, und die Gesellschafter sich
nicht vereinigen können, der Betrag mit Rücksicht auf die Wichtigkeit des
Geschäftes, die angewendete Mühe und den verschafften Nutzen vom Gerichte
bestimmt.
§
1194. Besteht der Gewinn nicht in barem Gelde, sondern in andern
Arten der Nutzungen; so geschieht die Teilung nach der in dem
Hauptstücke von
der Gemeinschaft des Eigentums enthaltenen Vorschrift (§§
840 – 843).
§
1195. Die Gesellschaft kann einem Mitgliede, seiner vorzüglichen
Eigenschaft oder Bemühungen wegen, einen größern Gewinn bewilligen, als
ihm nach seinem Anteile zukäme; nur dürfen dergleichen Ausnahmen nicht in
gesetzwidrige Verabredungen oder Verkürzungen ausarten.
§
1196. aufgehoben
Verteilung des
Verlustes
§
1197. Hat die Gesellschaft ihre Einlage ganz oder zum Teile
verloren; so wird der Verlust in dem Verhältnisse verteilt, wie im
entgegengesetzten Falle der Gewinn verteilt worden wäre. Wer kein Kapital
gegeben hat, büßt seine Bemühungen ein.
Rechnungslegung
§
1198. Die Mitglieder, denen die Verwaltung anvertraut ist, sind
verbunden, über den gemeinschaftlichen Hauptstamm und über die dahin
gehörigen Einnahmen und Ausgaben ordentlich Rechnung zu führen und
abzulegen.
§
1199. Die Schlußrechnung und Teilung des Gewinnes oder Verlustes
kann vor Vollendung des Geschäftes nicht gefordert werden. Wenn aber
Geschäfte betrieben werden, die durch mehrere Jahre fortdauern und einen
jährlichen Nutzen abwerfen sollen; so können die Mitglieder, wenn anders
das Hauptgeschäft nicht darunter leidet, jährlich sowohl die Rechnung, als
die Verteilung des Gewinnes verlangen. Übrigens kann jedes Mitglied zu
jeder Zeit auf seine Kosten die Rechnungen einsehen.
§
1200. Wer sich mit der bloßen Vorlegung des Abschlusses (Bilanz)
begnügt, oder auch seinem Rechte, Rechnung zu fordern, entsagt hat, kann,
wenn er einen Betrug auch nur in einem Teile der Verwaltung beweist,
sowohl für den vergangenen Fall, als für alle künftige Fälle auf eine
vollständige Rechnung dringen.
Verhältnis gegen
Nichtmitglieder
§
1201. Ohne die ausdrückliche oder stillschweigende rechtliche
Einwilligung der Mitglieder oder ihrer Bevollmächtigten kann die
Gesellschaft einem Dritten nicht verbindlich gemacht werden. [Bei
Handelsleuten begreift das kundgemachte, einem oder mehreren Mitgliedern
erteilte Recht, die Firma zu führen, nämlich alle Urkunden und Schriften
im Namen der Gesellschaft zu unterschreiben, schon eine allseitige
Vollmacht in sich (§
1028)].
§
1202. Ein Mitglied, welches nur mit einem Teile seines Vermögens
in der Gesellschaft steht, kann ein von dem gemeinschaftlichen
abgesondertes Vermögen besitzen, worüber es nach Belieben zu verfügen
berechtigt ist. Rechte und Verbindlichkeiten, die ein Dritter gegen die
Gesellschaft hat, müssen also von den Rechten und Verbindlichkeiten gegen
einzelne Mitglieder unterschieden werden.
§
1203. Was also jemand an ein einzelnes Mitglied, und nicht an die
Gesellschaft zu fordern oder zu zahlen hat, kann er auch nur an das
einzelne Mitglied, und nicht an die Gesellschaft fordern oder bezahlen.
Ebenso hat aber bei gesellschaftlichen Forderungen oder Schulden jedes
Mitglied nur für seinen Anteil ein Recht oder eine Verbindlichkeit zur
Zahlung, außer in dem Falle, welcher bei Handelsleuten vermutet wird, daß
alle für einen und einer für alle etwas zugesagt oder angenommen haben.
§
1204. aufgehoben
Auflösung der
Gesellschaft, und Austritt aus derselben
§
1205. Die Gesellschaft löst sich von selbst auf, wenn das
unternommene Geschäft vollendet; oder nicht mehr fortzuführen; wenn der
ganze gemeinschaftliche Hauptstamm zu Grunde gegangen; oder wenn die zur
Dauer der Gesellschaft festgesetzte Zeit verflossen ist.
§
1206. Die gesellschaftlichen Rechte und Verbindlichkeiten gehen in
der Regel nicht auf die Erben eines Mitgliedes über. Doch sind diese, wenn
mit ihnen die Gesellschaft nicht fortgesetzt wird, berechtigt, die
Rechnungen bis auf den Tod des Erblassers zu fordern und berichtigen zu
lassen. Sie sind aber im entgegengesetzten Falle auch verbunden,
Rechnungen zu legen, und zu berichtigen.
§
1207. Besteht die Gesellschaft nur aus zwei Personen; so erlischt
sie durch das Absterben der einen. Besteht sie aus mehreren; so wird von
den übrigen Mitgliedern vermutet, daß sie die Gesellschaft noch unter sich
fortsetzen wollen. Diese Vermutung gilt auch überhaupt von den Erben der
Handelsleute.
§
1208. Lautet der von Personen, die keine Handelsleute sind,
errichtete Gesellschaftsvertrag ausdrücklich auch auf ihre Erben; so sind
diese, wenn sie die Erbschaft antreten, verpflichtet, sich nach dem Willen
des Erblassers zu fügen; allein auf die Erbeserben erstreckt sich dieser
Wille nicht; noch weniger vermag er eine immerwährende Gesellschaft zu
begründen (§
832).
§
1209. Wenn der Erbe die von dem Verstorbenen für die Gesellschaft
übernommenen Dienste zu erfüllen nicht imstande ist; so muß er sich einem
verhältnismäßigen Abzuge an dem ausgemessenen Anteile unterziehen.
§
1210. Wenn ein Mitglied die wesentlichen Bedingungen des Vertrages
nicht erfüllt; wenn es in Konkurs verfällt; wenn es durch eine oder
mehrere gerichtlich strafbare Handlungen, die nur vorsätzlich begangen
werden können und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind,
das Vertrauen verliert; so kann es vor Verlauf der Zeit von der
Gesellschaft ausgeschlossen werden.
§
1211. Man kann den Gesellschaftsvertrag vor Verlauf der Zeit
aufkündigen, wenn dasjenige Mitglied, von welchem der Betrieb des
Geschäftes vorzüglich abhing, gestorben oder ausgetreten ist.
§
1212. Wenn die Zeit zur Dauer der Gesellschaft weder ausdrücklich
bestimmt worden ist noch aus der Natur des Geschäftes bestimmt werden
kann; so mag jedes Mitglied den Vertrag nach Willkür aufkündigen; nur darf
es nicht mit Arglist oder zur Unzeit geschehen (§
830).
§
1213. Die Wirkungen einer zwar bestrittenen, aber in der Folge für
rechtmäßig erklärten Ausschließung oder Aufkündung werden auf den Tag, wo
sie geschehen sind, zurückgezogen.
§
1214. aufgehoben
Teilung des
gesellschaftlichen Vermögens
§
1215. Bei der nach Auflösung einer Gesellschaft vorzunehmenden
Teilung des gesellschaftlichen Vermögens sind nebst den obigen
Bestimmungen die nämlichen Vorschriften zu beobachten, welche in dem
Hauptstücke von
der Gemeinschaft des Eigentumes über die Teilung einer
gemeinschaftlichen Sache überhaupt aufgestellt worden sind.
§
1216. Die in diesem Hauptstück enthaltenen Anordnungen sind auch
auf die Handlungsgesellschaften anzuwenden; insofern hierüber nicht
besondere Vorschriften bestehen.
Achtundzwanzigstes Hauptstück
Von den Ehepakten
Ehepakte
§
1217. Ehepakte heißen diejenigen Verträge, welche in Absicht auf
die eheliche Verbindung über das Vermögen geschlossen werden, und haben
vorzüglich das Heiratsgut; die Widerlage; Morgengabe; die
Gütergemeinschaft; Verwaltung und Fruchtnießung des eigenen Vermögens; die
Erbfolge, oder die auf den Todesfall bestimmte lebenslange Fruchtnießung
des Vermögens, und den Witwengehalt zum Gegenstande.
1. Heiratsgut
§
1218. Unter Heiratsgut versteht man dasjenige Vermögen, welches
von der Ehegattin, oder für sie von einem Dritten dem Manne zur
Erleichterung des mit der ehelichen Gesellschaft verbundenen Aufwandes
übergeben oder zugesichert wird.
Dessen Bestellung
§
1219. Wenn die Braut eigenes Vermögen besitzt, und volljährig ist;
so hängt es von ihr und dem Bräutigame ab, wie sie sich wegen des
Heiratsgutes, und wegen anderer wechselseitigen Gaben miteinander
verstehen wollen. Ist aber die Braut noch minderjährig, so muß der Vertrag
von ihrem gesetzlichen Vertreter geschlossen werden.
§
1220. Besitzt die Braut kein eigenes, zu einem angemessenen
Heiratsgut hinlängliches Vermögen, so sind Eltern oder Großeltern nach der
Reihenfolge und nach den Grundsätzen, nach denen sie für den Unterhalt der
Kinder zu sorgen haben, verpflichtet, den Töchtern oder Enkelinnen bei
ihrer Verehelichung ein Heiratsgut zu geben oder dazu verhältnismäßig
beizutragen.
§
1221. Berufen sich Eltern oder Großeltern auf ihr Unvermögen zur
Bestellung eines anständigen Heiratsgutes; so soll auf Ansuchen der
Brautpersonen das Gericht die Umstände, jedoch ohne strenge Erforschung
des Vermögensstandes, untersuchen, und hiernach ein angemessenes
Heiratsgut bestimmen, oder die Eltern und Großeltern davon freisprechen.
§
1222. Wenn eine Tochter ohne Wissen, oder gegen den Willen ihrer
Eltern sich verehelicht hat, und das Gericht die Ursache der Mißbilligung
gegründet findet; so sind die Eltern selbst in dem Falle, daß sie in der
Folge die Ehe genehmigen, nicht schuldig, ihr ein Heiratsgut zu geben.
§
1223. Hat eine Tochter ihr Heiratsgut schon erhalten, und es,
obschon ohne ihr Verschulden, verloren; so ist sie nicht mehr, selbst
nicht in dem Falle einer zweiten Ehe, berechtigt, ein neues zu fordern.
§
1224. Im Zweifel, ob das Heiratsgut von dem Vermögen der Eltern
oder der Braut ausgesetzt worden sei, wird das letztere angenommen. Haben
aber Eltern das Heiratsgut ihrer minderjährigen Tochter ohne
[ober]vormundschaftliche Genehmigung bereits ausgezahlt; so wird vermutet,
daß es die Eltern aus eigenem Vermögen getan haben.
Übergabe,
§
1225. Hat sich der Ehemann vor geschlossener Ehe kein Heiratsgut
bedungen; so ist er auch keines zu fordern berechtigt. Die Übergabe des
bedungenen Heiratsgutes kann, wenn keine andere Zeit festgesetzt worden
ist, gleich nach geschlossener Ehe begehrt werden.
und Beweis derselben
§
1226. Wenn über das Vermögen des Ehemannes ein Konkurs verhängt
wird; so macht seine vor Ausbruch des Konkurses geschehene schriftliche
oder mündliche Bestätigung, daß er das Heiratsgut empfangen habe, gegen
jedermann einen Beweis. Erfolgt aber die Bestätigung erst nach
ausgebrochenem Konkurse; so hat sie gegen die Gläubiger keine Beweiskraft.
Gegenstand des
Heiratsgutes und Rechte des Ehemannes und der Ehefrau in Rücksicht
desselben
§
1227. Alles, was sich veräußern und nutzen läßt, ist zum
Heiratsgute geeignet. Solange die eheliche Gesellschaft fortgesetzt wird,
gehört die Fruchtnießung des Heiratsgutes, und dessen, was demselben
zuwächst, dem Manne. Besteht das Heiratsgut in barem Gelde, in
abgetretenen Schuldforderungen oder verbrauchbaren Sachen; so gebührt ihm
das vollständige Eigentum.
§
1228. Besteht das Heiratsgut in unbeweglichen Gütern, in Rechten
oder Fahrnissen, welche mit Schonung der Substanz benutzt werden können;
so wird die Ehegattin so lange als Eigentümerin und der Mann als
Fruchtnießer desselben angesehen, bis bewiesen wird, daß der Ehemann das
Heiratsgut für einen bestimmten Preis übernommen, und sich nur zur
Zurückgabe dieses Geldbetrages verbunden hat.
§
1229. Nach dem Gesetze fällt das Heiratsgut nach dem Tode des
Mannes seiner Ehegattin, und wenn sie vor ihm stirbt, ihren Erben heim.
Soll sie oder ihre Erben davon ausgeschlossen sein; so muß dies
ausdrücklich bestimmt werden. Wer das Heiratsgut freiwillig bestellt, kann
sich ausbedingen, daß es nach dem Tode des Mannes auf ihn zurückfalle.
2. Widerlage
§
1230. Was der Bräutigam oder ein Dritter der Braut zur Vermehrung
des Heiratsgutes aussetzt, heißt Widerlage. Hiervon gebührt zwar der
Ehegattin während der Ehe kein Genuß; allein, wenn sie den Mann überlebt,
gebührt ihr ohne besondere Übereinkunft auch das freie Eigentum, obgleich
dem Manne auf den Fall seines Überlebens das Heiratsgut nicht verschrieben
worden ist.
§
1231. Weder der Bräutigam, noch seine Eltern sind verbunden, eine
Widerlage zu bestimmen. Doch in eben der Art, in welcher die Eltern der
Braut schuldig sind, ihr ein Heiratsgut auszusetzen, liegt auch den Eltern
des Bräutigams ob, ihm eine ihrem Vermögen angemessene Ausstattung zu
geben (§§
1220 bis 1223).
3. Morgengabe
§
1232. Das Geschenk, welches der Mann seiner Gattin am ersten
Morgen zu geben verspricht, heißt Morgengabe. Ist dieselbe versprochen
worden, so wird im Zweifel vermutet, daß sie binnen den ersten drei Jahren
der Ehe schon überreicht worden sei.
4. Gütergemeinschaft
§
1233. Die eheliche Verbindung allein begründet noch keine
Gemeinschaft der Güter zwischen den Eheleuten. Dazu wird ein besonderer
Vertrag erfordert, dessen Umfang und rechtliche Form nach den
§§ 1177
und
1178 des vorigen Hauptstückes beurteilt wird.
§
1234. Die Gütergemeinschaft unter Ehegatten wird in der Regel nur
auf den Todesfall verstanden. Sie gibt dem Ehegatten das Recht auf die
Hälfte dessen, was von den der Gemeinschaft wechselseitig unterzogenen
Gütern nach Ableben des anderen Ehegatten noch vorhanden sein wird.
§
1235. Bei einer Gemeinschaft, die sich auf das ganze Vermögen
bezieht, sind vor der Teilung alle Schulden ohne Ausnahme; bei einer
Gemeinschaft aber, die bloß das gegenwärtige, oder bloß das künftige
Vermögen zum Gegenstande hat, nur diejenigen Schulden abzuziehen, die zum
Nutzen des gemeinschaftlichen Gutes verwendet worden sind.
§
1236. Besitzt ein Ehegatte ein unbewegliches Gut und wird das
Recht des andern Ehegatten zur Gemeinschaft in die öffentlichen Bücher
eingetragen; so erhält dieser durch die Eintragung auf die Hälfte der
Substanz des Gutes ein dingliches Recht, vermöge dessen der eine Ehegatte
über diese Hälfte keine Anordnung machen kann; auf die Nutzungen aber
während der Ehe erhält er durch die Einverleibung keinen Anspruch. Nach
dem Tode des Ehegatten gebührt dem überlebenden Teile sogleich das freie
Eigentum seines Anteiles. Doch kann eine solche Einverleibung den auf das
Gut früher eingetragenen Gläubigern nicht zum Nachteile gereichen.
5. Gesetzlicher
ehelicher Güterstand
§
1237. Haben Eheleute über die Verwendung ihres Vermögens keine
besondere Übereinkunft getroffen; so behält jeder Ehegatte sein voriges
Eigentumsrecht, und auf das, was ein jeder Teil während der Ehe erwirbt,
und auf was immer für eine Art überkommt, hat der andere keinen Anspruch.
§
1238. aufgehoben
§
1239. aufgehoben
§
1240. aufgehoben
§
1241. aufgehoben
6. Witwengehalt;
§
1242. Das, was einer Gattin auf den Fall des Witwenstandes zum
Unterhalte bestimmt wird, heißt Witwengehalt. Dieser gebührt der Witwe
gleich nach dem Tode des Mannes, und soll immer auf drei Monate vorhinein
entrichtet werden.
§
1243. aufgehoben
§
1244. Wenn die Witwe sich verehelicht; so verliert sie das Recht
auf den Witwengehalt.
Sicherstellung des
Heiratsgutes, der Widerlage und des Witwengehaltes
§
1245. Wer das Heiratsgut übergibt, ist berechtigt, bei der
Übergabe; oder wenn in der Folge Gefahr eintritt, von demjenigen, der es
empfängt, eine angemessene Sicherstellung zu fordern.143)
Schenkungen unter
Ehegatten und Verlobten
§
1246. Die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Schenkungen zwischen
Ehegatten wird nach den für die Schenkungen überhaupt bestehenden Gesetzen
beurteilt.
§
1247. Was ein Mann seiner Ehegattin an Schmuck, Edelsteinen und
anderen Kostbarkeiten zum Putze gegeben hat, wird im Zweifel nicht für
gelehnt; sondern für geschenkt angesehen. Wenn aber ein verlobter Teil dem
andern; oder auch ein Dritter dem einen oder andern Teile in Rücksicht auf
die künftige Ehe etwas zusichert oder schenkt; so kann, wenn die Ehe ohne
Verschulden des Geschenkgebers nicht erfolgt, die Schenkung widerrufen
werden.
Wechselseitige
Testamente
§
1248. Den Ehegatten ist gestattet, in einem und dem nämlichen
Testamente sich gegenseitig, oder auch andere Personen als Erben
einzusetzen. Auch ein solches Testament ist widerruflich; es kann aber aus
der Widerrufung des einen Teiles auf die Widerrufung des andern Teiles
nicht geschlossen werden (§
583).
Erbverträge.
Erfordernisse zur Gültigkeit des Erbvertrages
§
1249. Zwischen Ehegatten kann auch ein Erbvertrag, wodurch der
künftige Nachlaß, oder ein Teil desselben versprochen, und das Versprechen
angenommen wird, geschlossen werden (§
602). Zur Gültigkeit eines solchen Vertrages ist jedoch notwendig, daß
er schriftlich mit allen Erfordernissen eines schriftlichen Testamentes
errichtet werde.
§
1250. Ein pflegebefohlener Ehegatte kann zwar die ihm
versprochene, unnachteilige Verlassenschaft annehmen; aber die Verfügung
über seine eigene Verlassenschaft kann, ohne Genehmhaltung des Gerichtes,
nur insofern bestehen, als sie ein gültiges Testament ist.
Vorschrift über die
eingerückten Bedingungen
§
1251. Was von Bedingungen bei Verträgen überhaupt gesagt worden
ist, muß auch auf Erbverträge zwischen Ehegatten angewendet werden.
Wirkung des
Erbvertrages
§
1252. Ein [selbst den öffentlichen Büchern einverleibter]
Erbvertrag hindert den Ehegatten nicht, mit seinem Vermögen, solange er
lebt, nach Belieben zu schalten. Das Recht, welches daraus entsteht, setzt
den Tod des Erblassers voraus; es kann von dem Vertragserben, wenn er den
Erblasser nicht überlebt, weder auf andere übertragen, noch der künftigen
Erbschaft willen eine Sicherstellung gefordert werden.
§
1253. Durch den Erbvertrag kann ein Ehegatte auf das Recht, zu
testieren, nicht gänzlich Verzicht tun. Ein reiner Vierteil, worauf weder
der jemandem gebührende Pflichtteil, noch eine andere Schuld haften darf,
bleibt kraft des Gesetzes zur freien letzten Anordnung immer vorbehalten.
Hat der Erblasser darüber nicht verfügt; so fällt er doch nicht dem
Vertragserben, obschon die ganze Verlassenschaft versprochen worden wäre,
sondern den gesetzlichen Erben zu.
Erlöschung desselben
§
1254. Der Erbvertrag kann zum Nachteile des andern Gatten, mit dem
er geschlossen worden ist, nicht widerrufen; sondern nur nach Vorschrift
der Gesetze entkräftet werden. Den Noterben bleiben ihre Rechte, wie gegen
eine andere letzte Anordnung, vorbehalten.
Fruchtnießung auf den
Todesfall (Advitalitätsrecht)
§
1255. Wenn ein Ehegatte dem andern die Fruchtnießung seines
Vermögens auf den Fall des Überlebens erteilt; so wird er dadurch in der
freien Verfügung durch Handlungen unter Lebenden nicht beschränkt; das
Recht der Fruchtnießung (§§
509 – 520) bezieht sich nur auf den Nachlaß des frei vererblichen
Vermögens.
§
1256. [Wird aber die Fruchtnießung eines unbeweglichen Gutes mit
Einwilligung des Verleihers den öffentlichen Büchern einverleibt; so kann
dieselbe in Hinsicht dieses Gutes nicht mehr verkürzt werden.]
§
1257. In dem Falle, daß der überlebende Teil sich wieder
verehelicht, oder die Fruchtnießung einem andern abtreten will, haben die
Kinder des verstorbenen Ehegatten das Recht zu verlangen, daß ihnen
dieselbe gegen einen angemessenen jährlichen Betrag überlassen werde.
§
1258. Ein Ehegatte, welcher auf die Fruchtnießung der ganzen
Verlassenschaft des andern Ehegatten, oder eines Teiles derselben Anspruch
macht, hat kein Recht, den ihm in dem Falle der gesetzlichen Erbfolge von
dem Gesetze ausgemessenen Anteil zu fordern (§§
757 – 759).
Einkindschaft
§
1259. Die Einkindschaft, das ist, ein Vertrag, wodurch Kinder aus
verschiedenen Ehen in der Erbfolge einander gleich gehalten werden sollen,
hat keine rechtliche Wirkung.
Absonderung des Vermögens in dem Falle:
1. eines Konkurses;
§
1260. Wenn über das Vermögen des Mannes bei seinen Lebzeiten ein
Konkurs eröffnet wird; so kann die Ehegattin zwar noch nicht die
Zurückstellung des Heiratsgutes, und die Herausgabe der Widerlage, sondern
nur die Sicherstellung für den Fall der Auflösung der Ehe gegen die
Gläubiger verlangen. Sie ist überdies berechtigt, von Zeit der
Konkurseröffnung den Genuß des witiblichen Unterhaltes, und wenn keiner
bedungen ist, den Genuß des Heiratsgutes anzusprechen. Dieser Anspruch auf
den einen, oder den andern Genuß hat aber nicht statt, wenn bewiesen wird,
daß die Ehegattin an dem Verfalle der Vermögensumstände des Mannes Ursache
sei.
§
1261. Verfällt die Gattin mit ihrem Vermögen in den Konkurs; so
bleiben die Ehepakte unverändert.
§
1262. Ist zwischen den Ehegatten eine Gemeinschaft der Güter
bedungen; so hört dieselbe durch den Konkurs des einen oder des andern
Ehegatten auf, und das zwischen ihnen gemeinschaftliche Vermögen wird, wie
bei dem Tode, geteilt.
[2. einer
freiwilligen;]
§
1263. gegenstandslos
[oder 3. einer
gerichtlichen Scheidung]
§
1264. gegenstandslos
4. Nichtigerklärung;
§
1265. Wird eine Ehe für ungültig erklärt; so zerfallen auch die
Ehepakte; das Vermögen kommt, insofern es vorhanden ist, in den vorigen
Stand zurück. Der schuldtragende Teil hat aber dem schuldlosen Teile
Entschädigung zu leisten [(§
102)].
5. [Trennung] der Ehe
§
1266. Wird die [Trennung] der Ehe (§§
115 und
133)
auf Verlangen beider Ehegatten, ihrer unüberwindlichen Abneigung wegen,
verwilligt; so sind die Ehepakte, soweit darüber kein Vergleich getroffen
wird (§
117), für beide Teile erloschen. Wird auf die [Trennung] der Ehe durch
Urteil erkannt, so gebührt dem schuldlosen Ehegatten nicht nur volle
Genugtuung, sondern von dem Zeitpunkte der erkannten [Trennung] alles
dasjenige, was ihm in den Ehepakten auf den Fall des Überlebens bedungen
worden ist. Das Vermögen, worüber eine Gütergemeinschaft bestanden hat,
wird wie bei dem Tode geteilt, und das Recht aus einem Erbvertrage bleibt
dem Schuldlosen auf den Todesfall vorbehalten. Die gesetzliche Erbfolge (§§
757 - 759) kann ein getrennter, obgleich schuldloser Ehegatte nicht
ansprechen.
Neunundzwanzigstes Hauptstück
Von den Glücksverträgen
Glücksverträge
§
1267. Ein Vertrag, wodurch die Hoffnung eines noch ungewissen
Vorteiles versprochen und angenommen wird, ist ein Glücksvertrag. Er
gehört, je nachdem etwas dagegen versprochen wird oder nicht, zu den
entgeltlichen oder unentgeltlichen Verträgen.
§
1268. Bei Glücksverträgen findet das Rechtsmittel wegen Verkürzung
über die Hälfte des Wertes nicht statt.
Arten der
Glücksverträge
§
1269. Glücksverträge sind: die Wette; das Spiel und das Los; alle
über gehoffte Rechte, oder über künftige noch unbestimmte Sachen
errichtete Kauf- und andere Verträge; ferner, die Leibrenten; die
gesellschaftlichen Versorgungsanstalten; endlich, die Versicherungs- und
Bodmereiverträge.
1. die Wette;
§
1270. Wenn über ein beiden Teilen noch unbekanntes Ereignis ein
bestimmter Preis zwischen ihnen für denjenigen, dessen Behauptung der
Erfolg entspricht, verabredet wird; so entsteht eine Wette. Hatte der
gewinnende Teil von dem Ausgange Gewißheit, und verheimlichte er sie dem
andern Teile; so macht er sich einer Arglist schuldig, und die Wette ist
ungültig. Der verlierende Teil aber, dem der Ausgang vorher bekannt war,
ist als ein Geschenkgeber anzusehen.
§
1271. Redliche und sonst erlaubte Wetten sind insoweit
verbindlich, als der bedungene Preis nicht bloß versprochen; sondern
wirklich entrichtet, oder hinterlegt worden ist. Gerichtlich kann der
Preis nicht gefordert werden.
2. das Spiel;
§
1272. Jedes Spiel ist eine Art von Wette. Die für Wetten
festgesetzten Rechte gelten auch für Spiele. Welche Spiele überhaupt, oder
für besondere Klassen verboten; wie Personen, die verbotene Spiele
treiben, und diejenigen, die ihnen dazu Unterschleif geben, zu bestrafen
sind, bestimmen die politischen Gesetze.
3. Los;
§
1273. Ein zwischen Privatpersonen auf eine Wette oder auf ein
Spiel abzielendes Los wird nach den für Wetten und Spiele festgesetzten
Vorschriften beurteilt. Soll aber eine Teilung, eine Wahl oder eine
Streitigkeit durch das Los entschieden werden; so treten dabei die Rechte
der übrigen Verträge ein.
§
1274. Staatslotterien sind nicht nach der Eigenschaft der Wette
und des Spieles; sondern nach den jedes Mal darüber kundgemachten Planen,
zu beurteilen.
4. Hoffnungskauf;
§
1275. Wer für ein bestimmtes Maß von einem künftigen Erträgnisse
einen verhältnismäßigen Preis verspricht, schließt einen ordentlichen
Kaufvertrag.
§
1276. Wer die künftigen Nutzungen einer Sache in Pausch und Bogen;
oder wer die Hoffnung derselben in einem bestimmten Preise kauft,
errichtet einen Glücksvertrag; er trägt die Gefahr der ganz vereitelten
Erwartung; es gebühren ihm aber auch alle ordentlich erzielte Nutzungen.
[insbesondere eines
Kuxes;]
§
1277. gegenstandslos
oder einer Erbschaft;
§
1278.
(1) Der Käufer
einer von dem Verkäufer angetretenen, oder ihm wenigstens angefallenen
Erbschaft tritt nicht allein in die Rechte; sondern auch in die
Verbindlichkeiten des Verkäufers als Erben ein, insoweit diese nicht bloß
persönlich sind. Wenn also bei dem Kaufe kein Inventarium zugrunde gelegt
wird, ist auch der Erbschaftskauf ein gewagtes Geschäft.
(2) Der
Erbschaftskauf bedarf zu seiner Gültigkeit der Aufnahme eines
Notariatsaktes oder der Beurkundung durch gerichtliches Protokoll.
§
1279. Auf Sachen, die dem Verkäufer nicht als Erben; sondern aus
einem andern Grunde, z. B. als Vorausvermächtnis, [als Fideikommiß,] als
Substitution, als Schuldforderung aus der Verlassenschaft gebühren, und
ihm auch ohne Erbrecht gebührt hätten, hat der Erbschaftskäufer keinen
Anspruch. Dagegen erhält er alles, was der Erbschaft selbst zuwächst, es
sei durch den Abgang eines Legatars, oder eines Miterben, oder auf was
immer für eine andere Art, insoweit der Verkäufer darauf Anspruch gehabt
hätte.
§
1280. Alles, was der Erbe aus dem Erbrechte erhält, wie z. B. die
bezogenen Früchte und Forderungen, wird mit zur Masse gerechnet; alles
hingegen, was er aus dem Seinigen auf die Antretung der Erbschaft, oder
auf die Verlassenschaft verwendet hat, wird von der Masse abgezogen. Dahin
gehören die bezahlten Schulden; die schon abgeführten Vermächtnisse,
Abgaben und Gerichtsgebühren; und wenn es nicht ausdrücklich anders
verabredet worden ist, auch die Begräbniskosten.
§
1281. Insoweit der Verkäufer die Verlassenschaft vor der Übergabe
verwaltet hat, haftet er dem Käufer dafür, wie ein anderer
Geschäftsträger.
§
1282. Die Erbschaftsgläubiger und Vermächtnisnehmer aber können
sich ihrer Befriedigung wegen sowohl an den Käufer der Erbschaft, als an
den Erben selbst halten. Ihre Rechte, sowie jene der Erbschaftsschuldner
werden durch den Verkauf der Erbschaft nicht geändert, und die
Erbschaftsantretung des einen gilt auch für den andern.
§
1283. Hat man bei dem Verkaufe der Erbschaft ein Inventarium
zugrunde gelegt; so haftet der Verkäufer für dasselbe. Ist der Kauf ohne
ein solches Verzeichnis geschehen; so haftet er für die Richtigkeit seines
Erbrechtes, wie er es angegeben hat, und für allen dem Käufer durch sein
Verschulden zugefügten Schaden.
5. Leibrente;
§
1284. Wird jemandem für Geld, oder gegen eine für Geld geschätzte
Sache auf die Lebensdauer einer gewissen Person eine bestimmte jährliche
Entrichtung versprochen; so ist es ein Leibrentenvertrag.
§
1285. Die Dauer der Leibrente kann von dem Leben des einen oder
andern Teiles, oder auch eines Dritten abhängen. Sie wird im Zweifel
vierteljährig vorhinein entrichtet; und nimmt in allen Fällen mit dem
Leben desjenigen, auf dessen Kopf sie beruht, ihr Ende.
§
1286. Weder die Gläubiger, noch die Kinder desjenigen, welcher
sich eine Leibrente bedingt, sind berechtigt, den Vertrag umzustoßen. Doch
steht den erstern frei, ihre Befriedigung aus den Leibrenten zu suchen;
den letztern aber, die Hinterlegung eines entbehrlichen Teiles der Rente
zu fordern, um sich den ihnen nach dem Gesetze gebührenden Unterhalt
darauf versichern zu lassen.
6. gesellschaftliche
Versorgungsanstalten;
§
1287. Der Vertrag, wodurch vermittelst einer Einlage ein
gemeinschaftlicher Versorgungsfond für die Mitglieder, ihre Gattinnen oder
Waisen errichtet wird, ist aus der Natur und dem Zwecke einer solchen
Anstalt, und den darüber festgesetzten Bedingungen, zu beurteilen.
7.
Versicherungsvertrag;
§
1288. Wenn jemand die Gefahr des Schadens, welcher einen andern
ohne dessen Verschulden treffen könnte, auf sich nimmt, und ihm gegen
einen gewissen Preis den bedungenen Ersatz zu leisten verspricht; so
entsteht der Versicherungsvertrag. Der Versicherer haftet dabei für den
zufälligen Schaden, und der Versicherte für den versprochenen Preis.
§
1289. Der gewöhnliche Gegenstand dieses Vertrages sind Waren, die
zu Wasser oder zu Lande verführt werden. Es können aber auch andere
Sachen, z. B. Häuser und Grundstücke gegen Feuer-, Wasser- und andere
Gefahren versichert werden.
§
1290. Ereignet sich der zufällige Schade, wofür die Entschädigung
versichert worden ist; so muß der Versicherte, wenn kein unüberwindliches
Hindernis dazwischen kommt, oder nichts anderes verabredet worden ist, dem
Versicherer, wenn sie sich im nämlichen Orte befinden, binnen drei Tagen,
sonst aber in derjenigen Zeitfrist davon Nachricht geben, welche zur
Bekanntmachung der Annahme eines von einem Abwesenden gemachten
Versprechens bestimmt worden ist (§
862). Unterläßt er die Anzeige; kann er den Unfall nicht erweisen;
oder kann der Versicherer beweisen, daß der Schade aus Verschulden des
Versicherten entstanden ist; so hat dieser auch keinen Anspruch auf die
versicherte Summe.
§
1291. Wenn der Untergang der Sache dem Versicherten; oder der
gefahrlose Zustand derselben dem Versicherer zur Zeit des geschlossenen
Vertrages schon bekannt war; so ist der Vertrag ungültig.
Bodmerei- und
Seeassekuranzen
§
1292. Die Bestimmungen in Rücksicht der Versicherungen zur See;
sowie die Vorschriften über den Bodmereivertrag sind ein Gegenstand der
Seegesetze.
Dreißigstes Hauptstück
Von dem Rechte des Schadensersatzes und der Genugtuung
Schade
§
1293. Schade heißt jeder Nachteil, welcher jemandem an Vermögen,
Rechten oder seiner Person zugefügt worden ist. Davon unterscheidet sich
der Entgang des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge
zu erwarten hat.
Quellen der
Beschädigung
§
1294. Der Schade entspringt entweder aus einer widerrechtlichen
Handlung, oder Unterlassung eines andern; oder aus einem Zufalle. Die
widerrechtliche Beschädigung wird entweder willkürlich, oder unwillkürlich
zugefügt. Die willkürliche Beschädigung aber gründet sich teils in einer
bösen Absicht, wenn der Schade mit Wissen und Willen; teils in einem
Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit, oder aus Mangel der
gehörigen Aufmerksamkeit, oder des gehörigen Fleißes verursacht worden
ist. Beides wird ein Verschulden genannt.
Von
der Verbindlichkeit zum Schadensersatze:
1. Von dem Schaden
aus Verschulden;
§
1295.
(1) Jedermann ist
berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des Schadens, welchen dieser
ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der Schade mag durch
Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Vertrag
verursacht worden sein.
(2) Auch wer in
einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise absichtlich Schaden
zufügt, ist dafür verantwortlich, jedoch falls dies in Ausübung eines
Rechtes geschah, nur dann, wenn die Ausübung des Rechtes offenbar den
Zweck hatte, den anderen zu schädigen.
§
1296. Im Zweifel gilt die Vermutung, daß ein Schade ohne
Verschulden eines andern entstanden sei.
§
1297. Es wird aber auch vermutet, daß jeder, welcher den
Verstandesgebrauch besitzt, eines solchen Grades des Fleißes und der
Aufmerksamkeit fähig sei, welcher bei gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet
werden kann. Wer bei Handlungen, woraus eine Verkürzung der Rechte eines
andern entsteht, diesen Grad des Fleißes oder der Aufmerksamkeit
unterläßt, macht sich eines Versehens schuldig.
§
1298. Wer vorgibt, daß er an der Erfüllung seiner vertragsmäßigen
oder gesetzlichen Verbindlichkeit ohne sein Verschulden verhindert worden
sei, dem liegt der Beweis ob. Soweit er auf Grund vertraglicher
Vereinbarung nur für grobe Fahrlässigkeit haftet, muß er auch beweisen,
daß es an dieser Voraussetzung fehlt.
insbesondere
a) der
Sachverständigen,
§
1299. Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst, zu einem Gewerbe
oder Handwerke öffentlich bekennt; oder wer ohne Not freiwillig ein
Geschäft übernimmt, dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse, oder einen
nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert, gibt dadurch zu erkennen, daß er sich
den notwendigen Fleiß und die erforderlichen, nicht gewöhnlichen,
Kenntnisse zutraue; er muß daher den Mangel derselben vertreten. Hat aber
derjenige, welcher ihm das Geschäft überließ, die Unerfahrenheit desselben
gewußt; oder, bei gewöhnlicher Aufmerksamkeit wissen können, so fällt
zugleich dem letzteren ein Versehen zur Last.
§
1300. Ein Sachverständiger ist auch dann verantwortlich, wenn er
gegen Belohnung in Angelegenheiten seiner Kunst oder Wissenschaft aus
Versehen einen nachteiligen Rat erteilt. Außer diesem Falle haftet ein
Ratgeber nur für den Schaden, welchen er wissentlich durch Erteilung des
Rates dem andern verursacht hat.
oder b) mehrerer
Teilnehmer
§
1301. Für einen widerrechtlich zugefügten Schaden können mehrere
Personen verantwortlich werden, indem sie gemeinschaftlich, unmittelbarer
oder mittelbarer Weise durch Verleiten, Drohen, Befehlen, Helfen,
Verhehlen u. dgl.; oder, auch nur durch Unterlassung der besonderen
Verbindlichkeit, das Übel zu verhindern, dazu beigetragen haben.
§
1302. In einem solchen Falle verantwortet, wenn die Beschädigung
in einem Versehen gegründet ist, und die Anteile sich bestimmen lassen,
jeder nur den durch sein Versehen verursachten Schaden. Wenn aber der
Schaden vorsätzlich zugefügt worden ist; oder, wenn die Anteile der
Einzelnen an der Beschädigung sich nicht bestimmen lassen; so haften alle
für einen und einer für alle; doch bleibt demjenigen, welcher den Schaden
ersetzt hat, der Rückersatz gegen die übrigen vorbehalten.
§
1303. Inwieweit mehrere Mitschuldner bloß aus der unterlassenen
Erfüllung ihrer Verbindlichkeit zu haften haben, ist aus der
Beschaffenheit des Vertrages zu beurteilen.
§
1304. Wenn bei einer Beschädigung zugleich ein Verschulden von
Seite des Beschädigten eintritt; so trägt er mit dem Beschädiger den
Schaden verhältnismäßig; und, wenn sich das Verhältnis nicht bestimmen
läßt, zu gleichen Teilen.
2. aus dem Gebrauche
des Rechtes;
§
1305. Wer von seinem Rechte innerhalb der rechtlichen Schranken (§
1295, Absatz 2) Gebrauch macht, hat den für einen anderen daraus
entspringenden Nachteil nicht zu verantworten.
3. aus einer
schuldlosen oder unwillkürlichen Handlung;
§
1306. Den Schaden, welchen jemand ohne Verschulden oder durch eine
unwillkürliche Handlung verursacht hat, ist er in der Regel zu ersetzen
nicht schuldig.
§
1306a. Wenn jemand im Notstand einen Schaden verursacht, um eine
unmittelbar drohende Gefahr von sich oder anderen abzuwenden, hat der
Richter unter Erwägung, ob der Beschädigte die Abwehr aus Rücksicht auf
die dem anderen drohende Gefahr unterlassen hat, sowie des Verhältnisses
der Größe der Beschädigung zu dieser Gefahr oder endlich des Vermögens des
Beschädigers und des Beschädigten zu erkennen, ob und in welchem Umfange
der Schaden zu ersetzen ist.
§
1307. Wenn sich jemand aus eigenem Verschulden in einen Zustand
der Sinnesverwirrung oder in einen Notstand versetzt hat, so ist auch der
in demselben verursachte Schade seinem Verschulden zuzuschreiben. Eben
dieses gilt auch von einem Dritten, der durch sein Verschulden diese Lage
bei dem Beschädiger veranlaßt hat.
§
1308. Wenn Personen, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben,
oder Unmündige jemanden beschädigen, der durch irgendein Verschulden
hierzu selbst Veranlassung gegeben hat, so kann er keinen Ersatz
ansprechen.
§
1309. Außer diesem Falle gebührt ihm der Ersatz von denjenigen
Personen, denen der Schade wegen Vernachlässigung der ihnen über solche
Personen anvertrauten Obsorge beigemessen werden kann.
§
1310. Kann der Beschädigte auf solche Art den Ersatz nicht
erhalten; so soll der Richter mit Erwägung des Umstandes, ob dem
Beschädiger, ungeachtet er gewöhnlich seines Verstandes nicht mächtig ist,
in dem bestimmten Falle nicht dennoch ein Verschulden zur Last liege;
oder, ob der Beschädigte aus Schonung des Beschädigers die Verteidigung
unterlassen habe; oder endlich, mit Rücksicht auf das Vermögen des
Beschädigers und des Beschädigten; auf den ganzen Ersatz, oder doch einen
billigen Teil desselben erkennen.
4. durch Zufall;
§
1311. Der bloße Zufall trifft denjenigen, in dessen Vermögen oder
Person er sich ereignet. Hat aber jemand den Zufall durch ein Verschulden
veranlaßt; hat er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen
vorzubeugen sucht, übertreten; oder, sich ohne Not in fremde Geschäfte
gemengt; so haftet er für allen Nachteil, welcher außer dem nicht erfolgt
wäre.
§
1312. Wer in einem Notfalle jemandem einen Dienst geleistet hat,
dem wird der Schade, welchen er nicht verhütet hat, nicht zugerechnet; es
wäre denn, daß er einen andern, der noch mehr geleistet haben würde, durch
seine Schuld daran verhindert hätte. Aber auch in diesem Falle kann er den
sicher verschafften Nutzen gegen den verursachten Schaden in Rechnung
bringen.
5. durch fremde
Handlungen;
§
1313. Für fremde, widerrechtliche Handlungen, woran jemand keinen
Teil genommen hat, ist er in der Regel auch nicht verantwortlich. Selbst
in den Fällen, wo die Gesetze das Gegenteil anordnen, bleibt ihm der
Rückersatz gegen den Schuldtragenden vorbehalten.
§
1313a. Wer einem andern zu einer Leistung verpflichtet ist, haftet
ihm für das Verschulden seines gesetzlichen Vertreters sowie der Personen,
deren er sich zur Erfüllung bedient, wie für sein eigenes.
§
1314. Wer eine Dienstperson ohne Zeugnis aufnimmt oder wissentlich
eine durch ihre Leibes- oder Gemütsbeschaffenheit gefährliche Person im
Dienste behält oder ihr Aufenthalt gibt, haftet dem Hausherrn und den
Hausgenossen für den Ersatz des durch die gefährliche Beschaffenheit
dieser Personen verursachten Schadens.
§
1315. Überhaupt haftet derjenige, welcher sich einer untüchtigen
oder wissentlich einer gefährlichen Person zur Besorgung seiner
Angelegenheiten bedient, für den Schaden, den sie in dieser Eigenschaft
einem Dritten zufügt.
§
1316. Gastwirte, die Fremde beherbergen, sowie die anderen in
§ 970
bezeichneten Personen, ferner Fuhrleute haften für den Schaden, welchen
ihre eigenen oder die von ihnen zugewiesenen Dienstpersonen an den
eingebrachten oder übernommenen Sachen einem Gast oder Reisenden in ihrem
Hause, ihrer Anstalt oder ihrem Fahrzeuge verursachen.
§
1317. Inwiefern bei öffentlichen Versendungsanstalten für den
Schaden eine Haftung übernommen werde, bestimmen die besonderen
Vorschriften.
§
1318. Wird jemand durch das Herabfallen einer gefährlich
aufgehängten oder gestellten Sache; oder, durch Herauswerfen oder
Herausgießen aus einer Wohnung beschädigt; so haftet derjenige, aus dessen
Wohnung geworfen oder gegossen worden, oder die Sache herabgefallen ist,
für den Schaden.
6. durch ein Bauwerk;
§
1319. Wird durch Einsturz oder Ablösung von Teilen eines Gebäudes
oder eines anderen auf einem Grundstück aufgeführten Werkes jemand
verletzt oder sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des
Gebäudes oder Werkes zum Ersatze verpflichtet, wenn die Ereignung die
Folge der mangelhaften Beschaffenheit des Werkes ist und er nicht beweist,
daß er alle zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt angewendet
habe.
6a. durch einen Weg;
§
1319a.
(1) Wird durch den
mangelhaften Zustand eines Weges ein Mensch getötet, an seinem Körper oder
an seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so haftet
derjenige für den Ersatz des Schadens, der für den ordnungsgemäßen Zustand
des Weges als Halter verantwortlich ist, sofern er oder einer seiner Leute
den Mangel vorsätzlich oder grobfahrlässig verschuldet hat. Ist der
Schaden bei einer unerlaubten, besonders auch widmungswidrigen, Benützung
des Weges entstanden und ist die Unerlaubtheit dem Benützer entweder nach
der Art des Weges oder durch entsprechende Verbotszeichen, eine
Abschrankung oder eine sonstige Absperrung des Weges erkennbar gewesen, so
kann sich der Geschädigte auf den mangelhaften Zustand des Weges nicht
berufen.
(2) Ein Weg im Sinn
des
Abs. 1 ist eine Landfläche, die von jedermann unter den gleichen
Bedingungen für den Verkehr jeder Art oder für bestimmte Arten des
Verkehres benützt werden darf, auch wenn sie nur für einen eingeschränkten
Benützerkreis bestimmt ist; zu einem Weg gehören auch die in seinem Zug
befindlichen und dem Verkehr dienenden Anlagen, wie besonders Brücken,
Stützmauern, Futtermauern, Durchlässe, Gräben und Pflanzungen. Ob der
Zustand eines Weges mangelhaft ist, richtet sich danach, was nach der Art
des Weges, besonders nach seiner Widmung, für seine Anlage und Betreuung
angemessen und zumutbar ist.
(3) Ist der
mangelhafte Zustand durch Leute des Haftpflichtigen verschuldet worden, so
haften auch sie nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
7. durch ein Tier
§
1320. Wird jemand durch ein Tier beschädigt, so ist derjenige
dafür verantwortlich, der es dazu angetrieben, gereizt oder zu verwahren
vernachlässigt hat. Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, wenn
er nicht beweist, daß er für die erforderliche Verwahrung oder
Beaufsichtigung gesorgt hatte.
§
1321. Wer auf seinem Grund und Boden fremdes Vieh antrifft, ist
deswegen noch nicht berechtigt, es zu töten. Er kann es durch anpassende
Gewalt verjagen; oder, wenn er dadurch Schaden gelitten hat, das Recht der
Privat-Pfändung über so viele Stücke Viehes ausüben, als zu seiner
Entschädigung hinreicht. Doch muß er binnen acht Tagen sich mit dem
Eigentümer abfinden, oder seine Klage vor den Richter bringen;
widrigenfalls aber das gepfändete Vieh zurückstellen.
§
1322. Das gepfändete Vieh muß auch zurückgestellt werden, wenn der
Eigentümer eine andere angemessene Sicherheit leistet.
Arten des
Schadenersatzes
§
1323. Um den Ersatz eines verursachten Schadens zu leisten, muß
alles in den vorigen Stand zurückversetzt, oder, wenn dieses nicht tunlich
ist, der Schätzungswert vergütet werden. Betrifft der Ersatz nur den
erlittenen Schaden, so wird er eigentlich eine Schadloshaltung; wofern er
sich aber auch auf den entgangenen Gewinn, und die Tilgung der
verursachten Beleidigung erstreckt, volle Genugtuung genannt.
§
1324. In dem Falle eines aus böser Absicht, oder aus einer
auffallenden Sorglosigkeit verursachten Schadens ist der Beschädigte volle
Genugtuung; in den übrigen Fällen aber nur die eigentliche Schadloshaltung
zu fordern berechtigt. Hiernach ist in den Fällen, wo im Gesetze der
allgemeine Ausdruck: Ersatz, vorkommt, zu beurteilen, welche Art des
Ersatzes zu leisten sei.
Insbesondere
1. bei Verletzungen
an dem Körper;
§
1325. Wer jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die
Heilungskosten des Verletzten, ersetzt ihm den entgangenen, oder, wenn der
Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden
Verdienst; und bezahlt ihm auf Verlangen überdies ein den erhobenen
Umständen angemessenes Schmerzengeld.
§
1326. Ist die verletzte Person durch die Mißhandlung verunstaltet
worden; so muß zumal, wenn sie weiblichen Geschlechtes ist, insofern auf
diesen Umstand Rücksicht genommen werden, als ihr besseres Fortkommen
dadurch verhindert werden kann.
§
1327. Erfolgt aus einer körperlichen Verletzung der Tod, so müssen
nicht nur alle Kosten, sondern auch den Hinterbliebenen, für deren
Unterhalt der Getötete nach dem Gesetze zu sorgen hatte, das, was ihnen
dadurch entgangen ist, ersetzt werden.
1a. an der
geschlechtlichen Selbstbestimmung
§
1328. Wer jemanden durch eine strafbare Handlung oder sonst durch
Hinterlist, Drohung oder Ausnutzung eines Abhängigkeits- oder
Autoritätsverhältnisses zur Beiwohnung oder sonst zu geschlechtlichen
Handlungen mißbraucht, hat ihm den erlittenen Schaden und den entgangenen
Gewinn zu ersetzen sowie eine angemessene Entschädigung für die erlittene
Beeinträchtigung zu leisten.
2. an der
persönlichen Freiheit;
§
1329. Wer jemanden durch gewaltsame Entführung, durch
Privatgefangennehmung oder vorsätzlich durch einen widerrechtlichen Arrest
seiner Freiheit beraubt, ist verpflichtet, dem Verletzten die vorige
Freiheit zu verschaffen und volle Genugtuung zu leisten. Kann er ihm die
Freiheit nicht mehr verschaffen, so muß er den Hinterbliebenen, wie bei
der Tötung, Ersatz leisten.
3. an der Ehre;
§
1330.
(1) Wenn jemandem
durch Ehrenbeleidigung ein wirklicher Schade oder Entgang des Gewinnes
verursacht worden ist, so ist er berechtigt, den Ersatz zu fordern.
(2) Dies gilt auch,
wenn jemand Tatsachen verbreitet, die den Kredit, den Erwerb oder das
Fortkommen eines anderen gefährden und deren Unwahrheit er kannte oder
kennen mußte. In diesem Falle kann auch der Widerruf und die
Veröffentlichung desselben verlangt werden. Für eine nicht öffentlich
vorgebrachte Mitteilung, deren Unwahrheit der Mitteilende nicht kennt,
haftet er nicht, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein
berechtigtes Interesse hatte.
4. an dem Vermögen
§
1331. Wird jemand an seinem Vermögen vorsätzlich oder durch
auffallende Sorglosigkeit eines andern beschädigt; so ist er auch den
entgangenen Gewinn, und wenn der Schade vermittelst einer durch ein
Strafgesetz verbotenen Handlung, oder aus Mutwillen und Schadenfreude
verursacht worden ist, den Wert der besondern Vorliebe zu fordern
berechtigt.
§
1332. Der Schade, welcher aus einem mindern Grade des Versehens
oder der Nachlässigkeit verursacht worden ist, wird nach dem gemeinen
Werte, den die Sache zur Zeit der Beschädigung hatte, ersetzt.
§
1332a. Wird ein Tier verletzt, so gebühren die tatsächlich
aufgewendeten Kosten der Heilung oder der versuchten Heilung auch dann,
wenn sie den Wert des Tieres übersteigen, soweit auch ein verständiger
Tierhalter in der Lage des Geschädigten diese Kosten aufgewendet hätte.
Besonders durch die
Verzögerung der Zahlung.
Gesetzliche Zinsen und weitere Schäden
§
1333. 144)
(1) Der Schaden,
den der Schuldner seinem Gläubiger durch die Verzögerung der Zahlung einer
Geldforderung zugefügt hat, wird durch die gesetzlichen Zinsen (§
1000 Abs. 1) vergütet.
(2) Bei der
Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen zwischen Unternehmern aus
unternehmerischen Geschäften beträgt der gesetzliche Zinssatz acht
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, der am
letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr
maßgebend.
(3) Der Gläubiger
kann außer den gesetzlichen Zinsen auch den Ersatz anderer, vom Schuldner
verschuldeter und ihm erwachsener Schäden geltend machen, insbesondere die
notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungs-
oder Einbringungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis
zur betriebenen Forderung stehen.
§
1334. Eine Verzögerung fällt einem Schuldner zur Last, wenn er den
durch Gesetz oder Vertrag bestimmten Zahlungstag nicht einhält. Sofern die
Parteien nicht anderes vereinbart haben, hat der Schuldner seine Leistung
bei vertragsgemäßer Erbringung der Gegenleistung ohne unnötigen Aufschub
nach der Erfüllung durch den Gläubiger oder, wenn die Parteien ein solches
Verfahren vereinbart haben, nach der Abnahme oder Überprüfung der Leistung
des Gläubigers oder, wenn die Forderung der Höhe nach noch nicht
feststeht, nach dem Eingang der Rechnung oder einer gleichwertigen
Zahlungsaufforderung zu erbringen. Ist die Zahlungszeit sonst nicht
bestimmt, so trägt der Schuldner die Folgen der Zahlungsverzögerung, wenn
er sich nach dem Tag der gerichtlichen oder außergerichtlichen Einmahnung
nicht mit dem Gläubiger abgefunden hat.
§
1335. Hat der Gläubiger die Zinsen ohne gerichtliche Einmahnung
bis auf den Betrag der Hauptschuld steigen lassen, so erlischt das Recht,
vom Kapital weitere Zinsen zu fordern, sofern es sich nicht um
Geldforderungen gegen einen Unternehmer aus unternehmerischen Geschäften
handelt. Vom Tag der Streitanhängigkeit an können jedoch neuerdings Zinsen
verlangt werden.
Bedingung des
Vergütungsbetrages (Konventionalstrafe)
§
1336.
(1) Die
vertragschließenden Teile können eine besondere Übereinkunft treffen, daß
auf den Fall des entweder gar nicht oder nicht auf gehörige Art oder zu
spät erfüllten Versprechens anstatt des zu vergütenden Nachteiles ein
bestimmter Geld- oder anderer Betrag entrichtet werden solle (§
912). Der Schuldner erlangt mangels besonderer Vereinbarung nicht das
Recht, sich durch Bezahlung des Vergütungsbetrages von der Erfüllung zu
befreien. Wurde die Konventionalstrafe für die Nichteinhaltung der
Erfüllungszeit oder des Erfüllungsortes versprochen, so kann sie neben der
Erfüllung gefordert werden.
(2) In allen Fällen
ist der Vergütungsbetrag, wenn er vom Schuldner als übermäßig erwiesen
wird, von dem Richter, allenfalls nach Einvernehmung von Sachverständigen,
zu mäßigen.
Verbindlichkeit der
Erben des Beschädigers
§
1337. Die Verbindlichkeit zum Ersatze des Schadens, und des
entgangenen Gewinnes, oder zur Entrichtung des bedungenen
Vergütungsbetrages haftet auf dem Vermögen, und geht auf die Erben über.
Rechtsmittel der
Entschädigung
§
1338. Das Recht zum Schadenersatze muß in der Regel, wie jedes
andere Privatrecht, bei dem ordentlichen Richter angebracht werden. Hat
der Beschädiger zugleich ein Strafgesetz übertreten; so trifft ihn auch
die verhängte Strafe. Die Verhandlung über den Schadensersatz aber gehört
auch in diesem Falle, insofern sie nicht durch die Strafgesetze dem
Strafgerichte oder der politischen Behörde aufgetragen ist, zu dem
Zivilgerichte.
§
1339. aufgehoben
§
1340. Diese Behörden haben in dem Falle, daß sich die
Entschädigung unmittelbar bestimmen läßt, sogleich darüber nach den in
diesem Hauptstücke erteilten Vorschriften zu erkennen. Wenn aber der
Ersatz des Schadens nicht unmittelbar bestimmt werden kann, ist in dem
Erkenntnisse überhaupt auszudrücken, daß dem Beschädigten die
Entschädigung im Wege Rechtens zu suchen vorbehalten bleibe. Dieser Weg
ist auch in Kriminalfällen dem Beschädigten[, und in andern Fällen beiden
Teilen] dann vorbehalten, wenn sie mit der von der Strafbehörde erfolgten
Bestimmung des Ersatzes sich nicht befriedigen wollten.
§
1341. Gegen das Verschulden eines Richters beschwert man sich bei
der höhern Behörde. Diese untersucht und beurteilt die Beschwerde von Amts
wegen.
Dritter Teil
Von den gemeinschaftlichen Bestimmungen der Personen- und Sachenrechte
Erstes Hauptstück
Von Befestigung der Rechte und Verbindlichkeiten
Gemeinschaftliche
Bestimmungen der Rechte
§
1342. Sowohl Personenrechte als Sachenrechte, und daraus
entspringende Verbindlichkeiten können gleichförmig befestigt, umgeändert
und aufgehoben werden.
Arten der Befestigung
eines Rechtes;
§
1343. Die rechtlichen Arten der Sicherstellung einer
Verbindlichkeit und der Befestigung eines Rechtes, durch welche dem
Berechtigten ein neues Recht eingeräumt wird, sind: die Verpflichtung
eines Dritten für den Schuldner, und die Verpfändung.
I. durch
Verpflichtung eines Dritten
§
1344. Ein Dritter kann sich dem Gläubiger für den Schuldner auf
dreierlei Art verpflichten: einmal, wenn er mit Einwilligung des
Gläubigers die Schuld als Alleinzahler übernimmt; dann, wenn er der
Verbindlichkeit als Mitschuldner beitritt; endlich, wenn er sich für die
Befriedigung des Gläubigers auf den Fall verbindet, daß der erste
Schuldner die Verbindlichkeit nicht erfülle.
§
1345. Wenn jemand mit Einwilligung des Gläubigers die ganze Schuld
eines andern übernimmt; so geschieht keine Befestigung, sondern eine
Umänderung der Verbindlichkeit, wovon in dem
folgenden
Hauptstücke gehandelt wird.
a) als Bürge;
§
1346.
(1) Wer sich zur
Befriedigung des Gläubigers auf den Fall verpflichtet, daß der erste
Schuldner die Verbindlichkeit nicht erfülle, wird ein Bürge, und das
zwischen ihm und dem Gläubiger getroffene Übereinkommen ein
Bürgschaftsvertrag genannt. Hier bleibt der erste Schuldner noch immer der
Hauptschuldner, und der Bürge kommt nur als Nachschuldner hinzu.
(2) Zur Gültigkeit
des Bürgschaftsvertrages ist erforderlich, daß die Verpflichtungserklärung
des Bürgen schriftlich abgegeben wird.
b) als Mitschuldner;
§
1347. Wenn jemand, ohne die den Bürgen zustatten kommende
Bedingung, einer Verbindlichkeit als Mitschuldner beitritt; so entsteht
eine Gemeinschaft mehrerer Mitschuldner, deren rechtliche Folgen nach den
in dem Hauptstücke von Verträgen überhaupt gegebenen Vorschriften zu
beurteilen sind (§§
888 bis 896).
Entschädigungsbürge
§
1348. Wer dem Bürgen auf den Fall, daß derselbe durch seine
Bürgschaft zu Schaden kommen sollte, Entschädigung zusagt, heißt
Entschädigungsbürge.
Wer sich verbürgen
könne
§
1349. Fremde Verbindlichkeiten kann ohne Unterschied des
Geschlechtes jedermann auf sich nehmen, dem die freie Verwaltung seines
Vermögens zusteht.
Für welche
Verbindlichkeiten
§
1350. Eine Bürgschaft kann nicht nur über Summen und Sachen,
sondern auch über erlaubte Handlungen und Unterlassungen in Beziehung auf
den Vorteil oder Nachteil, welcher aus denselben für den Sichergestellten
entstehen kann, geleistet werden.
§
1351. Verbindlichkeiten, welche nie zu Recht bestanden haben, oder
schon aufgehoben sind, können weder übernommen, noch bekräftigt werden.
§
1352. Wer sich für eine Person verbürgt, die sich vermöge ihrer
persönlichen Eigenschaft nicht verbinden kann, ist, obschon ihm diese
Eigenschaft unbekannt war, gleich einem ungeteilten Mitschuldner
verpflichtet (§
896).
Umfang der Bürgschaft
§
1353. Die Bürgschaft kann nicht weiter ausgedehnt werden, als sich
der Bürge ausdrücklich erklärt hat. Wer sich für ein zinsbares Kapital
verbürgt, haftet nur für jene rückständigen Zinsen, welche der Gläubiger
noch nicht einzutreiben berechtigt war.
§
1354. Von der Einwendung, wodurch ein Schuldner nach Vorschrift
der Gesetze die Beibehaltung eines Teiles seines Vermögens zu seinem
Unterhalte zu fordern berechtigt ist, kann der Bürge nicht Gebrauch
machen.
Wirkung
§
1355. Der Bürge kann in der Regel erst dann belangt werden, wenn
der Hauptschuldner auf des Gläubigers gerichtliche oder außergerichtliche
Einmahnung seine Verbindlichkeit nicht erfüllt hat.
§
1356. Der Bürge kann aber, selbst wenn er sich ausdrücklich nur
für den Fall verbürgt hat, daß der Hauptschuldner zu zahlen unvermögend
sei, zuerst belangt werden, wenn der Hauptschuldner in Konkurs verfallen,
oder wenn er zur Zeit, als die Zahlung geleistet werden sollte,
unbekannten Aufenthaltes, und der Gläubiger keiner Nachlässigkeit zu
beschuldigen ist.
§
1357. Wer sich als Bürge und Zahler verpflichtet hat, haftet als
ungeteilter Mitschuldner für die ganze Schuld; es hängt von der Willkür
des Gläubigers ab, ob er zuerst den Hauptschuldner, oder den Bürgen oder
beide zugleich belangen wolle (§
891).
§
1358. Wer eine fremde Schuld bezahlt, für die er persönlich oder
mit bestimmten Vermögensstücken haftet, tritt in die Rechte des Gläubigers
und ist befugt, von dem Schuldner den Ersatz der bezahlten Schuld zu
fordern. Zu diesem Ende ist der befriedigte Gläubiger verbunden, dem
Zahler alle vorhandenen Rechtsbehelfe und Sicherungsmittel auszuliefern.
§
1359. Haben für den nämlichen ganzen Betrag mehrere Personen
Bürgschaft geleistet; so haftet jede für den ganzen Betrag. Hat aber eine
von ihnen die ganze Schuld abgetragen; so gebührt ihr gleich dem
Mitschuldner (§
896) das Recht des Rückersatzes gegen die übrigen.
§
1360. Wenn dem Gläubiger vor, oder bei Leistung der Bürgschaft
noch außer derselben von dem Hauptschuldner, oder einem Dritten ein Pfand
gegeben wird; so steht ihm zwar noch immer frei, den Bürgen der Ordnung
nach (§
1355) zu belangen; aber er ist nicht befugt, zu dessen Nachteil sich
des Pfandes zu begeben.
§
1361. Hat der Bürge oder Zahler den Gläubiger befriedigt, ohne
sich mit dem Hauptschuldner einzuverstehen; so kann dieser alles gegen
jene einwenden, was er gegen den Gläubiger hätte einwenden können.
§
1362. Der Bürge kann von dem Entschädigungsbürgen nur dann
Entschädigung verlangen, wenn er sich den Schaden nicht durch sein eigenes
Verschulden zugezogen hat.
Arten der Erlöschung
der Bürgschaft
§
1363. Die Verbindlichkeit des Bürgen hört verhältnismäßig mit der
Verbindlichkeit des Schuldners auf. Hat sich der Bürge nur auf eine
gewisse Zeit verpflichtet; so haftet er nur für diesen Zeitraum. Die
Entlassung eines Mitbürgen kommt diesem zwar gegen den Gläubiger; aber
nicht gegen die übrigen Mitbürgen zustatten (§
896).
§
1364. Durch den Verlauf der Zeit, binnen welcher der Schuldner
hätte zahlen sollen, wird der Bürge, wenn auch der Gläubiger auf die
Befriedigung nicht gedrungen hat, noch nicht von seiner Bürgschaft
befreit; allein er ist befugt, von dem Schuldner, wenn er mit dessen
Einwilligung Bürgschaft geleistet hat, zu verlangen, daß er ihm Sicherheit
verschaffe. Auch der Gläubiger ist dem Bürgen insoweit verantwortlich, als
dieser wegen dessen Saumseligkeit in Eintreibung der Schuld an Erholung
des Ersatzes zu Schaden kommt.
§
1365. Wenn gegen den Schuldner ein gegründetes Besorgnis der
Zahlungsunfähigkeit oder der Entfernung aus den [Erb]ländern, für welche
dieses Gesetzbuch vorgeschrieben ist, eintritt; so steht dem Bürgen das
Recht zu, von dem Schuldner die Sicherstellung der verbürgten Schuld zu
verlangen.
§
1366. Wenn das verbürgte Geschäft beendigt ist; so kann die
Abrechnung, und die Aufhebung der Bürgschaft gefordert werden.
§
1367. Ist der Bürgschaftsvertrag weder durch eine Hypothek, noch
durch ein Faustpfand befestigt; so erlischt er binnen drei Jahren nach dem
Tode des Bürgen, wenn der Gläubiger in der Zwischenzeit unterlassen hat,
von dem Erben die verfallene Schuld gerichtlich oder außergerichtlich
einzumahnen.
II. Durch
Pfandvertrag
§
1368. Pfandvertrag heißt derjenige Vertrag, wodurch der Schuldner,
oder ein anderer anstatt seiner auf eine Sache dem Gläubiger das
Pfandrecht wirklich einräumt, folglich ihm das bewegliche Pfandstück
übergibt, oder das unbewegliche durch die Pfandbücher verschreibt. Der
Vertrag, ein Pfand übergeben zu wollen, ist noch kein Pfandvertrag.
Wirkung des
Pfandvertrages
§
1369. Was bei Verträgen überhaupt Rechtens ist, gilt auch bei dem
Pfandvertrage; er ist zweiseitig verbindlich. Der Pfandnehmer muß das
Handpfand wohl verwahren, und es dem Verpfänder, sobald dieser die
Befriedigung leistet, zurückgeben. Betrifft es eine Hypothek; so muß der
befriedigte Gläubiger den Verpfänder in den Stand setzen, die Löschung der
Verbindlichkeit aus den Hypothekenbüchern bewirken zu können. Die mit dem
Pfandbesitze verknüpften Rechte und Verbindlichkeiten des Pfandgebers und
Pfandnehmers sind im
sechsten
Hauptstücke des zweiten Teiles bestimmt worden.
§
1370. Der Handpfandnehmer ist verbunden, dem Pfandgeber einen
Pfandschein auszustellen, und darin die unterscheidenden Kennzeichen des
Pfandes zu beschreiben. Auch können die wesentlichen Bedingungen des
Pfandvertrages in dem Pfandscheine angeführt werden.
Unerlaubte
Bedingungen
§
1371. Alle der Natur des Pfand- und Darlehensvertrages
entgegenstehende Bedingungen und Nebenverträge sind ungültig. Dahin
gehören die Verabredungen: daß nach der Verfallzeit der Schuldforderung
das Pfandstück dem Gläubiger zufalle; daß er es nach Willkür, oder in
einem schon im voraus bestimmten Preise veräußern, oder für sich behalten
könne; daß der Schuldner das Pfand niemals einlösen, oder ein liegendes
Gut keinem andern verschreiben, oder daß der Gläubiger nach der
Verfallzeit die Veräußerung des Pfandes nicht verlangen dürfe.
§
1372. Der Nebenvertrag, daß dem Gläubiger die Fruchtnießung der
verpfändeten Sache zustehen solle, ist ohne rechtliche Wirkung. Ist dem
Gläubiger der bloße Gebrauch eines beweglichen Pfandstückes eingeräumt
worden (§
459), so muß diese Benützung auf eine dem Schuldner unschädliche Art
geschehen.
Auf welche Art in der
Regel Sicherstellung zu leisten ist
§
1373. Wer verbunden ist, eine Sicherstellung zu leisten, muß diese
Verbindlichkeit durch ein Handpfand, oder durch eine Hypothek erfüllen.
Nur in dem Falle, daß er ein Pfand zu geben außer Stande ist, werden
taugliche Bürgen angenommen.
§
1374. 145)
Niemand ist verpflichtet, eine Sache, die zur Sicherstellung dienen soll,
in einem höheren Wert als der Hälfte ihres Verkehrswertes zum Pfand
anzunehmen. Wer ein angemessenes Vermögen besitzt und im Inland geklagt
werden kann, ist ein tauglicher Bürge.
Zweites Hauptstück
Von Umänderung der Rechte und Verbindlichkeiten
Umänderung der Rechte
und Verbindlichkeiten;
§
1375. Es hängt von dem Willen des Gläubigers und des Schuldners
ab, ihre gegenseitigen willkürlichen Rechte und Verbindlichkeiten
umzuändern. Die Umänderung kann ohne, oder mit Hinzukunft einer dritten
Person, und zwar entweder eines neuen Gläubigers, oder eines neuen
Schuldners geschehen.
1. durch Novation;
§
1376. Die Umänderung ohne Hinzukunft einer dritten Person findet
statt, wenn der Rechtsgrund, oder wenn der Hauptgegenstand einer Forderung
verwechselt wird, folglich die alte Verbindlichkeit in eine neue übergeht.
§
1377. Eine solche Umänderung heißt Neuerungsvertrag (Novation).
Vermöge dieses Vertrages hört die vorige Hauptverbindlichkeit auf, und die
neue nimmt zugleich ihren Anfang.
§
1378. Die mit der vorigen Hauptverbindlichkeit verknüpften
Bürgschafts-, Pfand- und anderen Rechte erlöschen durch den
Neuerungsvertrag, wenn die Teilnehmer nicht durch ein besonderes
Einverständnis hierüber etwas anderes festgesetzt haben.
§
1379. Die näheren Bestimmungen, wo, wann und wie eine schon
vorhandene Verbindlichkeit erfüllt werden soll, und andere
Nebenbestimmungen, wodurch in Rücksicht auf den Hauptgegenstand oder
Rechtsgrund keine Umänderung geschieht, sind ebensowenig als ein
Neuerungsvertrag anzusehen, als die bloße Ausstellung eines neuen
Schuldscheines, oder einer anderen dahin gehörigen Urkunde. Auch kann eine
solche Abänderung in den Nebenbestimmungen einem Dritten, welcher
derselben nicht beigezogen worden ist, keine neue Last auflegen. Im
Zweifel wird die alte Verbindlichkeit nicht für aufgelöst gehalten,
solange sie mit der neuen noch wohl bestehen kann.
2. Vergleich
§
1380. Ein Neuerungsvertrag, durch welchen streitige, oder
zweifelhafte Rechte dergestalt bestimmt werden, daß jede Partei sich
wechselseitig etwas zu geben, zu tun, oder zu unterlassen verbindet, heißt
Vergleich. Der Vergleich gehört zu den zweiseitig verbindlichen Verträgen,
und wird nach eben denselben Grundsätzen beurteilt.
§
1381. Wer dem Verpflichteten mit dessen Einwilligung ein
unstreitiges oder unzweifelhaftes Recht unentgeltlich erläßt, macht eine
Schenkung (§
939).
Ungültigkeit eines
Vergleiches in Rücksicht des Gegenstandes;
§
1382. Es gibt zweifelhafte Fälle, welche durch einen Vergleich
nicht beigelegt werden dürfen. Dahin gehört der zwischen Eheleuten über
die Gültigkeit ihrer Ehe entstandene Streit. Diesen kann nur der durch das
Gesetz bestimmte Gerichtsstand entscheiden.
§
1383. Über den Inhalt einer letzten Anordnung kann vor deren
Bekanntmachung kein Vergleich errichtet werden. Die hierüber entstandene
Wette wird nach den Grundsätzen von Glücksverträgen beurteilt.
§
1384. Vergleiche über Gesetzübertretungen sind nur in Hinsicht auf
die Privatgenugtuung gültig; die gesetzmäßige Untersuchung und Bestrafung
kann dadurch bloß dann abgewendet werden, wenn die Übertretungen von der
Art sind, daß die Behörde nur auf Verlangen der Parteien ihr Amt zu
handeln angewiesen ist.
oder anderer Mängel
§
1385. Ein Irrtum kann den Vergleich nur insoweit ungültig machen,
als er die Wesenheit der Person, oder des Gegenstandes betrifft.
§
1386. Aus dem Grunde einer Verletzung über die Hälfte kann ein
redlich errichteter Vergleich nicht angefochten werden.
§
1387. Ebensowenig können neu gefundene Urkunden, wenn sie auch den
gänzlichen Mangel eines Rechtes auf Seite einer Partei entdeckten, einen
redlich eingegangenen Vergleich entkräften.
§
1388. Ein offenbarer Rechnungsverstoß, oder ein Fehler, welcher
bei dem Abschlusse eines Vergleiches in dem Summieren oder Abziehen
begangen wird, schadet keinem der vertragmachenden Teile.
Umfang des
Vergleiches
§
1389. Ein Vergleich, welcher über eine besondere Streitigkeit
geschlossen worden ist, erstreckt sich nicht auf andere Fälle. Selbst
allgemeine, auf alle Streitigkeiten überhaupt lautende Vergleiche sind auf
solche Rechte nicht anwendbar, die geflissentlich verheimlicht worden
sind, oder auf welche die sich vergleichenden Parteien nicht denken
konnten.
Wirkung in Rücksicht
der Nebenverbindlichkeiten
§
1390. Bürgen und Pfänder, welche zur Sicherheit des ganzen noch
streitigen Rechtes gegeben worden sind, haften auch für den Teil, der
durch den Vergleich bestimmt worden ist. Doch bleiben dem Bürgen und einem
dritten Verpfänder, welche dem Vergleiche nicht beigestimmt haben, alle
Einwendungen gegen den Gläubiger vorbehalten, welche ohne geschlossenen
Vergleich der Forderung hätten entgegengesetzt werden können.
§
1391. Der Vertrag, wodurch Parteien zur Entscheidung streitiger
Rechte einen Schiedsrichter bestellen, erhält seine Bestimmung in der
Gerichtsordnung.
3. Zession
§
1392. Wenn eine Forderung von einer Person an die andere
übertragen, und von dieser angenommen wird; so entsteht die Umänderung des
Rechtes mit Hinzukunft eines neuen Gläubigers. Eine solche Handlung heißt
Abtretung (Zession), und kann mit, oder ohne Entgelt geschlossen werden.
Gegenstände der
Zession
§
1393. Alle veräußerlichen Rechte sind ein Gegenstand der
Abtretung. Rechte, die der Person ankleben, folglich mit ihr erlöschen,
können nicht abgetreten werden. Schuldscheine, die auf den Überbringer
lauten, werden schon durch die Übergabe abgetreten, und bedürfen nebst dem
Besitze keines andern Beweises der Abtretung.
Wirkung
§
1394. Die Rechte des Übernehmers sind mit den Rechten des
Überträgers in Rücksicht auf die überlassene Forderung eben dieselben.
§
1395. Durch den Abtretungsvertrag entsteht nur zwischen dem
Überträger (Zedent) und dem Übernehmer der Forderung (Zessionar); nicht
aber zwischen dem letzten und dem übernommenen Schuldner (Zessus) eine
neue Verbindlichkeit. Daher ist der Schuldner, solange ihm der Übernehmer
nicht bekannt wird, berechtigt, den ersten Gläubiger zu bezahlen, oder
sich sonst mit ihm abzufinden.
§
1396. Dieses kann der Schuldner nicht mehr, sobald ihm der
Übernehmer bekannt gemacht worden ist; allein es bleibt ihm das Recht,
seine Einwendungen gegen die Forderung anzubringen. Hat er die Forderung
gegen den redlichen Übernehmer für richtig erkannt; so ist er verbunden,
denselben als seinen Gläubiger zu befriedigen.
Haftung des Zedenten
§
1397. Wer eine Forderung ohne Entgelt abtritt, also verschenkt,
haftet nicht weiter für dieselbe. Kommt aber die Abtretung auf eine
entgeltliche Art zustande; so haftet der Überträger dem Übernehmer sowohl
für die Richtigkeit, als für die Einbringlichkeit der Forderung, jedoch
nie für mehr, als er von dem Übernehmer erhalten hat.
§
1398. Insofern der Übernehmer über die Einbringlichkeit der
Forderung aus den öffentlichen Pfandbüchern sich belehren konnte, gebührt
ihm in Rücksicht der Uneinbringlichkeit keine Entschädigung. Auch für eine
zur Zeit der Abtretung einbringliche, und durch einen bloßen Zufall oder
durch Versehen des Übernehmers uneinbringlich gewordene Forderung haftet
der Überträger nicht.
§
1399. Ein Versehen dieser Art begeht der Übernehmer, wenn er die
Forderung zur Zeit, als sie aufgekündigt werden kann, nicht aufkündigt,
oder nach verfallener Zahlungsfrist nicht eintreibt; wenn er dem Schuldner
nachsieht; wenn er die noch mögliche Sicherheit zu rechter Zeit sich zu
verschaffen versäumt, oder die gerichtliche Exekution zu betreiben
unterläßt.
4. Anweisung
(Assignation)
§
1400. Durch die Anweisung auf eine Leistung eines Dritten wird der
Empfänger der Anweisung (Assignatar) zur Einhebung der Leistung bei dem
Angewiesenen (Assignat) und der letztere zur Leistung an ersteren für
Rechnung des Anweisenden (Assignant) ermächtigt. Einen unmittelbaren
Anspruch erlangt der Anweisungsempfänger gegen den Angewiesenen erst, wenn
die Erklärung des Angewiesenen über die Annahme der Anweisung ihm
zugekommen ist.
§
1401.
(1) Insoweit der
Angewiesene das zu Leistende dem Anweisenden bereits schuldet, ist er
diesem gegenüber verpflichtet, der Anweisung Folge zu leisten. Wenn durch
die Anweisung eine Schuld des Anweisenden bei dem Empfänger, der die
Anweisung angenommen hat, getilgt werden soll, ist der Empfänger
verpflichtet, den Angewiesenen zur Leistung aufzufordern.
(2) Will der
Empfänger von der Anweisung keinen Gebrauch machen oder verweigert der
Angewiesene die Annahme oder die Leistung, so hat der Empfänger dies dem
Anweisenden ohne Verzug anzuzeigen.
(3) Die Tilgung der
Schuld erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, erst durch die
Leistung.
§
1402. Hat der Angewiesene die Anweisung dem Empfänger gegenüber
angenommen, so kann er diesem nur solche Einwendungen entgegensetzen,
welche die Gültigkeit der Annahme betreffen oder sich aus dem Inhalte der
Anweisung oder aus seinen persönlichen Beziehungen zum Empfänger ergeben.
§
1403.
(1) Solange der
Angewiesene die Anweisung noch nicht dem Empfänger gegenüber angenommen
hat, kann sie der Anweisende widerrufen. Besteht zwischen dem Anweisenden
und dem Angewiesenen kein anderer Rechtsgrund, so gelten für das
Rechtsverhältnis zwischen beiden die Vorschriften über den
Bevollmächtigungsvertrag; die Anweisung erlischt jedoch nicht durch den
Tod des Anweisenden oder Angewiesenen. Inwiefern die Aufhebung der
Anweisung auch gegenüber dem Empfänger rechtswirksam ist, bestimmt sich
nach dem zwischen diesem und dem Anweisenden obwaltenden Rechtsverhältnis.
(2) Der Anspruch
des Empfängers gegen den Angewiesenen verjährt in drei Jahren.
5. Schuldübernahme
§
1404. Wer einem Schuldner verspricht, die Leistung an dessen
Gläubiger zu bewirken (Erfüllungsübernahme), haftet dem Schuldner dafür,
daß der Gläubiger ihn nicht in Anspruch nehme. Dem Gläubiger erwächst
daraus unmittelbar kein Recht.
§
1405. Wer einem Schuldner erklärt, seine Schuld zu übernehmen
(Schuldübernahme), tritt als Schuldner an dessen Stelle, wenn der
Gläubiger einwilligt. Bis diese Einwilligung erfolgt oder falls sie
verweigert wird, haftet er wie bei Erfüllungsübernahme (§
1404). Die Einwilligung des Gläubigers kann entweder dem Schuldner
oder dem Übernehmer erklärt werden.
§
1406.
(1) Auch ohne
Vereinbarung mit dem Schuldner kann ein Dritter durch Vertrag mit dem
Gläubiger die Schuld übernehmen.
(2) Im Zweifel ist
aber die dem Gläubiger erklärte Übernahme als Haftung neben dem bisherigen
Schuldner, nicht an dessen Stelle zu verstehen.
§
1407.
(1) Die
Verbindlichkeiten des Übernehmers sind mit den Verbindlichkeiten des
bisherigen Schuldners in Rücksicht auf die übernommene Schuld
ebendieselben. Der Übernehmer kann dem Gläubiger die aus dem
Rechtsverhältnis zwischen diesem und dem bisherigen Schuldner
entspringenden Einwendungen entgegensetzen.
(2) Die Nebenrechte
der Forderung werden durch den Schuldnerwechsel nicht berührt. Bürgen und
von dritten Personen bestellte Pfänder haften jedoch nur dann fort, wenn
der Bürge oder Verpfänder dem Schuldnerwechsel zugestimmt hat.
§
1408. Übernimmt bei Veräußerung einer Liegenschaft der Erwerber
ein auf ihr haftendes Pfandrecht, so ist dies im Zweifel als
Schuldübernahme zu verstehen. Der Veräußerer kann, nach vollzogener
Übertragung des Eigentums, den Gläubiger zur Annahme des neuen Schuldners
an seiner Stelle schriftlich mit der Wirkung auffordern, daß die
Einwilligung als erteilt gilt, wenn sie nicht binnen sechs Monaten versagt
wird. Auf diese Wirkung muß in der Aufforderung ausdrücklich hingewiesen
sein.
§
1409.
(1) Übernimmt
jemand ein Vermögen oder ein Unternehmen, so ist er unbeschadet der
fortdauernden Haftung des Veräußerers den Gläubigern aus den zum Vermögen
oder Unternehmen gehörigen Schulden, die er bei der Übergabe kannte oder
kennen mußte, unmittelbar verpflichtet. Er wird aber von der Haftung
insoweit frei, als er an solchen Schulden schon so viel berichtigt hat,
wie der Wert des übernommenen Vermögens oder Unternehmens beträgt.
(2) Ist jedoch ein
naher Angehöriger des Veräußerers (§
32 KO) der Übernehmer, so trifft ihn diese Verpflichtung, soweit er
nicht beweist, daß ihm die Schulden bei der Übergabe weder bekannt waren
noch bekannt sein mußten.
(3)
Entgegenstehende Vereinbarungen zwischen Veräußerer und Übernehmer zum
Nachteile der Gläubiger sind diesen gegenüber unwirksam.
§
1409a. Wer ein Vermögen oder ein Unternehmen im Weg der
Zwangsvollstreckung, des Konkurses, des Ausgleichsverfahrens (auch des
fortgesetzten Verfahrens) oder der Überwachung des Schuldners durch
Sachwalter der Gläubiger erwirbt, haftet nicht nach
§
1409 Abs. 1 und
2.
§
1410. Wird der Eintritt des neuen Schuldners an Stelle des
bisherigen Schuldners in der Weise verabredet, daß an die Stelle des
aufgehobenen Schuldverhältnisses eine Verpflichtung des neuen Schuldners
aus selbständigem Rechtsgrunde oder unter Änderung des Hauptgegenstandes
der Forderung gesetzt wird, so treten nicht die Wirkungen der
Schuldübernahme, sondern eines Neuerungsvertrages (§§
1377,
1378)
ein.
Drittes Hauptstück
Von Aufhebung der Rechte und Verbindlichkeiten
Aufhebung der Rechte
und Verbindlichkeiten
§
1411. Rechte und Verbindlichkeiten stehen in einem solchen
Zusammenhange, daß mit Erlöschung des Rechtes die Verbindlichkeit, und mit
Erlöschung der letzteren das Recht aufgehoben wird.
1. Durch die Zahlung
§
1412. Die Verbindlichkeit wird vorzüglich durch die Zahlung, das
ist: durch die Leistung dessen, was man zu leisten schuldig ist, aufgelöst
(§ 469).
Wie die Zahlung zu
leisten;
§
1413. Gegen seinen Willen kann weder der Gläubiger gezwungen
werden, etwas anderes anzunehmen, als er zu fordern hat, noch der
Schuldner, etwas anderes zu leisten, als er zu leisten verbunden ist.
Dieses gilt auch von der Zeit, dem Orte und der Art, die Verbindlichkeit
zu erfüllen.
§
1414. Wird, weil der Gläubiger und der Schuldner einverstanden
sind, oder weil die Zahlung selbst unmöglich ist, etwas anderes an
Zahlungs Statt gegeben; so ist die Handlung als ein entgeltliches Geschäft
zu betrachten.
§
1415. Der Gläubiger ist nicht schuldig, die Zahlung einer
Schuldpost teilweise, oder auf Abschlag anzunehmen. Sind aber verschiedene
Posten zu zahlen; so wird diejenige für abgetragen gehalten, welche der
Schuldner, mit Einwilligung des Gläubigers tilgen zu wollen, sich
ausdrücklich erklärt hat.
§
1416. Wird die Willensmeinung des Schuldners bezweifelt, oder von
dem Gläubiger widersprochen; so sollen zuerst die Zinsen, dann das
Kapital, von mehreren Kapitalien aber dasjenige, welches schon
eingefordert, oder wenigstens fällig ist, und nach diesem dasjenige,
welches schuldig zu bleiben dem Schuldner am meisten beschwerlich fällt,
abgerechnet werden.
wann;
§
1417. Wenn die Zahlungsfrist auf keine Art bestimmt ist; so tritt
die Verbindlichkeit, die Schuld zu zahlen, erst mit dem Tage ein, an
welchem die Einmahnung geschehen ist (§
904).
§
1418. In gewissen Fällen wird die Zahlungsfrist durch die Natur
der Sache bestimmt. Alimente werden wenigstens auf einen Monat voraus
bezahlt. Stirbt der Verpflegte während dieser Zeit; so sind dessen Erben
nicht schuldig, etwas von der Vorausbezahlung zurückzugeben.
§
1419. Hat der Gläubiger gezögert, die Zahlung anzunehmen; so
fallen die widrigen Folgen auf ihn.
§
1420. Wenn der Ort und die Art der Leistung nicht bestimmt sind,
so müssen die oben (§
905) aufgestellten Vorschriften angewendet werden.
von wem;
§
1421. Auch eine Person, die sonst unfähig ist, ihr Vermögen zu
verwalten, kann eine richtige und verfallene Schuld rechtmäßig abtragen,
und sich ihrer Verbindlichkeit entledigen. Hätte sie aber eine noch
ungewisse, oder nicht verfallene Schuld abgetragen, so sind die mit der
Obsorge betrauten Personen, ihr Sachwalter oder Kurator berechtigt, das
Geleistete zurückzufordern.146)
§
1422. Wer die Schuld eines anderen, für die er nicht haftet (§
1358), bezahlt, kann vor oder bei der Zahlung vom Gläubiger die
Abtretung seiner Rechte verlangen; hat er dies getan, so wirkt die Zahlung
als Einlösung der Forderung.
§
1423. Wird die Einlösung mit Einverständnis des Schuldners
angeboten, so muß der Gläubiger die Zahlung annehmen; doch hat er außer
dem Falle des Betruges für die Einbringlichkeit und Richtigkeit der
Forderung nicht zu haften. Ohne Einwilligung des Schuldners kann dem
Gläubiger von einem Dritten in der Regel (§
462) die Zahlung nicht aufgedrängt werden.
an wen
§
1424. Der Schuldbetrag muß dem Gläubiger oder dessen zum Empfange
geeigneten Machthaber, oder demjenigen geleistet werden, den das Gericht
als Eigentümer der Forderung erkannt hat. Was jemand an eine Person
bezahlt hat, die ihr Vermögen nicht selbst verwalten darf, ist er insoweit
wieder zu zahlen verbunden, als das Bezahlte nicht wirklich vorhanden,
oder zum Nutzen des Empfängers verwendet worden ist.
Gerichtliche
Hinterlegung der Schuld
§
1425. Kann eine Schuld aus dem Grunde, weil der Gläubiger
unbekannt, abwesend, oder mit dem Angebotenen unzufrieden ist, oder aus
andern wichtigen Gründen nicht bezahlt werden; so steht dem Schuldner
bevor, die abzutragende Sache bei dem Gerichte zu hinterlegen; oder, wenn
sie dazu nicht geeignet ist, die gerichtliche Einleitung zu deren
Verwahrung anzusuchen. Jede dieser Handlungen, wenn sie rechtmäßig
geschehen und dem Gläubiger bekannt gemacht worden ist, befreit den
Schuldner von seiner Verbindlichkeit, und wälzt die Gefahr der geleisteten
Sache auf den Gläubiger.
Quittungen
§
1426. Der Zahler ist in allen Fällen berechtigt, von dem
Befriedigten eine Quittung, nämlich ein schriftliches Zeugnis der
erfüllten Verbindlichkeit, zu verlangen. In der Quittung muß der Name des
Schuldners und des Gläubigers, sowie der Ort, die Zeit und der Gegenstand
der getilgten Schuld ausgedrückt, und sie muß von dem Gläubiger, oder
dessen Machthaber unterschrieben werden. Die Kosten der Quittung hat, wenn
nichts anderes vereinbart ist, der Gläubiger zu tragen.
§
1427. Eine Quittung über das bezahlte Kapital gründet die
Vermutung, daß auch die Zinsen davon bezahlt worden seien.
§
1428. Besitzt der Gläubiger von dem Schuldner einen Schuldschein;
so ist er nebst Ausstellung einer Quittung verbunden, denselben
zurückzugeben, oder die allenfalls geleistete Abschlagszahlung auf dem
Schuldscheine selbst abschreiben zu lassen. Der zurückerhaltene
Schuldschein ohne Quittung gründet für den Schuldner die rechtliche
Vermutung der geleisteten Zahlung; er schließt aber den Gegenbeweis nicht
aus. Ist der Schuldschein, welcher zurückgegeben werden soll, in Verlust
geraten; so ist der Zahlende berechtigt, Sicherstellung zu fordern, oder
den Betrag gerichtlich zu hinterlegen, und zu verlangen, daß der Gläubiger
die Tötung des Schuldscheines der Gerichtsordnung gemäß bewirke.
§
1429. Eine Quittung, die der Gläubiger dem Schuldner für eine
abgetragene neuere Schuldpost ausgestellt hat, beweist zwar nicht, daß
auch andere ältere Posten abgetragen worden seien: wenn es aber gewisse
Gefälle, Renten, oder solche Zahlungen betrifft, welche, wie Geld-,
Grund-, Haus- oder Kapitalszinsen, aus eben demselben Titel und zu einer
gewissen Zeit geleistet werden sollen; so wird vermutet, daß derjenige,
welcher sich mit der Quittung des letzt verfallenen Termines ausweist,
auch die früher verfallenen berichtigt habe.
§
1430. Ebenso wird von Handels- und Gewerbsleuten, welche mit ihren
Abnehmern (Kunden) zu gewissen Fristen die Rechnungen abzuschließen
pflegen, vermutet, daß ihnen, wenn sie über die Rechnung aus einer
späteren Frist quittiert haben, auch die früheren Rechnungen bezahlt
seien.
Zahlung einer
Nichtschuld
§
1431. Wenn jemandem aus einem Irrtume, wäre es auch ein
Rechtsirrtum, eine Sache oder eine Handlung geleistet worden, wozu er
gegen den Leistenden kein Recht hat; so kann in der Regel im ersten Falle
die Sache zurückgefordert, im zweiten aber ein dem verschafften Nutzen
angemessener Lohn verlangt werden.
§
1432. Doch können Zahlungen einer verjährten, oder einer solchen
Schuld, welche nur aus Mangel der Förmlichkeiten ungültig ist, oder zu
deren Eintreibung das Gesetz bloß das Klagerecht versagt, ebensowenig
zurückgefordert werden, als wenn jemand eine Zahlung leistet, von der er
weiß, daß er sie nicht schuldig ist.
§
1433. Diese Vorschrift (§
1432) kann aber auf den Fall, in welchem ein Pflegebefohlener, oder
eine andere Person bezahlt hat, welche nicht frei über ihr Eigentum
verfügen kann, nicht angewendet werden.
§
1434. Die Zurückstellung des Bezahlten kann auch dann begehrt
werden, wenn die Schuldforderung auf was immer für eine Art noch ungewiß
ist; oder wenn sie noch von der Erfüllung einer beigesetzten Bedingung
abhängt. Die Bezahlung einer richtigen und unbedingten Schuld kann aber
deswegen nicht zurückgefordert werden, weil die Zahlungsfrist noch nicht
verfallen ist.
§
1435. Auch Sachen, die als eine wahre Schuldigkeit gegeben worden
sind, kann der Geber von dem Empfänger zurückfordern, wenn der rechtliche
Grund, sie zu behalten, aufgehört hat.
§
1436. War jemand verbunden, aus zwei Sachen nur eine nach seiner
Willkür zu geben, und hat er aus Irrtum beide gegeben; so hängt es von ihm
ab, die eine oder die andere zurückzufordern.
§
1437. Der Empfänger einer bezahlten Nichtschuld wird als ein
redlicher oder unredlicher Besitzer angesehen, je nachdem er den Irrtum
des Gebers gewußt hat, oder aus den Umständen vermuten mußte, oder nicht.
2. Kompensation
§
1438. Wenn Forderungen gegenseitig zusammentreffen, die richtig,
gleichartig und so beschaffen sind, daß eine Sache, die dem einen als
Gläubiger gebührt, von diesem auch als Schuldner dem andern entrichtet
werden kann; so entsteht, insoweit die Forderungen sich gegeneinander
ausgleichen, eine gegenseitige Aufhebung der Verbindlichkeiten
(Kompensation), welche schon für sich die gegenseitige Zahlung bewirkt.
§
1439. Zwischen einer richtigen und nicht richtigen, sowie zwischen
einer fälligen und noch nicht fälligen Forderung findet die Kompensation
nicht statt. Inwiefern gegen eine Konkursmasse die Kompensation
stattfinde, wird in der Gerichtsordnung bestimmt.
§
1440. Ebenso lassen sich Forderungen, welche ungleichartige oder
bestimmte und unbestimmte Sachen zum Gegenstande haben, gegeneinander
nicht aufheben. Eigenmächtig oder listig entzogene, entlehnte, in
Verwahrung oder in Bestand genommene Stücke sind überhaupt kein Gegenstand
der Zurückbehaltung oder der Kompensation.
§
1441. Ein Schuldner kann seinem Gläubiger dasjenige nicht in
Aufrechnung bringen, was dieser einem Dritten und der Dritte dem Schuldner
zu zahlen hat. Selbst eine Summe, die jemand an eine Staatskasse zu
fordern hat, kann gegen eine Zahlung, die er an eine andere Staatskasse
leisten muß, nicht abgerechnet werden.
§
1442. Wenn eine Forderung allmählich auf mehrere übertragen wird;
so kann der Schuldner zwar die Forderung, welche er zur Zeit der Abtretung
an den ersten Inhaber derselben hatte, sowie auch jene, die ihm gegen den
letzten Inhaber zusteht, in Abrechnung bringen; nicht aber auch diejenige,
welche ihm an einen der Zwischeninhaber zustand.
§
1443. Gegen eine den öffentlichen Büchern einverleibte Forderung
kann die Einwendung der Kompensation einem Zessionar nur dann
entgegengesetzt werden, wenn die Gegenforderung ebenfalls und zwar bei der
Forderung selbst eingetragen, oder dem Zessionar bei Übernehmung der
letztern bekannt gemacht worden ist.
3. Entsagung
§
1444. In allen Fällen, in welchen der Gläubiger berechtigt ist,
sich seines Rechtes zu begeben, kann er demselben auch zum Vorteile seines
Schuldners entsagen, und hierdurch die Verbindlichkeit des Schuldners
aufheben.
4. Vereinigung
§
1445. Sooft auf was immer für eine Art das Recht mit der
Verbindlichkeit in einer Person vereinigt wird, erlöschen beide; außer,
wenn es dem Gläubiger noch frei steht, eine Absonderung seiner Rechte zu
verlangen (§§
802 und
812),
oder wenn Verhältnisse von ganz verschiedener Art eintreten. Daher wird
durch die Nachfolge des Schuldners in die Verlassenschaft seines
Gläubigers in den Rechten der Erbschaftsgläubiger, der Miterben oder
Legatare, und durch die Beerbung des Schuldners und Bürgen in den Rechten
des Gläubigers nichts geändert.
§
1446. Rechte und Verbindlichkeiten, welche den öffentlichen
Büchern einverleibt sind, werden durch die Vereinigung nicht aufgehoben,
bis die Löschung aus den öffentlichen Büchern erfolgt ist (§
526). Bis dahin kann das eingetragene Pfandrecht vom Eigentümer oder
im Wege der Zwangsvollstreckung auf einen Dritten übertragen werden (§§
469 bis 470).
5. Untergang der
Sache
§
1447. Der zufällige gänzliche Untergang einer bestimmten Sache
hebt alle Verbindlichkeit, selbst die, den Wert derselben zu vergüten,
auf. Dieser Grundsatz gilt auch für diejenigen Fälle, in welchen die
Erfüllung der Verbindlichkeit, oder die Zahlung einer Schuld durch einen
andern Zufall unmöglich wird. In jedem Falle muß aber der Schuldner das,
was er um die Verbindlichkeit in Erfüllung zu bringen, erhalten hat, zwar
gleich einem redlichen Besitzer, jedoch auf solche Art zurückstellen oder
vergüten, daß er aus dem Schaden des andern keinen Gewinn zieht.
6. Tod
§
1448. Durch den Tod erlöschen nur solche Rechte und
Verbindlichkeiten, welche auf die Person eingeschränkt sind, oder die bloß
persönliche Handlungen des Verstorbenen betreffen.
7. Verlauf der Zeit
§
1449. Rechte und Verbindlichkeiten erlöschen auch durch den
Verlauf der Zeit, worauf sie durch einen letzten Willen, Vertrag,
richterlichen Ausspruch, oder durch das Gesetz beschränkt sind. Auf welche
Art sie durch die von dem Gesetze bestimmte Verjährung aufgehoben werden,
wird in dem
folgenden Hauptstücke festgesetzt.
Von der Einsetzung in
den vorigen Stand
§
1450. Die bürgerlichen Gesetze, nach welchen widerrechtliche
Handlungen und Geschäfte, wenn die Verjährung nicht im Wege steht,
unmittelbar bestritten werden können, gestatten keine Einsetzung in den
vorigen Stand. Die zum gerichtlichen Verfahren gehörigen Fälle der
Einsetzung in den vorigen Stand, sind in der Gerichtsordnung bestimmt.
Viertes Hauptstück
Von der Verjährung und Ersitzung
Verjährung
§
1451. Die Verjährung ist der Verlust eines Rechtes, welches
während der von dem Gesetze bestimmten Zeit nicht ausgeübt worden ist.
Ersitzung
§
1452. Wird das verjährte Recht vermöge des gesetzlichen Besitzes
zugleich auf jemand andern übertragen; so heißt es ein ersessenes Recht,
und die Erwerbungsart Ersitzung.
Wer verjähren und
ersitzen kann
§
1453. Jeder, der sonst zu erwerben fähig ist, kann auch ein
Eigentum oder andere Rechte durch Ersitzung erwerben.
Gegen wen
§
1454. Die Verjährung und Ersitzung kann gegen alle Privatpersonen,
welche ihre Rechte selbst auszuüben fähig sind, stattfinden. Gegen Mündel
und Pflegebefohlene; gegen Kirchen, Gemeinden und andere moralische
Körper; gegen Verwalter des öffentlichen Vermögens und gegen diejenigen,
welche ohne ihr Verschulden abwesend sind, wird sie nur unter den unten (§§
1494,
1472
und
1475) folgenden Beschränkungen gestattet.
Welche Gegenstände
§
1455. Was sich erwerben läßt, kann auch ersessen werden. Sachen
hingegen, welche man vermöge ihrer wesentlichen Beschaffenheit, oder
vermöge der Gesetze nicht besitzen kann; ferner Sachen und Rechte, welche
schlechterdings unveräußerlich sind, sind kein Gegenstand der Ersitzung.
§
1456. Aus diesem Grunde können weder die dem Staat[soberhaupte]
als solchem allein zukommenden Rechte, z. B. das Recht, Zölle anzulegen,
Münzen zu prägen, Steuern auszuschreiben, und andere Hoheitsrechte
(Regalien) durch Ersitzung erworben, noch die diesen Rechten
entsprechenden Schuldigkeiten verjährt werden.
§
1457. Andere dem Staat[soberhaupte] zukommende, doch nicht
ausschließend vorbehaltene Rechte, z. B. auf Waldungen, Jagden,
Fischereien u. dgl., können zwar überhaupt von andern Staatsbürgern, doch
nur binnen einem längeren als dem gewöhnlichen Zeitraume (§
1472) ersessen werden.
§
1458. Die Rechte eines Ehegatten, der Eltern, eines Kindes und
andere Personenrechte sind kein Gegenstand der Ersitzung. Doch kommt
denjenigen, welche dergleichen Rechte redlicher Weise ausüben, die
schuldlose Unwissenheit zur einstweiligen Behauptung und Ausübung ihrer
vermeinten Rechte zustatten.
§
1459. Die Rechte eines Menschen über seine Handlungen und über
sein Eigentum, z. B. eine Ware da oder dort zu kaufen, seine Wiesen oder
sein Wasser zu benutzen, unterliegen, außer dem Falle, daß das Gesetz mit
der binnen einem Zeitraume unterlassenen Ausübung ausdrücklich den Verlust
derselben verknüpft, keiner Verjährung. Hat aber eine Person der andern
die Ausübung eines solchen Rechtes untersagt, oder sie daran verhindert;
so fängt der Besitz des Untersagungsrechtes von Seite der einen gegen die
Freiheit der andern von dem Augenblicke an, als sich diese dem Verbote,
oder der Verhinderung gefügt hat, und es wird dadurch, wenn alle übrige
Erfordernisse eintreffen, die Verjährung oder die Ersitzung bewirkt (§§
313 und
351).
Erfordernisse zur
Ersitzung: 1. Besitz;
§
1460. Zur Ersitzung wird nebst der Fähigkeit der Person und des
Gegenstandes erfordert: daß jemand die Sache oder das Recht, die auf diese
Art erworben werden sollen, wirklich besitze; daß sein Besitz rechtmäßig,
redlich und echt sei, und durch die ganze von dem Gesetze bestimmte Zeit
fortgesetzt werde (§§
309,
316,
326 und
345).
und zwar a) ein
rechtmäßiger;
§
1461. Jeder Besitz, der sich auf einen solchen Titel gründet,
welcher zur Übernahme des Eigentumes, wenn solches dem Übergeber gebührt
hätte, hinlänglich gewesen wäre, ist rechtmäßig und zur Ersitzung
hinreichend. Dergleichen sind, z. B. das Vermächtnis, die Schenkung, das
Darlehen, der Kauf und Verkauf, der Tausch, die Zahlung, usw.
§
1462. Verpfändete, geliehene, in Verwahrung, oder zur
Fruchtnießung gegebene Sachen können von Gläubigern, Entlehnern und
Verwahrern oder Fruchtnießern, aus Mangel eines rechtmäßigen Titels,
niemals ersessen werden. Ihre Erben stellen die Erblasser vor, und haben
nicht mehr Titel als dieselben. Nur dem dritten rechtmäßigen Besitzer kann
die Ersitzungszeit zustatten kommen.
b) redlicher;
§
1463. Der Besitz muß redlich sein. Die Unredlichkeit des vorigen
Besitzers hindert aber einen redlichen Nachfolger oder Erben nicht, die
Ersitzung von dem Tage seines Besitzes anzufangen (§
1493).
c) echter
§
1464. Der Besitz muß auch echt sein. Wenn jemand sich einer Sache
mit Gewalt oder List bemächtigt, oder in den Besitz heimlich einschleicht,
oder eine Sache nur bittweise besitzt; so kann weder er selbst, noch
können seine Erben dieselbe verjähren.
2. Verlauf der Zeit
§
1465. Zur Ersitzung und Verjährung ist auch der in dem Gesetze
vorgeschriebene Verlauf der Zeit notwendig. Außer dem, durch die Gesetze
für einige besondere Fälle festgesetzten Zeitraume, wird hier das in allen
übrigen Fällen zur Ersitzung oder Verjährung nötige Zeitmaß überhaupt
bestimmt. Es kommt dabei sowohl auf die Verschiedenheit der Rechte und der
Sachen, als der Personen an.
Ersitzungszeit.
Ordentliche;
§
1466. Das Eigentumsrecht, dessen Gegenstand eine bewegliche Sache
ist, wird durch einen dreijährigen rechtlichen Besitz ersessen.
§
1467. aufgehoben
§
1468. Wo noch keine ordentlichen öffentlichen Bücher eingeführt
sind, und die Erwerbung unbeweglicher Sachen aus den Gerichtsakten und
andern Urkunden zu erweisen ist, oder wenn die Sache auf den Namen
desjenigen, der die Besitzrechte darüber ausübt, nicht eingetragen ist;
wird die Ersitzung erst nach dreißig Jahren vollendet.
§
1469. aufgehoben
§
1470. Wo noch keine ordentlichen öffentlichen Bücher bestehen,
oder ein solches Recht denselben nicht einverleibt ist, kann es der
redliche Inhaber erst nach dreißig Jahren ersitzen.
§
1471. Bei Rechten, die selten ausgeübt werden können, z. B. bei
dem Rechte, eine Pfründe zu vergeben, oder jemanden bei Herstellung einer
Brücke zum Beitrage anzuhalten, muß derjenige, welcher die Ersitzung
behauptet, nebst einem Verlaufe von dreißig Jahren, zugleich erweisen, daß
der Fall zur Ausübung binnen dieser Zeit wenigstens dreimal sich ergeben,
und er jedesmal dieses Recht ausgeübt habe.
außerordentliche
§
1472. Gegen den Fiskus, das ist, gegen die Verwalter der
Staatsgüter und des Staatsvermögens, insoweit die Verjährung Platz greift
(§§ 287,
[289]
und
1456 - 1457), ferner gegen die Verwalter der Güter der Kirchen,
Gemeinden und anderer erlaubten Körper, reicht die gemeine ordentliche
Ersitzungszeit nicht zu. Der Besitz beweglicher Sachen, [sowie auch der
Besitz der unbeweglichen, oder der darauf ausgeübten Dienstbarkeiten und
anderer Rechte, wenn sie auf den Namen des Besitzers den öffentlichen
Büchern einverleibt sind,] muß durch sechs Jahre fortgesetzt werden.
Rechte solcher Art, die auf den Namen des Besitzers in die öffentlichen
Bücher nicht einverleibt sind, und alle übrige Rechte lassen sich gegen
den Fiskus und die hier angeführten begünstigten Personen nur durch den
Besitz von vierzig Jahren erwerben.
§
1473. Wer mit einer von dem Gesetze in Ansehung der
Verjährungszeit begünstigten Person in Gemeinschaft steht, dem kommt die
nämliche Begünstigung zustatten. Begünstigungen der längeren
Verjährungsfrist haben auch gegen andere, darin ebenfalls begünstigte
Personen ihre Wirkung.
§
1474. Die Eigenschaft [eines Familien-Fideikommisses,] eines
Erbpacht- und Erbzinsgutes geht nur durch einen frei eigentümlichen Besitz
von vierzig Jahren verloren.
§
1475. Der Aufenthalt des Eigentümers außer der Provinz
[nunmehr: dem Bundesland],
in welcher [nunmehr: welchem]
sich die Sache befindet, steht der ordentlichen Ersitzung und Verjährung
insoweit entgegen, daß die Zeit einer willkürlichen und schuldlosen
Abwesenheit nur zur Hälfte, folglich ein Jahr nur für sechs Monate,
gerechnet wird. Doch soll auf kurze Zeiträume der Abwesenheit, welche
durch kein volles Jahr ununterbrochen gedauert haben, nicht Bedacht
genommen, und überhaupt die Zeit nie weiter als bis auf dreißig Jahre
zusammen ausgedehnt werden. Schuldbare Abwesenheit genießt keine Ausnahme
von der ordentlichen Verjährungszeit.
§
1476. Auch derjenige, welcher eine bewegliche Sache unmittelbar
von einem unechten, oder von einem unredlichen Besitzer an sich gebracht
hat, oder seinen Vormann anzugeben nicht vermag; muß den Verlauf der sonst
ordentlichen Ersitzungszeit doppelt abwarten.
§
1477. Wer die Ersitzung auf einen Zeitraum von dreißig oder
vierzig Jahren stützt, bedarf keiner Angabe des rechtmäßigen Titels. Die
gegen ihn erwiesene Unredlichkeit des Besitzes schließt aber auch in
diesem längeren Zeitraume die Ersitzung aus.
Verjährungszeit.
Allgemeine
§
1478. Insofern jede Ersitzung eine Verjährung in sich begreift,
werden beide mit den vorgeschriebenen Erfordernissen in einem Zeitraume
vollendet. Zur eigentlichen Verjährung aber ist der bloße Nichtgebrauch
eines Rechtes, das an sich schon hätte ausgeübt werden können, durch
dreißig Jahre hinlänglich.
§
1479. Alle Rechte gegen einen Dritten, sie mögen den öffentlichen
Büchern einverleibt sein oder nicht, erlöschen also in der Regel längstens
durch den dreißigjährigen Nichtgebrauch, oder durch ein so lange Zeit
beobachtetes Stillschweigen.
§
1480. Forderungen von rückständigen jährlichen Leistungen,
insbesondere Zinsen, Renten, Unterhaltsbeiträgen, Ausgedingsleistungen,
sowie zur Kapitalstilgung vereinbarten Annuitäten erlöschen in drei
Jahren; das Recht selbst wird durch einen Nichtgebrauch von dreißig Jahren
verjährt.
Ausnahmen
§
1481. Die in dem Familien- und überhaupt in dem Personenrechte
gegründeten Verbindlichkeiten, z. B. den Kindern den unentbehrlichen
Unterhalt zu verschaffen, sowie diejenigen, welche dem oben (§
1459) angeführten Rechte, mit seinem Eigentume frei zu schalten,
zusagen, z. B. die Verbindlichkeit, die Teilung einer gemeinschaftlichen
Sache oder die Grenzbestimmung vornehmen zu lassen, können nicht verjährt
werden.
§
1482. Auf gleiche Weise wird derjenige, welcher ein Recht auf
einem fremden Grunde in Ansehung des Ganzen oder auf verschiedene
beliebige Arten ausüben konnte, bloß dadurch, daß er es durch noch so
lange Zeit nur auf einem Teile des Grundes oder nur auf eine bestimmte
Weise ausübte, in seinem Rechte nicht eingeschränkt; sondern die
Beschränkung muß durch Erwerbung oder Ersitzung des Untersagungs- oder
Hinderungsrechtes bewirkt werden (§
351). Ebendieses ist auch auf den Fall anzuwenden, wenn jemand ein
gegen alle Mitglieder einer Gemeinde zustehendes Recht bisher nur gegen
gewisse Mitglieder derselben ausgeübt hat.
§
1483. Solange der Gläubiger das Pfand in Händen hat, kann ihm die
unterlassene Ausübung des Pfandrechtes nicht eingewendet und das
Pfandrecht nicht verjährt werden. Auch das Recht des Schuldners, sein
Pfand einzulösen, bleibt unverjährt. Insofern aber die Forderung den Wert
des Pfandes übersteigt, kann sie inzwischen durch Verjährung erlöschen.
§
1484. Zur Verjährung solcher Rechte, die nur selten ausgeübt
werden können, wird erfordert, daß während der Verjährungszeit von dreißig
Jahren von drei Gelegenheiten, ein solches Recht auszuüben, kein Gebrauch
gemacht worden sei (§
1471).
§
1485.
(1) In Rücksicht
der in dem
§ 1472
begünstigten Personen werden, wie zur Ersitzung, also auch zur Verjährung,
vierzig Jahre erfordert.
(2) Die allgemeine
Regel, daß ein Recht wegen des Nichtgebrauches erst nach Verlauf von
dreißig oder vierzig Jahren verloren gehe, ist nur auf diejenigen Fälle
anwendbar, für welche das Gesetz nicht einen kürzeren Zeitraum ausgemessen
hat (§
1465).
Besondere
Verjährungszeit
§
1486. In drei Jahren sind verjährt: die Forderungen
1. für Lieferung
von Sachen oder Ausführung von Arbeiten oder sonstige Leistungen in einem
gewerblichen, kaufmännischen oder sonstigen geschäftlichen Betriebe;
2. für Lieferung
land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse in einem Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft;
3. für die
Übernahme zur Beköstigung, Pflege, Heilung, zur Erziehung oder zum
Unterricht durch Personen, die sich damit befassen, oder in Anstalten, die
diesem Zwecke dienen;
4. von Miet- und
Pachtzinsen;
5. der Dienstnehmer
wegen des Entgelts und des Auslagenersatzes aus den Dienstverträgen von
Hilfsarbeitern, Taglöhnern, Dienstboten und allen Privatbediensteten,
sowie der Dienstgeber wegen der auf solche Forderungen gewährten
Vorschüsse;
6. der Ärzte,
Tierärzte, Hebammen, der Privatlehrer, der Rechtsanwälte, Notare,
Patentanwälte und aller anderen zur Besorgung gewisser Angelegenheiten
öffentlich bestellten Personen wegen Entlohnung ihrer Leistungen und
Ersatzes ihrer Auslagen, sowie der Parteien wegen der Vorschüsse an diese
Personen.
§
1486a. Der Anspruch eines Ehegatten auf Abgeltung seiner
Mitwirkung im Erwerb des anderen (§
98) verjährt in sechs Jahren vom Ende des Monats, in dem die Leistung
erbracht worden ist.
§
1487. Die Rechte, eine Erklärung des letzten Willens umzustoßen;
den Pflichtteil oder dessen Ergänzung zu fordern; eine Schenkung wegen
Undankbarkeit des Beschenkten zu widerrufen oder den Beschenkten wegen
Verkürzung des Pflichtteils in Anspruch zu nehmen; einen entgeltlichen
Vertrag wegen Verletzung über die Hälfte aufzuheben, oder die vorgenommene
Teilung eines gemeinschaftlichen Gutes zu bestreiten; und die Forderung
wegen einer bei dem Vertrage unterlaufenen Furcht oder eines Irrtums,
wobei sich der andere vertragmachende Teil keiner List schuldig gemacht
hat, müssen binnen drei Jahren geltend gemacht werden. Nach Verlauf dieser
Zeit sind sie verjährt.
§
1488.
Das Recht der Dienstbarkeit wird durch den Nichtgebrauch verjährt, wenn
sich der verpflichtete Teil der Ausübung der Servitut widersetzt, und der
Berechtigte durch drei aufeinander folgende Jahre sein Recht nicht geltend
gemacht hat.
§
1489. Jede Entschädigungsklage ist in drei Jahren von der Zeit an
verjährt, zu welcher der Schade und die Person des Beschädigers dem
Beschädigten bekannt wurde, der Schade mag durch Übertretung einer
Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht worden
sein. Ist dem Beschädigten der Schade oder die Person des Beschädigers
nicht bekannt geworden oder ist der Schade aus einer oder mehreren
gerichtlich strafbaren Handlungen, die nur vorsätzlich begangen werden
können und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind,
entstanden, so erlischt das Klagerecht nur nach dreißig Jahren.
§
1490.
(1) Klagen über
Ehrenbeleidigungen, die lediglich in Beschimpfungen durch Worte, Schriften
oder Gebärden bestehen, können nach Verlauf eines Jahres nicht mehr
erhoben werden. Besteht aber die Beleidigung in Tätlichkeiten, so dauert
das Klagerecht auf Genugtuung durch drei Jahre.
(2) Auf
Schadenersatzklagen wegen Gefährdung des Kredits, des Erwerbes oder des
Fortkommens eines andern durch Verbreitung unwahrer Tatsachen sind die
Vorschriften des
§ 1489
anzuwenden.
§
1491. Einige Rechte sind von den Gesetzen auf eine noch kürzere
Zeit eingeschränkt. Hierüber kommen die Vorschriften an den Orten, wo
diese Rechte abgehandelt werden, vor.
§
1492. Wie lange das Wechselrecht einem Wechsel zustatten komme,
ist im Wechselgesetz bestimmt.
Einrechnung der
Verjährungszeit des Vorfahrers
§
1493. Wer eine Sache von einem rechtmäßigen und redlichen Besitzer
redlich übernimmt, der ist als Nachfolger berechtigt, die Ersitzungszeit
seines Vorfahrers mit einzurechnen (§
1463). Ebendieses gilt auch von der Verjährungszeit. Bei einer
Ersitzung von dreißig oder vierzig Jahren findet diese Einrechnung auch
ohne einen rechtmäßigen Titel, und bei der eigentlichen Verjährung selbst
ohne guten Glauben, oder schuldlose Unwissenheit statt.
Hemmung der
Verjährung
§
1494. Gegen solche Personen, welche aus Mangel ihrer Geisteskräfte
ihre Rechte selbst zu verwalten unfähig sind, wie gegen Minderjährige oder
Personen, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, kann die Ersitzungs-
oder Verjährungszeit, dafern diesen Personen keine gesetzlichen Vertreter
bestellt sind, nicht anfangen. Die einmal angefangene Ersitzungs- oder
Verjährungszeit läuft zwar fort; sie kann aber nie früher als binnen zwei
Jahren nach den gehobenen Hindernissen vollendet werden.
§
1495. Auch zwischen Ehegatten sowie zwischen Minderjährigen oder
anderen Pflegebefohlenen und den mit der Obsorge betrauten Personen,
Sachwaltern oder Kuratoren kann, solange die Ehe aufrecht ist oder die
Obsorge, Sachwalterschaft oder Kuratel durch dieselbe Person andauert, die
Ersitzung oder Verjährung weder angefangen, noch fortgesetzt werden.147)
Das gilt nicht für die Ansprüche eines Ehegatten auf Abgeltung seiner
Mitwirkung im Erwerb des anderen (§
98); doch wird die Verjährung so lange gehemmt, als zwischen den
Ehegatten ein gerichtliches Verfahren zur Entscheidung über einen Anspruch
im Sinn des
§ 100
anhängig ist und gehörig fortgesetzt wird.
§
1496. Durch Abwesenheit in Zivil- oder Kriegsdiensten, oder durch
gänzlichen Stillstand der Rechtspflege, z. B. in Pest- oder Kriegszeiten,
wird nicht nur der Anfang, sondern solange dieses Hindernis dauert, auch
die Fortsetzung der Ersitzung oder Verjährung gehemmt.
Unterbrechung der
Verjährung
§
1497. Die Ersitzung sowohl, als die Verjährung wird unterbrochen,
wenn derjenige, welcher sich auf dieselbe berufen will, vor dem Verlaufe
der Verjährungszeit entweder ausdrücklich oder stillschweigend das Recht
des andern anerkannt hat, oder wenn er von dem Berechtigten belangt, und
die Klage gehörig fortgesetzt wird. Wird aber die Klage durch einen
rechtskräftigen Spruch für unstatthaft erklärt; so ist die Verjährung für
ununterbrochen zu halten.
Wirkung der Ersitzung
oder Verjährung
§
1498. Wer eine Sache oder ein Recht ersessen hat, kann gegen den
bisherigen Eigentümer bei dem Gerichte die Zuerkennung des Eigentumes
ansuchen, und das zuerkannte Recht, wofern es einen Gegenstand der
öffentlichen Bücher ausmacht, den letzteren einverleiben lassen.
§
1499. Auf gleiche Art kann nach Verlauf der Verjährung der
Verpflichtete die Löschung seiner in den öffentlichen Büchern
eingetragenen Verbindlichkeit, oder die Nichtigerklärung des dem
Berechtigten bisher zugestandenen Rechtes und der darüber ausgestellten
Urkunden erwirken.
§
1500. Das aus der Ersitzung oder Verjährung erworbene Recht kann
aber demjenigen, welcher im Vertrauen auf die öffentlichen Bücher noch vor
der Einverleibung desselben eine Sache oder ein Recht an sich gebracht
hat, zu keinem Nachteile gereichen.
§
1501. Auf die Verjährung ist, ohne Einwendung der Parteien, von
Amts wegen kein Bedacht zu nehmen.
Entsagung oder
Verlängerung der Verjährung
§
1502. Der Verjährung kann weder im voraus entsagt, noch kann eine
längere Verjährungsfrist, als durch die Gesetze bestimmt ist, bedungen
werden.
1) §
21 Abs 2 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur Übergangsregelung
hinsichtlich § 21 Abs 2 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis dahin lautet
Abs 2 wie folgt:„(2) Unter Minderjährigen sind Personen zu verstehen, die
das neunzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben; inwieweit die
Minderjährigkeit verlängert oder verkürzt werden kann, wird besonders
bestimmt. Innerhalb der Gruppe der Minderjährigen sind unter Unmündigen
diejenigen zu verstehen, die das vierzehnte, und unter Kindern diejenigen,
die das siebente Lebensjahr noch nicht vollendet haben.”
2) §
138 Abs 1 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur Übergangsregelung
hinsichtlich § 138 Abs 1 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis dahin
lautet Abs 1 wie folgt:„(1) Wird ein Kind nach der Eheschließung und vor
Ablauf des 302. Tages nach Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe seiner
Mutter geboren, so wird vermutet, daß es ehelich ist. Diese Vermutung kann
nur durch eine gerichtliche Entscheidung widerlegt werden, mit der
festgestellt wird, daß das Kind nicht vom Ehemann der Mutter abstammt.”
3) §
144 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich §
144 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 144 wie folgt:„§
144. Die Eltern haben das minderjährige Kind zu pflegen und zu
erziehen, sein Vermögen zu verwalten und es zu vertreten; sie sollen bei
Ausübung dieser Rechte und Erfüllung dieser Pflichten einvernehmlich
vorgehen. Zur Pflege des Kindes ist bei Fehlen eines Einvernehmens vor
allem derjenige Elternteil berechtigt und verpflichtet, der den Haushalt
führt, in dem das Kind betreut wird.”
4) §
145 Abs 1 erster und zweiter Satz treten mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 145 Abs 1 erster und zweiter Satz siehe
Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis dahin lautet Abs 1 erster und zweiter Satz
wie folgt:„(1) Ist ein Elternteil, dem die Obsorge für das Kind gemeinsam
mit dem anderen Elternteil zugekommen ist, gestorben, ist sein Aufenthalt
seit mindestens sechs Monaten unbekannt, kann die Verbindung mit ihm nicht
oder nur mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten hergestellt werden
oder ist ihm die Obsorge ganz oder teilweise entzogen, so kommt sie dem
anderen Elternteil insoweit allein zu. Ist in dieser Weise der Elternteil,
dem die Obsorge allein zukommt, betroffen, so hat das Gericht unter
Beachtung des Wohles des Kindes zu entscheiden, ob die Obsorge ganz oder
teilweise dem anderen Elternteil oder ob und welchem Großelternpaar
(Großelternteil) sie zukommen soll; letzteres gilt auch, wenn beide
Elternteile betroffen sind.”
5) §
145 Abs 3 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur Übergangsregelung
hinsichtlich § 145 Abs 3 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
6) §
145b tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich §
145b siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 145b wie folgt:„§
145b. (1) Soweit in einem Teilbereich die Vermögensverwaltung, die
Vertretung oder die Pflege und Erziehung keiner Person zusteht, der die
Obsorge im übrigen zukommt, ist erforderlichenfalls ein Sachwalter zu
bestellen.
(2) Sind einzelne Handlungen der Obsorge zur Wahrung des Wohles des Kindes
dringend nötig und liegen die Voraussetzungen des § 145 Abs. 1 erster Satz
bei den Personen vor, denen bezüglich dieser Handlungen die Obsorge
zukommt oder bis zu ihrem Tod zugekommen ist, so ist ebenfalls ein
Sachwalter zu bestellen.”
7) §
145c tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich §
145c siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 145c wie folgt:„§
145c. (1) Hat ein Dritter einem minderjährigen Kind ein Vermögen
zugewendet und einen Elternteil von der Verwaltung dieses Vermögens
ausgeschlossen, so stehen die Verwaltung dieses Vermögens und die
Vertretung in diesem Bereich dem anderen Elternteil allein zu. Hat der
Dritte beide Eltern von der Verwaltung ausgeschlossen oder ist der andere
Elternteil in der Weise des § 145 Abs. Abs. 1 erster Satz betroffen, so
gehen diese Befugnisse auf den Vormund, wenn ein solcher zu bestellen ist
(§ 187), sonst auf einen vom Gericht zu bestellenden Sachwalter über.
(2) Hat der Dritte einen Verwalter für das zugewendete Vermögen bestimmt,
so ist dieser, wenn er geeignet ist, vom Gericht für dieses Vermögen unter
Ausschließung anderer von der Verwaltung zum Sachwalter zu bestellen.
(3) Hat ein Elternteil dem Kind ein Vermögen zugewendet und den anderen
Elternteil von der Verwaltung ausgeschlossen oder einen Verwalter für das
zugewendete Vermögen bestimmt, so gelten die Abs. 1 beziehungsweise 2
sinngemäß.”
8) §
146 Abs 3 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur Übergangsregelung
hinsichtlich § 146 Abs 3 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
9) §
146c tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich §
146c siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
10)
§ 146d tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 146d siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
11)
§ 148 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 148 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 148 wie folgt:„§ 148. (1) Stehen einem Elternteil
nicht die Pflege und Erziehung des minderjährigen Kindes zu, so hat er
doch das Recht, mit dem Kind persönlich zu verkehren. Das Gericht hat auf
Antrag die Ausübung dieses Rechtes in einer dem Wohl des Kindes gemäßen
Weise zu regeln oder nötigenfalls, besonders wenn die Beziehungen des
Kindes zu dem Elternteil, bei dem es aufwächst, unerträglich gestört
würden, ganz zu untersagen.
(2) Die Großeltern haben das Recht, mit dem Kind persönlich zu verkehren,
soweit dadurch nicht die Ehe oder das Familienleben der Eltern (eines
Elternteils) oder deren Beziehungen zu dem Kind gestört werden; im übrigen
gilt der Abs. 1 zweiter Satz sinngemäß.”
12)
§ 149 Abs 1 zweiter Satz tritt mit 1. Juli 2001 in
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 149 Abs 1 zweiter Satz siehe
Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis dahin lautet Abs 1 zweiter Satz wie
folgt:„Sie haben es in seinem Bestand zu erhalten und nach Möglichkeit zu
vermehren; Geld ist nach den Vorschriften über die Anlegung von Mündelgeld
anzulegen.”
13)
§ 150 Abs 1 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 150 Abs 1 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet Abs 1 wie folgt:„(1) Die Eltern haben über das
Vermögen des minderjährigen Kindes dem Gericht jährlich Rechnung zu legen;
über die Erträgnisse jedoch nur, soweit sie nicht für den Unterhalt des
Kindes verwendet worden sind.”
14)
§ 150 Abs 2 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 150 Abs 2 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet Abs 2 wie folgt:„(2) Das Gericht kann die Eltern
von der Rechnungslegung ganz oder zum Teil befreien, soweit keine Bedenken
bestehen, daß sie das Vermögen des Kindes ordentlich verwalten werden;
dies ist in der Regel zu vermuten, wenn sie selbst das Vermögen oder
dessen überwiegenden Teil dem Kind zugewendet haben.”
15)
§ 153 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 153 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 153 wie folgt:„§ 153. Soweit einem minderjährigen
Kind nicht bereits früher ein Verschulden zugerechnet werden kann (§
1310), wird es, vorbehaltlich des § 866, mit der Erreichung der Mündigkeit
nach den schadenersatzrechtlichen Bestimmungen verschuldensfähig.”
16)
Versehen des Gesetzgebers: richtigerweise Beistrich
nach dem Wort „Erwerb”.
17)
§ 154 Abs 3 zweiter Satz tritt mit 1. Juli 2001 in
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 154 Abs 3 zweiter Satz siehe
Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis dahin lautet Abs 3 zweiter Satz wie
folgt:„(3) Unter dieser Voraussetzung gehören dazu besonders die
Veräußerung oder Belastung von Liegenschaften, die Gründung, der Erwerb,
die Umwandlung, Veräußerung oder Auflösung sowie die Änderung des
Gegenstandes eines Unternehmens, der Eintritt in eine oder die Umwandlung
einer Gesellschaft oder Genossenschaft, der Verzicht auf ein Erbrecht, die
unbedingte Annahme oder die Ausschlagung einer Erbschaft, die Annahme
einer mit Belastungen verbundenen Schenkung oder die Ablehnung eines
Schenkungsanbots, die Anlegung von Geld mit Ausnahme der in den §§ 230a
und 230b geregelten Arten sowie die Erhebung einer Klage und alle
verfahrensrechtlichen Verfügungen, die den Verfahrensgegenstand an sich
betreffen.”
18)
§ 154 Abs 4 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 154 Abs 4 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001.
19)
§ 154b tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 154b siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
20)
§ 155 erster Satz tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 155 erster Satz siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 155 erster Satz wie folgt:„ Wird ein Kind
nach Ablauf des 302. Tages nach Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe
seiner Mutter geboren, so wird vermutet, daß es unehelich ist.”
21)
§ 159 Abs 2 dritter Satz tritt mit 1. Juli 2001 in
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 159 Abs 2 dritter Satz siehe
Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis dahin lautet Abs 2 dritter Satz wie
folgt:„Über den Antrag entscheidet das Vormundschaftsgericht.”
22)
Die Ersetzung der Zahl „302” durch die Zahl „300” tritt
mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 163 Abs 1
erster Satz siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
23)
§ 163c Abs 2 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 163c Abs 2 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet Abs 2 wie folgt:„(2) Das Anerkenntnis soll eine
genaue Bezeichnung des Anerkennenden, der Mutter und des Kindes, sofern es
bereits geboren ist, sowie des Zeitpunktes der Beiwohnung enthalten.”
24)
§ 163e tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 163e siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
25)
Die Aufhebung der Wortfolge „, bereits eine Vaterschaft
zu dem Kind festgestellt ist” tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 164 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
26)
§ 166 erster Satz tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 166 erster Satz siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 166 erster Satz wie folgt:„Die Obsorge
für das uneheliche Kind kommt der Mutter allein zu.”
27)
§ 167 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 167 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 167 wie folgt:„§ 167. Das Gericht hat auf
gemeinsamen Antrag der Eltern zu verfügen, daß ihnen beiden die Obsorge
für das Kind zukommt, wenn die Eltern mit dem Kind in dauernder häuslicher
Gemeinschaft leben und diese Verfügung für das Wohl des Kindes nicht
nachteilig ist. Hebt ein Elternteil die häusliche Gemeinschaft nicht bloß
vorübergehend auf, so ist § 177 Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden.”
28)
§ 172 Abs 2 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 172 Abs 2 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001.
29)
§ 173 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 173 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 173 samt Überschrift wie
folgt:„Verlängerung und Verkürzung der Minderjährigkeit
§ 173. (1) Das Gericht hat von Amts wegen oder auf Antrag des
Vaters, der Mutter oder des gesetzlichen Vertreters die Minderjährigkeit
des Kindes noch vor dem Eintritt der Volljährigkeit zu verlängern, wenn
es, besonders infolge merkbar verzögerter Entwicklung, seine
Angelegenheiten nicht ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst zu
besorgen vermag.
(2) Ein Recht auf Anhörung haben die Eltern sowie die Personen, die das
Recht auf gesetzliche Vertretung des Kindes haben, falls sie nicht selbst
den Antrag gestellt haben, und das Kind. Die Anhörung der Genannten, außer
des Kindes, entfällt, wenn sie nicht oder nur mit unverhältnismäßig großen
Schwierigkeiten durchgeführt werden könnte.
(3) Die verlängerte Minderjährigkeit endet mit der Vollendung des
einundzwanzigsten Lebensjahres.”
30)
§ 174 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 174 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 174 wie folgt:„§ 174. (1) Das Gericht hat mit
Zustimmung des minderjährigen Kindes auf Antrag des Vaters, der Mutter
oder des gesetzlichen Vertreters oder auf Antrag des Kindes selbst dessen
Minderjährigkeit zu verkürzen (Volljährigerklärung), wenn das Kind das
achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und zur selbständigen und gehörigen
Besorgung seiner Angelegenheiten reif erscheint.
(2) Ein Recht auf Anhörung haben die Eltern sowie die Personen, die das
Recht auf gesetzliche Vertretung des Kindes haben, falls sie nicht selbst
den Antrag gestellt haben. Die Anhörung entfällt, wenn sie nicht oder nur
mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten durchgeführt werden könnte.”
31)
§ 175 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 175 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 175 wie folgt:„§ 175. (1) Heiratet ein
minderjähriges Kind, so wird es mit der Eheschließung, frühestens aber mit
der Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs, volljährig und bleibt dies
auch, wenn die Ehe in der Folge aufgelöst oder für nichtig erklärt wird.
(2) Ein minderjähriges Kind, das vor Vollendung des achtzehnten
Lebensjahrs heiratet, steht bis dahin, solange die Ehe dauert,
hinsichtlich seiner persönlichen Verhältnisse einem Volljährigen gleich.”
32)
§ 176 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 176 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 176 wie folgt:„§ 176. (1) Gefährden die Eltern durch
ihr Verhalten das Wohl des minderjährigen Kindes, so hat das Gericht, von
wem immer es angerufen wird, die zur Sicherung des Wohles des Kindes
nötigen Verfügungen zu treffen; eine solche Verfügung kann auf Antrag
eines Elternteils auch ergehen, wenn die Eltern in einer wichtigen
Angelegenheit des Kindes kein Einvernehmen erzielen. Besonders darf das
Gericht die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise, auch gesetzlich
vorgesehene Einwilligungs- und Zustimmungsrechte, entziehen. Im Einzelfall
hat das Gericht auch eine gesetzlich erforderliche Einwilligung oder
Zustimmung eines Elternteils zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten
Gründe für die Weigerung vorliegen.
(2) Die Entziehung der Pflege und Erziehung oder der Verwaltung des
Vermögens des Kindes schließt die Entziehung der gesetzlichen Vertretung
in dem jeweiligen Bereich mit ein; die gesetzliche Vertretung kann für
sich allein entzogen werden, wenn der betroffene Elternteil seine übrigen
Pflichten erfüllt.”
33)
§ 176a tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 176a siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 176a wie folgt:„§ 176a. Ist das Wohl des Kindes
gefährdet und deshalb die gänzliche Entfernung aus seiner bisherigen
Umgebung gegen den Willen der Erziehungsberechtigten notwendig und ist
seine Unterbringung bei Verwandten oder anderen geeigneten nahestehenden
Personen nicht möglich, so hat das Gericht die Obsorge für das Kind dem
Jugendwohlfahrtsträger ganz oder teilweise zu übertragen. Der
Jugendwohlfahrtsträger darf deren Ausübung Dritten übertragen.”
34)
§ 176b tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 176b siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 176b wie folgt:„§ 176b. Durch eine Verfügung
nach den §§ 176 und 176a darf das Gericht die Obsorge nur so weit
beschränken, als dies zur Sicherung des Wohles des Kindes nötig ist.”
35)
§ 177 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 177 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 177 wie folgt:„§ 177. (1) Ist die Ehe der Eltern
eines minderjährigen ehelichen Kindes geschieden, aufgehoben oder für
nichtig erklärt worden oder leben die Eltern nicht bloß vorübergehend
getrennt, so können sie dem Gericht eine Vereinbarung darüber
unterbreiten, wem von ihnen künftig die Obsorge für das Kind allein
zukommen soll. Das Gericht hat die Vereinbarung zu genehmigen, wenn sie
dem Wohl des Kindes entspricht.
(2) Kommt innerhalb angemessener Frist eine Vereinbarung nicht zustande
oder entspricht sie nicht dem Wohl des Kindes, so hat das Gericht, im Fall
nicht bloß vorübergehender Trennung der Eltern jedoch nur auf Antrag eines
Elternteils, zu entscheiden, welchem Elternteil die Obsorge für das Kind
künftig allein zukommt.
(3) Der § 167 gilt entsprechend.”
36)
§ 177a tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 177a siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
37)
§ 177b tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 177b siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
38)
§ 178 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft.
Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 178 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 178 samt Überschrift wie folgt:„Mindestrechte der
Eltern
§ 178. (1) Soweit einem Elternteil die Obsorge nicht zukommt, hat
er, außer dem Recht auf persönlichen Verkehr, das Recht, von
außergewöhnlichen Umständen, die die Person des Kindes betreffen, und von
beabsichtigten Maßnahmen zu den im § 154 Abs. 2 und 3 genannten
Angelegenheiten von demjenigen, dem die Obsorge zukommt, rechtzeitig
verständigt zu werden und sich zu diesen, wie auch zu anderen wichtigen
Maßnahmen, in angemessener Frist zu äußern; dem Vater eines unehelichen
Kindes, dem die Obsorge nie zugekommen ist, steht dieses Recht nur
bezüglich wichtiger Maßnahmen der Pflege und Erziehung zu. Diese Äußerung
ist zu berücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte Wunsch dem Wohl des
Kindes besser entspricht.
(2) Würde die Wahrnehmung dieser Mindestrechte das Wohl des Kindes
ernstlich gefährden, so hat das Gericht sie einzuschränken oder zu
entziehen.”
39)
§ 178b samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 178b siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 178b samt Überschrift wie
folgt:„Berücksichtigung der Meinung des Kindes
§ 178b. Vor Verfügungen, die die Pflege oder Erziehung eines Kindes
betreffen, hat das Gericht das Kind tunlichst persönlich zu hören; ein
noch nicht zehnjähriges Kind kann auch durch den Jugendwohlfahrtsträger
oder in anderer geeigneter Weise befragt werden. Das Kind ist nicht zu
hören, wenn durch die Befragung oder durch einen Aufschub der Verfügung
das Wohl des Kindes gefährdet wäre oder im Hinblick auf das Alter oder die
Entwicklung des Kindes eine Meinungsäußerung nicht zu erwarten ist.”
40)
§ 186 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft.
Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 186 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 186 samt Überschrift wie folgt:„2. Das Pflegeverhältnis
§ 186. (1) Pflegeeltern üben ihre Rechte auf Grund einer
Ermächtigung durch die unmittelbar Erziehungsberechtigten (§ 137a) oder
durch den Jugendwohlfahrtsträger (§ 176a) aus.
(2) Pflegeeltern haben das Recht, in den die Person des Kindes
betreffenden Vormundschafts- und Pflegschaftsverfahren Anträge zu
stellen.”
41)
§ 186a Abs 1 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 186a Abs 1 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet Abs 1 wie folgt:„(1) Das Gericht hat Pflegeeltern
auf ihren Antrag die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise zu
übertragen, wenn eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und
Kindern nahekommende Beziehung besteht, das Pflegeverhältnis nicht nur für
kurze Zeit beabsichtigt ist und die Übertragung dem Wohl des Kindes
entspricht. Die Regelungen über die Obsorge gelten dann für die
Pflegeeltern.”
42)
§ 186a Abs 2 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 186a Abs 2 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet Abs 2 wie folgt:„(2) Haben die Eltern oder
Großeltern die Obsorge oder haben sie diese gehabt und stimmen sie der
Übertragung nicht zu, so darf diese nur verfügt werden, wenn ohne sie das
Wohl des Kindes gefährdet wäre.”
43)
§ 187 samt Überschriften tritt mit 1. Juli 2001 in
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 187 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 187 samt Überschriften wie folgt:„Von den
Vormundschaften und Kuratelen
Bestimmung der Vormundschaft und Kuratel
§ 187. Einem Minderjährigen ist ein Vormund zu bestellen, wenn
nicht wenigstens einer Person die beschränkte gesetzliche Vertretung im
Rahmen der Obsorge zusteht. Inwieweit für Personen, die ihre
Angelegenheiten selbst gehörig zu besorgen nicht vermögen, ein Kurator,
ein Sachwalter oder ein anderer gesetzlicher Vertreter zu bestellen ist,
wird besonders bestimmt.”
44)
§ 188 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 188 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 188 samt Überschrift wie folgt:„Unterschied zwischen der
Vormundschaft und Kuratel
§ 188. Ein Vormund hat vorzüglich für die Person des Minderjährigen
zu sorgen, zugleich aber dessen Vermögen zu verwalten. Ein Kurator wird
zur Besorgung der Angelegenheiten derjenigen gebraucht, welche dieselben
aus einem andern Grunde, als jenem der Minderjährigkeit, selbst zu
besorgen unfähig sind.”
45)
§ 189 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 189 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 189 samt Überschriften wie folgt:„I. Von der Vormundschaft.
Veranlassung zur Bestellung
§ 189. Wenn der Fall eintritt, daß einem Minderjährigen, er sei von
ehelicher oder unehelicher Geburt, ein Vormund bestellt werden muß; sind
die Verwandten des Minderjährigen oder andere mit ihm in nahem
Verhältnisse stehende Personen unter angemessener Ahndung verbunden, dem
Gerichte, unter dessen Gerichtsbarkeit der Minderjährige steht, die
Anzeige zu machen. Auch die politischen Obrigkeiten, die weltlichen und
geistlichen Vorsteher der Gemeinden, müssen sorgen, daß das Gericht
hiervon benachrichtigt werde.”
46)
§ 190 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 190 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 190 samt Überschrift wie folgt:„Wer den
Vormund zunächst bestelle
§ 190. Das Gericht muß, sobald es zur Kenntnis gelangt ist, von
Amts wegen die Bestellung eines tauglichen Vormundes vornehmen.”
47)
§ 191 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 191 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 191 samt Überschrift wie
folgt:„Notwendige Entschuldigung von einer Vormundschaft überhaupt;
§ 191. Zur Übernahme einer Vormundschaft sind überhaupt unfähig
1. Minderjährige und Personen, die aus einem anderen Grund als dem ihrer
Minderjährigkeit alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten selbst gehörig
zu besorgen nicht vermögen;
2. Personen, von denen, besonders auch wegen der durch eine
strafgerichtliche Verurteilung zutage getretenen Veranlagung oder
Eigenschaften, eine anständige Erziehung des Mündels oder eine sorgfältige
Verwaltung des Mündelvermögens nicht zu erwarten ist.”
48)
§ 192 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 192 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 192 wie folgt:„§ 192. Auch Ordensgeistlichen und
Ausländern soll in der Regel keine Vormundschaft aufgetragen werden.”
49)
§ 193 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 193 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 193 wie folgt:„§ 193. (1) Ein Ehegatte bedarf zur
Übernahme einer Vormundschaft der Zustimmung des anderen Ehegatten. Das
Gericht hat von der Zustimmung abzusehen, wenn der andere Ehegatte diese
aus nicht gerechtfertigten Gründen verweigert. Als ein gerechtfertigter
Grund ist besonders eine Gefährdung der Ehe oder des Familienlebens durch
die Vormundschaft anzusehen.
(2) Der Zustimmung nach Abs. 1 bedarf es nicht, wenn der andere Ehegatte
unbekannten Aufenthaltes oder nicht nur vorübergehend zu einer
verständigen Äußerung unfähig ist.”
50)
§ 194 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 194 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 194 samt Überschrift wie folgt:„oder von
einer bestimmten Vormundschaft
§ 194. Zum Vormund darf nicht bestellt werden, wen ein Elternteil
als gesetzlicher Vertreter von der Vormundschaft ausgeschlossen hat, wer
mit den Eltern des Minderjährigen oder mit ihm selbst in Feindschaft
gelebt hat oder wer mit dem Minderjährigen in einem Rechtsstreit
verwickelt ist. Ob eine Person infolge des Bestandes unberichtigter
Forderungen zwischen ihr und dem Minderjährigen zur Übernahme der
Vormundschaft ungeeignet erscheint, hat das Gericht zu beurteilen.”
51)
§ 195 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 195 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 195 samt Überschrift wie
folgt:„Freiwillige Entschuldigungsgründe
§ 195. Wider ihren Willen können zur Übernahme einer Vormundschaft
nicht angehalten werden: Geistliche, in dauernder aktiver Dienstleistung
stehende Militärpersonen und öffentliche Beamte, ebenso derjenige, der
sechzig Jahre alt ist, dem die Obsorge über fünf Kinder oder Enkel obliegt
oder der schon eine mühsame Vormundschaft oder drei kleinere zu besorgen
hat, endlich wer dieses Amt wegen der Entfernung seines Wohnsitzes von dem
Vormundschaftsgerichte nur schwer oder mit erheblichen Kosten ausüben
könnte.”
52)
§ 196 samt Überschriften tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 196 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 196 samt Überschriften wie folgt:„Arten
der Berufung zur Vormundschaft:
1. testamentarische;
§ 196. (1) Zum Vormund ist, wenn er geeignet ist, in erster Linie
derjenige zu bestellen, den ein Elternteil als gesetzlicher Vertreter
letztwillig berufen hat. Hat ein Elternteil aber bloß einen Verwalter für
das Vermögen des Minderjährigen letztwillig berufen, so wird vermutet, daß
er ihn zum Vormund überhaupt habe berufen wollen; sonst ist, sofern nicht
der Fall des § 145c Abs. 3 vorliegt, der berufene Verwalter, wenn er
geeignet ist, nur zum Sachwalter für das Vermögen zu bestellen.
(2) Haben die Eltern letztwillig Unterschiedliches verfügt, so ist
derjenige zum Vormund beziehungsweise Sachwalter zu bestellen, der besser
geeignet ist.”
53)
§ 198 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 198 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 198 samt Überschrift wie folgt:„2.
gesetzliche;
§ 198. Ist letztwillig kein oder kein geeigneter Vormund für ein
Kind berufen worden, so ist der nächste geeignete Verwandte zum Vormund zu
bestellen.”
54)
§ 199 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 199 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 199 samt Überschrift wie folgt:„3.
gerichtliche
§ 199. Kann eine Vormundschaft auf die angeführte Art nicht
bestellt werden, so hängt es von dem Gerichte ab, wen es mit Rücksicht auf
Fähigkeit, Stand, Vermögen und Ansässigkeit zum Vormunde ernennen will.”
55)
§ 200 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 200 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 200 samt Überschrift wie folgt:„Form der
wirklichen Bestellung des Vormundes
§ 200. Jeden ernannten Vormund, ohne Unterschied, hat das
vormundschaftliche Gericht sogleich anzuweisen, daß er die Vormundschaft
übernehme. Der Vormund, ob er gleich für seine Person unter einer andern
Gerichtsbarkeit steht, ist schuldig, die Vormundschaft zu übernehmen und
wird in Rücksicht auf alle zu diesem Amte gehörige Angelegenheiten der
vormundschaftlichen Behörde unterworfen.”
56)
§ 201 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 201 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 201 samt Überschrift wie folgt:„Form, die
Bestellung abzulehnen
§ 201. Glaubt derjenige, welchen das Gericht zur Vormundschaft
berufen hat, daß er zu diesem Amte nicht geschickt sei; oder, daß ihn das
Gesetz davon frei spreche, so muß er sich innerhalb vierzehn Tagen, von
der Zeit des ihm bekannt gemachten gerichtlichen Auftrages, an das
vormundschaftliche Gericht [, oder, wenn er demselben für seine Person
nicht unterworfen ist, an seine persönliche Gerichtsstelle] wenden [,
welche seine Gründe mit ihrem Gutachten begleiten und dem
vormundschaftlichen Gerichte zur Entscheidung vorlegen soll].”
57)
§ 202 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 202 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 202 samt Überschrift wie
folgt:„Verantwortlichkeit des Vormundes und des Gerichtes in Rücksicht
dieses Gegenstandes
§ 202. Wer seine Untauglichkeit zur Vormundschaft verhehlt, hat [,
so wie das Gericht, das wissentlich einen nach dem Gesetze untauglichen
Vormund ernennt,] allen dem Minderjährigen dadurch entstandenen Schaden
und entgangenen Nutzen zu verantworten.”
58)
§ 203 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 203 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 203 wie folgt:„§ 203. Dieser Verantwortung setzt
sich auch derjenige aus, welcher ohne gegründete Ursache sich weigert,
eine Vormundschaft zu übernehmen, und er soll überdies durch angemessene
Zwangsmittel dazu angehalten werden.”
59)
§ 204 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 204 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 204 samt Überschrift wie folgt:„Antritt
der Vormundschaft
§ 204. Man kann das vormundschaftliche Amt nur nach einem von dem
gehörigen Gerichtsstande dazu erhaltenen Auftrage übernehmen. Wer sich
eigenmächtig in eine Vormundschaft eindringt, ist verbunden, allen dem
Minderjährigen dadurch erwachsenen Schaden zu ersetzen.”
60)
§ 205 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 205 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 205 samt Überschrift wie
folgt:„Angelobung
§ 205. Jeder Vormund muß mit Handschlag geloben, daß er den
Minderjährigen zur Rechtschaffenheit, Gottesfurcht und Tugend anführen,
daß er ihn dem Stande gemäß als einen brauchbaren Bürger erziehen, vor
Gericht und außer demselben vertreten, das Vermögen getreulich und emsig
verwalten, und sich in allem nach Vorschrift der Gesetze verhalten wolle.”
61)
§ 206 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 206 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 206 samt Überschrift wie folgt:„Urkunde
§ 206. Jedem Vormund hat das Gericht eine Urkunde über seine
Bestellung auszufertigen.”
62)
§ 209 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 209 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 209 samt Überschrift wie
folgt:„Ausschließung des Vormundes von der Vermögensverwaltung
§ 209. Hat jemand einem Minderjährigen, der unter Vormundschaft
steht, ein Vermögen zugewendet und den Vormund von der Verwaltung dieses
Vermögens ausgeschlossen oder einen Verwalter für das zugewendete Vermögen
bestimmt, so gilt der § 145c, sofern er nicht unmittelbar anzuwenden ist,
sinngemäß.”
63)
§ 210 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 210 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 210 samt Überschrift wie folgt:„Stellung
mehrerer Vormünder
§ 210. Sind mehrere Vormünder ernannt worden, so können sie zwar
das Vermögen des Minderjährigen gemeinschaftlich oder teilweise verwalten.
Verwalten sie es aber gemeinschaftlich, oder teilen sie die Verwaltung
ohne Genehmhaltung des Gerichtes unter sich; so haftet jeder einzelne für
den ganzen dem Minderjährigen erwachsenden Schaden. Immer muß auch das
Gericht veranstalten, daß die Person des Minderjährigen und die
Hauptführung der Geschäfte nur von einem besorgt werde.”
64)
§ 211 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 211 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 211 wie folgt:„§ 211. Wird ein Kind im Inland
geboren und kommen die Vermögensverwaltung sowie die Vertretung keinem
Elternteil zu oder wird ein minderjähriges Kind im Inland gefunden und
sind dessen Eltern unbekannt, so ist der Jugendwohlfahrtsträger bis zu
einer anderen Entscheidung des Gerichtes Vormund des Kindes.”
65)
§ 212 Abs 2 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 212 Abs 2 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet Abs 2 wie folgt:„(2) Für die Festsetzung oder
Durchsetzung der Unterhaltsansprüche des Kindes sowie gegebenenfalls für
die Feststellung der Vaterschaft ist der Jugendwohlfahrtsträger Sachwalter
des Kindes, wenn die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
vorliegt.”
66)
§ 212 Abs 3 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 212 Abs 3 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet Abs 3 wie folgt:„(3) Für andere Angelegenheiten ist
der Jugendwohlfahrtsträger Sachwalter des Kindes, wenn er sich zur
Vertretung bereit erklärt und die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters vorliegt.”
67)
§ 212 Abs 5 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 212 Abs 5 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet Abs 5 wie folgt:„(5) Die Vertretungsbefugnis des
Jugendwohlfahrtsträgers endet, wenn der gesetzliche Vertreter seine
Zustimmung schriftlich widerruft, der Jugendwohlfahrtsträger seine
Erklärung nach Abs. 3 zurücknimmt oder das Gericht den
Jugendwohlfahrtsträger auf dessen Antrag als Sachwalter enthebt, weil er
zur Wahrung der Rechte und zur Durchsetzung der Ansprüche des Kindes nach
Lage des Falles nichts mehr beizutragen vermag.”
68)
§ 213 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 213 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 213 wie folgt:„§ 213. Ist einem Minderjährigen ein
Vormund oder ein Sachwalter zu bestellen und läßt sich eine hiefür
geeignete Person nicht finden, so hat das Gericht den
Jugendwohlfahrtsträger zu bestellen.”
69)
§ 214 Abs 1 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 214 Abs 1 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet Abs 1 wie folgt:„(1) Die §§ 203, 205, 206, 216 Abs.
2, 237 zweiter Satz, 266 und 267 gelten für den Jugendwohlfahrtsträger
nicht. Dieser ist vor der Anlegung des Vermögens eines Minderjährigen nur
im Fall des § 230e verpflichtet, die Zustimmung des Gerichtes einzuholen.”
70)
§ 215 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 215 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 215 wie folgt:„§ 215. (1) Der Jugendwohlfahrtsträger
hat die zur Wahrung des Wohles eines Minderjährigen erforderlichen
gerichtlichen Verfügungen im Bereich der Obsorge zu beantragen. Bei Gefahr
im Verzug kann er die erforderlichen Maßnahmen der Pflege und Erziehung
als Sachwalter vorläufig mit Wirksamkeit bis zur gerichtlichen
Entscheidung selbst treffen, wenn er unverzüglich, jedenfalls aber
innerhalb von acht Tagen, die erforderlichen gerichtlichen Verfügungen
beantragt. Eine einstweilige Verfügung nach § 382b EO und deren Vollzug
nach § 382d EO kann der Jugendwohlfahrtsträger als Sachwalter des
Minderjährigen beantragen, wenn der sonstige gesetzliche Vertreter einen
erforderlichen Antrag nicht unverzüglich gestellt hat; § 212 Abs. 4 gilt
hiefür entsprechend.
(2) Der Jugendwohlfahrtsträger ist erforderlichenfalls vor Verfügungen,
die die Pflege und Erziehung eines Minderjährigen betreffen, zu hören, es
sei denn, daß durch den damit verbundenen Aufschub der Verfügung das Wohl
des Kindes gefährdet wäre. Auf Ersuchen des Gerichtes hat der
Jugendwohlfahrtsträger bei der Befragung eines Kindes mitzuwirken oder
eine solche selbst vorzunehmen.”
71)
§ 215a tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 215a siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 215a wie folgt:„§ 215a. Sofern nicht anderes
angeordnet ist, fallen die Aufgaben dem Jugendwohlfahrtsträger zu, in
dessen Sprengel der Minderjährige seinen gewöhnlichen Aufenthalt, mangels
eines solchen im Inland seinen Aufenthalt hat. Wechselt der Minderjährige
seinen Aufenthalt in den Sprengel eines anderen Jugendwohlfahrtsträgers,
so kann der Jugendwohlfahrtsträger seine Aufgaben dem anderen mit dessen
Zustimmung übertragen. Hievon ist das Gericht zu verständigen, wenn es mit
Angelegenheiten des Minderjährigen bereits befaßt war.”
72)
§ 216 samt Überschriften treten mit 1. Juli 2001 in
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 216 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 216 samt Überschriften wie
folgt:„Besondere Pflichten und Rechte des Vormundes:
a) in Rücksicht der Erziehung der Person;
§ 216. (1) Stehen die Pflege und Erziehung eines Minderjährigen
keiner Person zu, der die Obsorge zukommt, so stehen sie dem Vormund zu.
(2) Soweit nicht anderes bestimmt ist, hat der Vormund in wichtigen, die
Person des Kindes betreffenden Angelegenheiten die Genehmigung des
Gerichtes einzuholen.”
73)
§ 217 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 217 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 217 samt Überschrift wie
folgt:„Entsprechende Verbindlichkeit des Pflegebefohlenen
§ 217. Der Minderjährige ist seinem Vormunde Ehrerbietung und
Folgsamkeit schuldig; er ist aber auch berechtigt, sich bei seinen
nächsten Verwandten, oder bei der gerichtlichen Behörde zu beschweren,
wenn der Vormund seine Macht auf was immer für eine Art mißbrauchen, oder
die Pflichten der nötigen Obsorge und Pflege hintansetzen würde. Auch den
Verwandten des Minderjährigen und jedem, der hiervon Kenntnis erhält,
steht die Anzeige bevor. An diese Behörde hat sich auch der Vormund zu
wenden, wenn er den Vergehungen des Minderjährigen durch die zur Erziehung
ihm eingeräumte Gewalt Einhalt zu tun nicht vermag.”
74)
§ 222 samt Überschriften tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 222 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 222 samt Überschriften wie
folgt:„Besondere Pflichten der Vormundschaft:
b) in Rücksicht der Vermögensverwaltung
Erforschung und Sicherstellung des Vermögens,
§ 222. Die dem vormundschaftlichen Gerichte über das Vermögen des
Waisen anvertraute Obsorge fordert, daß es zuerst desselben Vermögen zu
erforschen und es durch Sperre, durch Inventur und Schätzung
sicherzustellen suche.”
75)
§ 223 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 223 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 223 samt Überschrift wie folgt:„durch die
Sperre und Inventur;
§ 223. Gerätschaften werden durch gerichtliche Sperre in Verwahrung
genommen, wenn es zur Sicherstellung notwendig ist. Ein Verzeichnis des
Vermögens des Minderjährigen muß stets errichtet werden.”
76)
§ 224 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 224 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 224 samt Überschrift wie folgt:„dann
durch die Schätzung des Vermögens entweder unmittelbar von dem
vormundschaftlichen Gerichte,
§ 224. Das Verzeichnis des Vermögens und die Schätzung der
beweglichen Sachen müssen ohne Zeitverlust, allenfalls auch vor Bestellung
eines Vormundes, vorgenommen werden. Das Inventarium wird bei den
Verlassenschaftsakten aufbewahrt und dem Vormunde eine beglaubigte
Abschrift davon mitgeteilt. Die Schätzung des unbeweglichen Vermögens muß,
sobald es tunlich ist, vorgenommen werden; sie kann aber auch, wenn der
Wert sich aus andern zuverlässigen Quellen darstellt, ganz unterbleiben.”
77)
§ 228 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 228 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 228 samt Überschrift wie
folgt:„Allgemeine Vorschrift in Rücksicht auf die Vermögensverwaltung
§ 228. Auf die Vermögensverwaltung durch den Vormund sind die
Bestimmungen über die Verwaltung des Vermögens eines minderjährigen
ehelichen Kindes durch seine Eltern anzuwenden; außerdem gelten die
folgenden Bestimmungen.”
78)
§ 229 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft.
Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 229 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 229 samt Überschrift wie folgt:„Besondere Vorschriften:
in Absicht der unmittelbaren Vermögensverwaltung, insonderheit in
Rücksicht der Kostbarkeiten;
§ 229. Juwelen, andere Kostbarkeiten und die Schuldbriefe kommen,
so wie alle wichtigen Urkunden in gerichtliche Verwahrung; von den erstern
erhält der Vormund ein Verzeichnis, von den letztern die zu seinem
Gebrauche nötigen Abschriften.”
79)
Die Überschrift zu § 230 tritt mit 1. Juli 2001 in
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 230 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet die Überschrift wie folgt:„des Geldes
(Anlegung von Mündelgeld);”
80)
§ 230c Abs 2 erster Satz tritt mit 1. Juli 2001 in
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 230c Abs 2 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet Abs 2 erster Satz wie folgt:„(2) Es darf
jedoch eine der Land- oder Forstwirtschaft gewidmete Liegenschaft nicht
über zwei Drittel, eine andere Liegenschaft nicht über die Hälfte des
gemeinen Wertes belastet werden.”
81)
§ 230d tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 230d siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 230d wie folgt:„§ 230d. (1) Der Erwerb
inländischer Liegenschaften ist zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn
sich ihr Wert nicht wegen eines darauf befindlichen Abbaubetriebs ständig
und beträchtlich vermindert und sie nicht ausschließlich oder überwiegend
industriellen oder gewerblichen Zwecken dienen.
(2) Der Kaufpreis darf den gemeinen Wert nicht übersteigen. Die Art
(Widmung, Nutzung) und der gemeine Wert der Liegenschaft sind durch einen
allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen festzustellen.”
82)
§ 231 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 231 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 231 samt Überschrift wie folgt:„des übrigen beweglichen
Vermögens;
§ 231. Das übrige bewegliche Vermögen, das weder zum Gebrauch des
Minderjährigen noch zum Andenken der Familie oder nach Anordnung der
Eltern aufzubewahren ist noch auf eine andere Art vorteilhaft verwendet
werden kann, muß im allgemeinen öffentlich feilgeboten werden. Das
Hausgerät kann man den Eltern und den Miterben in dem gerichtlichen
Schätzungspreise aus freier Hand überlassen. Stücke, die bei der
öffentlichen Versteigerung nicht veräußert worden sind, kann der Vormund
mit Bewilligung des vormundschaftlichen Gerichtes auch unter dem
Schätzungspreise verkaufen.”
83)
§ 232 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 232 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 232 samt Überschrift wie folgt:„in Rücksicht des
unbeweglichen;
§ 232. Ein unbewegliches Gut kann nur im Notfalle oder zum
offenbaren Vorteil des Minderjährigen mit Genehmhaltung des
vormundschaftlichen Gerichtes, und in der Regel nur vermittelst
öffentlicher Versteigerung veräußert, aus wichtigen Gründen aber kann auch
eine Veräußerung aus freier Hand von dem Gerichte bewilligt werden.”
84)
§ 234 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 234 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 234 samt Überschrift wie folgt:„bei Einhebung der
Kapitalien;
§ 234. Ein Vormund kann für sich allein kein Kapital des
Minderjährigen, wenn es zurückbezahlt wird, in Empfang nehmen. Der
Schuldner, dem ein solches Kapital aufgekündigt wird, muß sich zu seiner
Sicherheit von dem Vormunde die gerichtliche Bewilligung zur Erhebung des
Kapitales vorzeigen lassen, und sich nicht mit der Quittung des Vormundes
allein begnügen; auch steht es ihm frei, die Zahlung unmittelbar an das
Gericht selbst zu leisten.”
85)
§ 236 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 236 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 236 samt Überschrift wie folgt:„zur Sicherstellung
unbedeckter Forderungen
§ 236. Über Schuldforderungen, zu deren Beweise keine Urkunden
vorhanden sind, muß der Vormund sich Urkunden verschaffen, und diejenigen,
welche nicht sichergestellt sind, so viel möglich sicherzustellen suchen,
oder zur Verfallszeit eintreiben. Doch soll den Eltern das Kapital des
Minderjährigen, wenn es auch nicht gesetzmäßig versichert, der
Minderjährige jedoch wahrscheinlicher Weise keiner Gefahr eines Verlustes
ausgesetzt ist, nicht aufgekündet werden, wofern ihnen die Zurückbezahlung
oder Veräußerung ihres unbeweglichen Gutes oder Abtretung von ihrem
Gewerbe schwer fallen würde.”
86)
§ 237 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 237 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 237 samt Überschrift wie folgt:„Kaution
§ 237. Der Vormund ist bei Antretung der Vormundschaft nicht
schuldig, Kaution zu leisten. Er bleibt auch in der Folge von der Kaution
befreit, solange er die durch das Gesetz zur Sicherheit des Vermögens
bestehenden Vorschriften genau beobachtet und zur gehörigen Zeit
ordentlich Rechnung legt.”
87)
§ 238 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 238 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 238 samt Überschrift wie folgt:„Verbindlichkeit zur
Rechnungslegung
§ 238. Auf die Rechnungslegung des Vormundes sind die Bestimmungen
über die Rechnungslegung der Eltern eines minderjährigen Kindes
anzuwenden.”
88)
§ 245 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 245 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 245 samt Überschrift wie folgt:„Vertretung
§ 245. Vertreter eines unter Vormundschaft stehenden Minderjährigen
ist, soweit dieser nicht durch einen besonderen Sachwalter vertreten wird,
der Vormund. Soweit nicht anderes bestimmt ist, bedarf er zur Vertretung
in den Angelegenheiten des § 154 Abs. 2 und 3 der Genehmigung des
Gerichtes. Der § 154a Abs. 2 gilt sinngemäß.”
89)
§ 249 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 249 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 249 samt Überschriften wie folgt:„Endigung der
Vormundschaft:
a) durch den Tod;
§ 249. Eine Vormundschaft endigt sich gänzlich durch den Tod des
Minderjährigen. Stirbt aber der Vormund oder wird er entlassen; so muß
nach der Vorschrift des Gesetzes (§ 198 und § 199) ein anderer bestellt
werden.”
90)
§ 250 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft.
Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 250 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 250 samt Überschrift wie folgt:„b) durch das Aufleben
der Befugnisse der Eltern
§ 250. Die Vormundschaft endet auch, wenn einer Person, der die
Obsorge zukommt, die Vermögensverwaltung und die Vertretung, wenn auch nur
in Teilbereichen, zustehen; im zweiten Fall des § 211 endet die
Vormundschaft überdies, wenn ein solcher Elternteil auftritt.”
91)
§ 251 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 251 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 251 samt Überschrift wie folgt:„c) durch
die Volljährigkeit
§ 251. Die Vormundschaft erlischt mit dem Eintritt der
Volljährigkeit des Minderjährigen.”
92)
§ 253 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 253 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 253 samt Überschrift wie folgt:„e) durch Entlassung des
Vormundes
§ 253. Die Entlassung des Vormundes verordnet das Gericht in
einigen Fällen von Amts wegen, in andern, wenn darum angesucht wird.”
93)
§ 254 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 254 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 254 wie folgt:„§ 254. Von Amts wegen muß ein Vormund
entlassen werden, wenn er die Vormundschaft pflichtwidrig verwaltet; wenn
er als unfähig erkannt wird; oder, wenn sich in Ansehung seiner solche
Bedenklichkeiten äußern, welche ihn kraft des Gesetzes von Übernehmung der
Vormundschaft ausgeschlossen haben würden.”
94)
§ 255 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 255 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 255 wie folgt:„§ 255. Gefährdet eine Vormundschaft
über ein nicht eigenes Kind des Vormundes dessen Ehe oder dessen
Familienleben, so hat ihn das Gericht auf Antrag des anderen Ehegatten zu
entlassen, wenn dem nicht ein wichtiges Anliegen des Mündels
entgegensteht.”
95)
§ 256 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 256 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 256 wie folgt:„§ 256. Hat der Erblasser oder das
Gericht einen Vormund nur auf eine Zeit bestellt, oder ihn auf einen
bestimmten Ereignungsfall ausgeschlossen; so muß er entlassen werden,
sobald diese Zeit verflossen, oder der bestimmte Fall eingetreten ist.”
96)
§ 257 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 257 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 257 wie folgt:„§ 257. Wenn während der Vormundschaft
solche Gründe eintreten, die den Vormund kraft der Gesetze von Übernehmung
derselben befreit, oder ausgeschlossen hätten; so ist er in dem erstern
Fall berechtigt, in dem letztern aber verpflichtet, die Entlassung
anzusuchen.”
97)
§ 258 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 258 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 258 wie folgt:„§ 258. Einem Vormunde, dem man als
vermeintlichen nächsten Verwandten des Minderjährigen die Vormundschaft
aufgetragen hat, steht es frei, einen später entdeckten, nähern und
tauglichen Verwandten an seine Stelle vorzuschlagen: allein der nähere
Verwandte hat kein Recht, zu fordern, daß ihm ein minder naher Verwandter
eine bereits angetretene Vormundschaft abtrete; er wäre denn früher sich
zu melden gehindert worden.”
98)
§ 261 samt Überschriften tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 261 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 261 samt Überschriften wie
folgt:„Bedingungen zur Entlassung des Vormundes:
a) gewöhnlicher Zeitpunkt;
§ 261. Ein Vormund kann in der Regel nur am Ende des
vormundschaftlichen Jahres, nachdem sein Nachfolger die Verwaltung des
Vermögens ordentlich übernommen hat, die Vormundschaft niederlegen. Findet
aber das Gericht es zur Sicherheit der Person oder des Vermögens
notwendig, so kann es ihm selbe auch sogleich abnehmen.”
99)
§ 262 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 262 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 262 samt Überschrift wie folgt:„b)
Schlußrechnung;
§ 262. Ein Vormund ist verbunden, längstens innerhalb zwei Monaten
nach geendigter Vormundschaft dem Gerichte seine Schlußrechnung zu
übergeben, und erhält von demselben nach gepflogener Richtigkeit eine
Urkunde über die redlich und ordentlich geführte Verwaltung seines Amtes.
Diese Urkunde spricht ihn aber von der Verbindlichkeit aus einer später
entdeckten arglistigen Handlung nicht frei.”
100)
§ 263 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 263 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 263 samt Überschrift wie folgt:„c)
Übergabe des Vermögens
§ 263. Am Ende einer Vormundschaft ist es die Pflicht des
Vormundes, das Vermögen dem volljährig Gewordenen, oder dem neu bestellten
Vormunde gegen Empfangsschein zu übergeben, und sich darüber bei Gericht
auszuweisen. Das aufgenommene Verzeichnis des Vermögens, und die jährlich
genehmigten Rechnungen dienen bei solchen Übergaben zur Richtschnur.”
101)
§ 264 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft.
Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 264 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 264 samt Überschrift wie folgt:„Haftung des Vormundes
aus fremdem Verschulden
§ 264. Insgemein hat ein Vormund nur für sein Verschulden und nicht
auch für das Verschulden der ihm Untergeordneten zu haften. Hat er aber
wissentlich unfähige Personen angestellt, hat er solche beibehalten, oder
nicht auf den Ersatz des von ihnen verursachten Schadens gedrungen; so ist
er auch dieser Nachlässigkeit wegen verantwortlich.”
102)
§ 265 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 265 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Der
bisherige § 265 wurde materiell derogiert durch das Amtshaftungsgesetz,
BGBl 1949/20.
103)
§ 266 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft.
Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 266 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 266 samt Überschriften wie folgt:„Belohnung des
Vormundes:
a) jährliche;
§ 266. Emsigen Vormündern kann das Gericht aus den in Ersparung
kommenden Einkünften eine verhältnismäßige jährliche Belohnung zuerkennen;
doch darf diese Belohnung nie mehr als fünf vom Hundert der reinen
Einkünfte betragen.”
104)
§ 267 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft.
Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 267 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 267 samt Überschrift wie folgt:„b) oder bei dem
Austritte
§ 267. Wenn das Vermögen des Minderjährigen so gering ist, daß sich
wenig oder nichts in jährliche Ersparung bringen läßt, so kann einem
Vormunde, welcher das Vermögen unvermindert erhalten, oder dem
Minderjährigen eine anständige Versorgung verschafft hat, wenigstens am
Ende der Vormundschaft eine den Umständen angemessene Belohnung erteilt
werden.”
105)
§ 269 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 269 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 269 samt Überschrift wie folgt:„II. Von der Kuratel
§ 269. Demjenigen, der seine oder einzelne seiner Angelegenheiten
gehörig zu besorgen nicht vermag, ist, soweit er nicht durch einen
Elternteil oder Vormund gesetzlich vertreten ist oder vertreten werden
kann, ein Kurator oder Sachwalter zu bestellen.”
106)
Die Überschrift zu § 270 tritt mit 1. Juli 2001 außer
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet die Überschrift wie folgt:„Fälle der Kuratel:”
107)
§ 271 samt Überschrift tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft.
Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 271 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 271 samt Überschrift wie folgt:„a) für Minderjährige;
§ 271. In Geschäften, welche zwischen Eltern und einem
minderjährigen Kinde, oder zwischen einem Vormunde und dem Minderjährigen
vorfallen, muß das Gericht angegangen werden, für den Minderjährigen einen
besondern Kurator zu ernennen.”
108)
§ 272 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 272 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 272 wie folgt:„§ 272. Fallen zwischen zwei oder
mehrern Minderjährigen, welche einen und denselben Vormund haben,
Rechtsstreitigkeiten vor, so darf dieser Vormund keinen der Minderjährigen
vertreten; sondern er muß das Gericht angehen, daß es für jeden
insbesondere einen andern Kurator ernenne.”
109)
§ 273 Abs 1 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 273 Abs 1 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet Abs 1 wie folgt:„(1) Vermag eine Person, die an
einer psychischen Krankheit leidet oder geistig behindert ist, alle oder
einzelne ihrer Angelegenheiten nicht ohne Gefahr eines Nachteils für sich
selbst zu besorgen, so ist ihr auf ihren Antrag oder von Amts wegen dazu
ein Sachwalter zu bestellen.”
110)
§ 274 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 274 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 274 wie folgt:„§ 274. In Rücksicht auf Ungeborne
wird ein Sachwalter entweder für die Nachkommenschaft überhaupt, oder für
eine bereits vorhandene Leibesfrucht (§ 22) aufgestellt. Im ersten Falle
hat der Sachwalter dafür zu sorgen, daß die Nachkommenschaft bei einem ihr
bestimmten Nachlasse nicht verkürzt werde; im zweiten Falle aber, daß die
Rechte des noch ungebornen Kindes erhalten werden.”
111)
§ 276 erster Satz tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 276 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 276 erster Satz wie folgt:„Die Bestellung eines Kurators
für Abwesende, oder für die dem Gerichte zur Zeit noch unbekannten
Teilnehmer an einem Geschäfte findet dann statt, wenn sie keinen
ordentlichen Sachwalter zurückgelassen haben, ohne solchen aber ihre
Rechte durch Verzug gefährdet, oder die Rechte eines andern in ihrem Gange
gehemmt würden.”
112)
§ 282 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 282 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 282 wie folgt:„§ 282. Soweit nicht anderes bestimmt
ist, sind die Bestimmungen für den Vormund auch für die Rechte und
Pflichten des Sachwalters (Kurators) maßgebend. Der Sachwalter einer
behinderten Person hat auch die erforderliche Personensorge, besonders
auch die ärztliche und soziale Betreuung, sicherzustellen, soweit das
Gericht nicht anderes bestimmt.”
113)
§ 249 wurde aufgehoben durch das
Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001, BGBl I 2000/135.
114)
§ 254 wurde aufgehoben durch das
Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001, BGBl I 2000/135.
115)
§ 257 wurde aufgehoben durch das
Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001, BGBl I 2000/135.
116)
§ 386 letzter Satz tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft.
117)
§ 388 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft; bis zu diesem
Zeitpunkt lautet § 388 wie folgt:
„a) verlorner Sachen;
§ 388. Es ist im Zweifel nicht zu vermuten, daß jemand sein
Eigentum wolle fahren lassen; daher darf kein Finder eine gefundene Sache
für verlassen ansehen und sich dieselbe zueignen. Noch weniger darf sich
jemand des Strandrechtes anmaßen.”
118)
§ 389 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft; bis zu diesem
Zeitpunkt lautet § 389 wie folgt:
㤠389. Der Finder ist also verbunden, dem vorigen Besitzer, wenn
er aus den Merkmalen der Sache, oder aus andern Umständen deutlich erkannt
wird, die Sache zurückzugeben. Ist ihm der vorige Besitzer nicht bekannt,
so muß er, wenn das Gefundene 10 Euro am Werte übersteigt, den Fund
innerhalb acht Tagen auf die an jedem Orte gewöhnliche Art bekanntmachen
lassen, und wenn die gefundene Sache mehr als 40 Euro wert ist, den
Vorfall der Ortsobrigkeit anzeigen.”
119)
§ 390 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft, bis zu diesem
Zeitpunkt lautet § 390 wie folgt:
㤠390. Die Obrigkeit hat die gemachte Anzeige, ohne die besondern
Merkmale der gefundenen Sachen zu berühren, ungesäumt auf die an jedem
Orte gewöhnliche Art; wenn aber der Eigentümer in einer den Umständen
angemessenen Zeitfrist sich nicht entdeckt, und der Wert der gefundenen
Sache 400 Euro übersteigt, dreimal durch die öffentlichen Zeitungsblätter
bekanntzumachen. Kann die gefundene Sache nicht ohne Gefahr in den Händen
des Finders gelassen werden; so muß die Sache, oder, wenn diese nicht ohne
merklichen Schaden aufbewahrt werden könnte, der durch die öffentliche
Feilbietung daraus gelöste Wert gerichtlich hinterlegt, oder einem Dritten
zur Verwahrung übergeben werden.”
120)
§ 391 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft; bis zu diesem
Zeitpunkt lautet § 391 wie folgt:
„§ 391. Wenn sich der vorige Inhaber oder Eigentümer der gefundenen
Sache in einer Jahresfrist, von der Zeit der vollendeten Kundmachung,
meldet, und sein Recht gehörig dartut, wird ihm die Sache oder das daraus
gelöste Geld verabfolgt. Er ist jedoch verbunden, die Auslagen zu
vergüten, und dem Finder auf Verlangen zehn von Hundert des gemeinen
Wertes als Finderlohn zu entrichten. Wenn aber nach dieser Berechnung die
Belohnung eine Summe von 200 Euro erreicht hat; so soll sie in Rücksicht
des Übermaßes nur zu fünf von Hundert ausgemessen werden.”
121)
§ 392 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft. § 392 in der
Fassung dieses Bundesgesetzes gilt nicht, wenn der Finder die verlorene
oder vergessene Sache vor dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes
entdeckt und an sich genommen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt lautet § 392
wie folgt:
㤠392. Wird die gefundene Sache innerhalb der Jahresfrist von
niemandem mit Recht angesprochen, so erhält der Finder das Recht, die
Sache oder den daraus gelösten Wert zu benützen. Meldet sich der vorige
Inhaber in der Folge, so muß ihm nach Abzug der Kosten und des
Finderlohnes die Sache, oder der gelöste Wert samt den etwa daraus
gezogenen Zinsen zurückgestellt werden. Erst nach der Verjährungszeit
erlangt der Finder, gleich einem redlichen Besitzer, das Eigentumsrecht.”
122)
§ 393 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft. § 393 in der
Fassung dieses Bundesgesetzes gilt nicht, wenn der Finder die verlorene
oder vergessene Sache vor dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes
entdeckt und an sich genommen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt lautet § 393
wie folgt:
㤠393. Wer immer die in den
§§ 388
bis 392 angeführten Vorschriften außer acht läßt, haftet für alle
schädlichen Folgen. Läßt sie der Finder außer acht, so verwirkt er auch
den Finderlohn, und macht sich zu Folge des Strafgesetzbuches noch
überdies nach Umständen des Betruges schuldig.”
123)
§ 394 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft. § 394 in der
Fassung dieses Bundesgesetzes gilt nicht, wenn der Finder die verlorene
oder vergessene Sache vor dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes
entdeckt und an sich genommen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt lautet § 394
wie folgt:
㤠394. Mehrern Personen, welche eine Sache zugleich gefunden
haben, kommen in Rücksicht derselben gleiche Verbindlichkeiten und Rechte
zu. Unter die Mitfinder wird auch derjenige gezählt, welcher zuerst die
Sache entdeckt, und nach derselben gestrebt hat, obgleich ein anderer sie
früher an sich gezogen hätte.”
124)
§ 395 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft. § 395 in der
Fassung dieses Bundesgesetzes gilt nicht, wenn der Finder die verlorene
oder vergessene Sache vor dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes
entdeckt und an sich genommen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt lautet § 395
wie folgt:
„b) verborgener Gegenstände;
§ 395. Werden vergrabene, eingemauerte oder sonst verborgene Sachen
eines unbekannten Eigentümers entdeckt; muß die Anzeige so, wie bei dem
Funde überhaupt, gemacht werden.”
125)
§ 396 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft. § 396 in der
Fassung dieses Bundesgesetzes gilt nicht, wenn der Finder die verlorene
oder vergessene Sache vor dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes
entdeckt und an sich genommen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt lautet § 396
wie folgt:
„§ 396. Wird der Eigentümer aus den äußerlichen Merkmalen oder
andern Umständen entdeckt, so ist ihm die Sache zuzustellen; er muß aber,
wenn er nicht beweisen kann, schon eher Kenntnis davon gehabt zu haben,
dem Finder den im
§ 391
ausgemessenen Finderlohn entrichten.”
126)
§ 397 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft. § 397 in der
Fassung dieses Bundesgesetzes gilt nicht, wenn der Finder die verlorene
oder vergessene Sache vor dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes
entdeckt und an sich genommen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt lautet § 397
wie folgt:
„§ 397. In dem Falle, daß sich der Eigentümer nicht sogleich
erkennen läßt, muß die Obrigkeit nach den Vorschriften der
§§ 390
bis 392 verfahren.”
127)
§ 399 tritt mit 1. Februar 2003 in Kraft; bis zu diesem
Zeitpunkt lautet § 399 wie folgt:
„§ 399. Von einem Schatze [wird der dritte Teil zum Staatsvermögen
gezogen.] Von den zwei [übrigen Dritt]teilen erhält eines der Finder, das
andere der Eigentümer des Grundes. Ist das Eigentum des Grundes geteilt,
so fällt das [Dritt]teil dem Ober- und Nutzungseigentümer zu gleichen
Teilen zu.”
128)
§ 568 zweiter und dritter Satz treten mit 1. Juli 2001
in Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 568 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001.
129)
§ 569 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 569 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 569 wie folgt:„§ 569. Unmündige sind zu testieren
unfähig. Minderjährige, die das achtzehnte Jahr noch nicht zurückgelegt
haben, können nur mündlich vor Gerichte oder mündlich notariell testieren.
Das Gericht muß durch eine angemessene Erforschung sich zu überzeugen
suchen, daß die Erklärung des letzten Willens frei und mit Überlegung
geschehe. Die Erklärung muß in ein Protokoll aufgenommen, und dasjenige,
was sich aus der Erforschung ergeben hat, beigerückt werden. Nach
zurückgelegtem achtzehnten Jahre kann ohne weitere Einschränkung ein
letzter Wille erklärt werden.”
130)
§ 773a Abs 3 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 773a Abs 3 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001.
131)
§ 805 zweiter Satz tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft.
Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 805 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 805 zweiter Satz wie folgt:„ Vormünder und Kuratoren
haben die am gehörigen Orte erteilten Vorschriften zu befolgen [(§ 233)].”
132)
§ 865 zweiter Satz, erster Halbsatz tritt mit 1. Juli
2001 in Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 865 siehe Art XVIII
des KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 865 zweiter Satz, erster Halbsatz wie
folgt:„Andere Personen hingegen, die von Eltern, einem Vormund oder einem
Sachwalter abhängen, können zwar ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes
Versprechen annehmen;”
133)
§ 866 tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 866 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001. Bis
dahin lautet § 866 wie folgt:„§ 866. Wer nach Vollendung des
achtzehnten Lebensjahrs listigerweise vorgibt, daß er Verträge zu
schließen fähig sei, und dadurch einen anderen, der darüber nicht leicht
Erkundigung einholen konnte, hintergeht, ist zur Genugtuung verpflichtet.”
134)
§ 922 samt Überschrift tritt mit 1. Jänner 2002 in
Kraft und ist auf Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001
geschlossen werden. Bis dahin lautet § 922 samt Überschrift wie
folgt:„Gewährleistung
§ 922. Wenn jemand eine Sache auf eine entgeltliche Art einem
andern überläßt, so leistet er Gewähr, daß sie die ausdrücklich
bedungenen, oder gewöhnlich dabei vorausgesetzten Eigenschaften habe, und
daß sie der Natur des Geschäftes, oder der getroffenen Verabredung gemäß
benützt, und verwendet werden könne.”
135)
§ 924 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft und ist auf
Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 geschlossen werden.
136)
§ 932 samt Überschrift tritt mit 1. Jänner 2002 in
Kraft und ist auf Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001
geschlossen werden. Bis dahin lautet § 932 samt Überschrift wie
folgt:„Wirkung
§ 932. (1) Ist der die Gewährleistung begründende Mangel von der
Art, daß er nicht mehr behoben werden kann und daß er den ordentlichen
Gebrauch der Sache verhindert, so kann der Übernehmer die gänzliche
Aufhebung des Vertrages, wenn hingegen der Mangel den ordentlichen
Gebrauch nicht verhindert oder wenn er behoben werden kann, entweder eine
angemessene Minderung des Entgelts oder die Verbesserung oder den Nachtrag
des Fehlenden fordern. In allen Fällen haftet der Übergeber für den
verschuldeten Schaden.
(2) Eine unerhebliche Minderung des Wertes kommt nicht in Betracht.”
137)
§ 933 samt Überschrift tritt mit 1. Jänner 2002 in
Kraft und ist auf Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001
geschlossen werden. Bis dahin lautet § 933 samt Überschrift wie
folgt:„Erlöschung des Rechtes der Gewährleistung
§ 933. (1) Wer die Gewährleistung fordern will, muß sein Recht,
wenn es unbewegliche Sachen betrifft, binnen drei Jahren, wenn es
bewegliche Sachen betrifft, binnen sechs Monaten und, wenn es sich um
Viehmängel handelt, binnen sechs Wochen gerichtlich geltend machen, sonst
ist die Klage erloschen. Die Frist beginnt von dem Tage der Ablieferung
der Sache; für die Gewährleistung wegen solcher Viehmängel, bezüglich
deren eine Vermutungsfrist besteht, von dem Tage, an dem diese endet; für
die Gewährleistung wegen eines von einem Dritten auf die Sache erhobenen
Anspruches aber von dem Tage, an welchem dieser dem Erwerber bekannt
wurde.
(2) Die Geltendmachung durch Einrede bleibt dem Erwerber vorbehalten, wenn
er innerhalb der Frist dem Übergeber den Mangel angezeigt hat.”
138)
§ 933a samt Überschrift tritt mit 1. Jänner 2002 in
Kraft und ist auf Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001
geschlossen werden.
139)
§ 933b samt Überschrift tritt mit 1. Jänner 2002 in
Kraft und ist auf Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001
geschlossen werden.
140)
Die Ersetzung des Betrages „7 500 S” durch „550 Euro”
ist auf Schadensereignisse anzuwenden, die sich nach dem 31. Dezember 2001
ereignet haben.
141)
§ 1034 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 1034 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 1034 wie folgt:„§ 1034. Das Recht der Vormünder
und Kuratoren, die Geschäfte ihrer Pflegebefohlenen zu verwalten, gründet
sich auf die Anordnung des Gerichtes, von welchem sie bestellt sind. Das
Recht der Eltern, ihre minderjährigen ehelichen Kinder zu vertreten, wird
unmittelbar durch das Gesetz eingeräumt.”
142)
§ 1167 samt Überschrift tritt mit 1. Jänner 2002 in
Kraft und ist auf Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001
geschlossen werden. Bis dahin lautet § 1167 samt Überschrift wie
folgt:„Gewährleistung für Mängel
§ 1167. Bei wesentlichen Mängeln, welche das Werk unbrauchbar
machen oder der ausdrücklichen Bedingung zuwiderlaufen, kann der Besteller
vom Vertrage abgehen. Will er das nicht oder sind die Mängel weder
wesentlich noch gegen die ausdrückliche Bedingung, so kann er die
Verbesserung, falls diese nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordern würde, oder eine angemessene Minderung des Entgelts fordern. Zur
Verbesserung muß er dem Unternehmer eine angemessene Frist setzen, mit der
Erklärung, daß er nach deren Ablauf die Verbesserung ablehne. Im übrigen
kommen die für die Gewährleistung bei entgeltlichen Verträgen überhaupt
gegebenen Vorschriften zur Anwendung.”
143)
§ 1245 zweiter Satz tritt mit 1. Juli 2001 außer Kraft.
Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 1245 siehe Art XVIII des KindRÄG
2001. Bis dahin lautet § 1245 zweiter Satz wie folgt:„Vormünder und
Kuratoren einer pflegebefohlenen Braut können die Sicherstellung des
Heiratsgutes, und ebenso der bedungenen Widerlage und des Witwengehaltes
ohne Genehmigung des [ober]vormundschaftlichen Gerichtes nicht erlassen.”
144)
Zur Verbandsklage gemäß dem
Zinsenrechts-Änderungsgesetz siehe die
Bemerkung nach § 1000.
145)
§ 1374 tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 1374 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 1374 wie folgt:„§ 1374. Niemand ist schuldig,
eine Sache, die zur Sicherstellung dienen soll, in einem höheren, als dem,
bei Häusern auf die Hälfte, bei Grundstücken aber, und bei beweglichen
Gütern auf zwei Dritteile der Schätzung bestimmten Werte zum Pfande
anzunehmen. Wer ein angemessenes Vermögen besitzt, und in der Provinz
[nunmehr: dem Bundesland] belangt werden kann, ist ein tauglicher Bürge.”
146)
§ 1421 letzter Halbsatz tritt mit 1. Juli 2001 in
Kraft. Zur Übergangsregelung hinsichtlich § 1421 siehe Art XVIII des
KindRÄG 2001. Bis dahin lautet § 1421 letzter Halbsatz wie folgt:„so ist
ihr Vormund oder Kurator berechtigt, das Bezahlte zurückzufordern.”
147)
§ 1495 erster Satz tritt mit 1. Juli 2001 in Kraft. Zur
Übergangsregelung hinsichtlich § 1495 siehe Art XVIII des KindRÄG 2001.
Bis dahin lautet § 1495 erster Satz wie folgt:„Auch zwischen Ehegatten,
dann zwischen Kindern oder Pflegebefohlenen, und ihren Eltern oder
Vormündern kann, so lange erstere in ehelicher Verbindung, letztere unter
elterlicher oder vormundschaftlicher Gewalt stehen, die Ersitzung oder
Verjährung weder angefangen, noch fortgesetzt werden.”